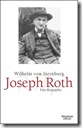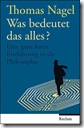Der zweite Band Verratenes Volk schließt zeitlich unmittelbar an den ersten an und umfasst die Tage vom 22. November bis zum 7. Dezember 1918. Schwerpunkt des Schauplatzes ist Berlin, ohne dass die Ereignisse in Straßburg komplett ausgeblendet würden. Einzelne Episoden spielen auch in Hamburg, München, Kassel oder Paris. Das Personal wird noch einmal erweitert: Sowohl das Berliner Proletariat als auch eine alte Kasseler Adelige kommen ausführlich zu Wort.
Der zweite Band Verratenes Volk schließt zeitlich unmittelbar an den ersten an und umfasst die Tage vom 22. November bis zum 7. Dezember 1918. Schwerpunkt des Schauplatzes ist Berlin, ohne dass die Ereignisse in Straßburg komplett ausgeblendet würden. Einzelne Episoden spielen auch in Hamburg, München, Kassel oder Paris. Das Personal wird noch einmal erweitert: Sowohl das Berliner Proletariat als auch eine alte Kasseler Adelige kommen ausführlich zu Wort.
Auf der privaten Ebene verfolgt der Roman die beiden ehemaligen Offiziere Friedrich Becker und Johannes Maus weiter, die beide auf getrennten Wegen inzwischen in Berlin angekommen sind. Während Maus sich von den revolutionären Ereignissen mitreißen lässt, gerät Becker zunehmend in eine Isolation, aus der ihn weder Maus noch sein ehemaliger Kollege – Becker ist Altphilologe und war vor dem Krieg Gymnasiallehrer – Krug noch die ihm von Straßburg aus nachgereiste Krankenschwester Hilde befreien können. Parallel zu der mehr und mehr Platz einehmenden Geschichte Beckers wird die des Dramatikers Erwin Stauffer erzählt: Stauffer, den die revolutionären Entwicklungen weitgehend gleichgültig lassen, findet anlässlich eines Umzugs einen Stapel ungeöffneter Briefe, die seine Ex-Frau ihm unterschlagen hatte. Es handelt sich um Briefe einer Schauspielerin, mit der Stauffer vor über 20 Jahren eine kurze Affäre hatte. Wutentbrannt über die Unterschlagung reist Stauffer nach Hamburg, um seine Frau, mit der er seit 19 Jahren keinen Kontakt mehr hatte, zur Rede zu stellen. Diese fertigt ihn allerdings kurz und knapp ab. Doch hat die Reise wenigstens den Effekt, dass Stauffer seine nun erwachsene Tochter kennenlernt. Er reist nach Berlin zurück und macht sich von dort aus auf die Suche nach seiner ehemaligen Geliebten.
Weniger umfangreiche Episoden schildern den Alltag Berliner Arbeiter, heimgekehrter Soldaten, kleinerer und größerer Schieber usw. Auch einige der Straßburger Figuren werden, wie schon angedeutet, weiter verfolgt.
Auf der historischen Ebene schildert Döblin drei der um die Macht in der jungen Republik ringenden Parteien: Den Volksbeauftragten Ebert und sein Kabinett aus Mitgliedern der SPD und USPD, die versuchen, einen Putsch zu verhindern und die Wahl zur Nationalversammlung auf den Weg zu bringen, das Hauptquartier des Heeres in Kassel, das sich – wohl in der Hauptsache aufgrund des Widerstandes Hindenburgs – nicht zu einem Militärputsch entschließen kann und deshalb in Teilen mangels einer Alternative eine illusionistische monarchistische Linie vertritt, und die Spartakisten um Karl Liebknecht – Rosa Luxemburg spielt in diesem Band eine Nebenrolle –, der vor einer Radikalisierung der Revolution zurückscheut, da er den sich daraus zwangsläufig entwickelnden Bürgerkrieg fürchtet. Ihm zur Seite steht der russische Berater Radek, der auf eine Verschärfung der revolutionären Umtriebe drängt und in Deutschland ein Rätesystem etabliert sehen möchte.
Höhe- und Endpunkt des zweiten Bandes bilden die bewaffneten Zusammenstöße in Berlin am 6. November, unmittelbar vor dem Einzug der rückkehrenden Fronttruppen nach Berlin. Deutschland scheint am Rande des Bürgerkriegs zu stehen; sowohl die militärische Führung als auch die Arbeiterschaft erwartet, dass die jeweils andere Seite zum bewaffneten Kampf um die Staatsmacht übergehen wird.
Alfred Döblin: November 1918. Eine deutsche Revolution. Verratenes Volk. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2008. Leinen, Lesebändchen, 489 Seiten. 18,90 €.