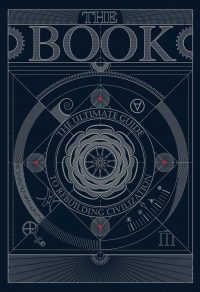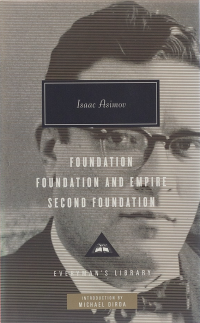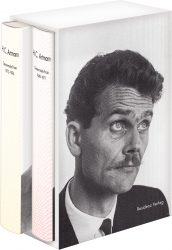Ein Ge- oder Verschenkbuch ist eines, dass man für sich selbst nicht kaufen würde, bei dem man sich im besten Fall aber freuen würde, wenn man es geschenkt bekäme. Im schlechteren Fall schenkt man es einer/m, weil man sonst nicht weiß, was man ihr/m schenken soll. Es gibt einfach Menschen, die haben schon alle anderen Bücher – also, falls sie überhaupt welche haben. Aber lassen wir die Abgründe der Geschenke-Dialektik rasch hinter uns und wenden uns dem vorliegenden Fall eines typischen Geschenkbuchs zu:
Ein Ge- oder Verschenkbuch ist eines, dass man für sich selbst nicht kaufen würde, bei dem man sich im besten Fall aber freuen würde, wenn man es geschenkt bekäme. Im schlechteren Fall schenkt man es einer/m, weil man sonst nicht weiß, was man ihr/m schenken soll. Es gibt einfach Menschen, die haben schon alle anderen Bücher – also, falls sie überhaupt welche haben. Aber lassen wir die Abgründe der Geschenke-Dialektik rasch hinter uns und wenden uns dem vorliegenden Fall eines typischen Geschenkbuchs zu:
Der Dudenverlag (einer der wenigen deutschen Verlage, der zwischen seinem Namen und seiner Branche lobenswerter Weise kein Leerzeichen pflegt) legt ein Büchlein mit 50 sogenannten Infografiken rund um die Sprache vor. Die meisten dieser angeblichen Grafiken umfassen eine Doppelseite, so dass man ein ganz nettes Büchlein für die 10 geforderten Euro erhält: Es ist nicht zu groß, lässt sich gut einpacken, der bilderbuchdicke Pappeinband trägt zusätzlich zum soliden Eindruck bei. Zum Durchblättern ist der Band ganz nett, nur genauer hinschauen, geschweige denn zugleich dabei denken sollte der Betrachter nicht. Oder doch?
Es fängt damit an, dass – wie oben schon angedeutet – zahlreiche der Grafiken nur mit Müh und Not als solche anzusprechen sind. Die meisten Seiten präsentieren mehr oder weniger einleuchtend ummalte Wortlisten (es ist ja bei einem Buch über Sprache auch nur wenig anderes zu erwarten), nur in einzelnen Fällen trägt der grafische Anteil eine zusätzliche Information. So erfahren wir etwa in Grafik 28 den längsten und die kürzesten Ortsnamen in Europa und in Deutschland, und zusätzlich informieren uns Grafiken wo Oy bzw. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ungefähr liegen. Auf anderen Seiten (74/75, Grafik 34) hat der Grafiker schlicht vor der Aufgabe kapituliert und aus der Wörterliste eine Wörterliste gemacht; eine Tabelle ist ja schließlich auch eine Art von Grafik, irgendwie, oder?
Schauen wir uns ein paar Grafiken inhaltlich an: Grafik 33 präsentiert sogenannte Wortwolken; in der Mitte steht ein Bezugswort und außen herum angeblich Wörter, die mit dem Bezugswort „typische Verbindungen“ eingehen, wobei die Größe, in der diese Wörter dargestellt sind, Auskunft darüber geben soll, wie typisch die Verbindung ist. Nun erscheint mir das Messen eines Grads von – ja was? Typischsein? eher schwierig, weshalb ich eher einen Grad der Häufigkeit der Verbindung erwartet hätte. Das kann aber nicht dargestellt sein, denn eine Verbindung wie „Sinn machen“, die extrem häufig verwendet wird, bewertet die Grafik als sehr untypisch, während eine Verbindung von „blau“ und „Maus“ – da wage ich nicht einmal das sprachliche Normal zu bilden [„Maus, Du bist ja schon wieder blau“?] – sehr typisch sein muss, wenn es nach der Grafik 33 geht. Aber nicht nur ich scheine hier meine Zweifel zu haben, denn die Redaktion warnt Betrachter dieser Grafik: „Die Daten, die den Wolken zugrunde liegen, sind maschinell erzeugt [„Wenn man Tomatensaft ganz maschinell erzeugt, dann wird es Automatensaft“, heißt es bei Georg Kreisler] und nicht das Ergebnis redaktioneller Arbeit. Das bedeutet [ist es nicht nett, dass die Redaktion meint, erläutern zu müssen, was es bedeutet, dass etwas nicht das Ergebnis redaktioneller Arbeit ist; eher würde man erwarten, dass sie erklärt, was denn überhaupt redaktionelle Arbeit ist]: Sie stellen keine Handlungsempfehlung oder Wertung dar.“ Ergo ist das Ergebnis redaktioneller Arbeit normalerweise eine Handlungsempfehlung oder Wertung? Na, lassen wir es auf sich beruhen.
Wenden wir uns stattdessen Grafik 4 zu: „Das moderne lateinische Alphabet besteht bekanntlich 26 Buchstaben.“ So geht es zu, nachdem man erst einmal das Wort ,bekanntlich‘ zur Sprache zugelassen hat: ä, ö und ü sind keine eigenen Buchstaben, sondern a, o und u mit einem Trema [„Nein, das kommt in dem Fall nicht vom Trinken, Maus!“] bzw. Umlautpunkten, die vom Trema aber nicht einmal mikroskopisch zu unterscheiden sind; und das arme ß besteht nun gleich aus zwei Buchstaben, die für immer ligiert [sic!] wurden, wird also auch nicht als wirklicher Buchstabe gezählt, auch wenn es inzwischen einen großen Bruder bekommen hat [Patchwork-Family]. Es bleibt also dabei: 26 Buchstaben. Folgt eine Grafik, die deutlich macht, dass zahlreiche Sprachen in ihrer Schreibung auf die Verwendung einiger dieser Zeichen verzichten (Hawaiisch verwendet zum Beispiel nur 12 lateinischen Buchstaben und kommt auch so sehr gut zurecht), während andere, nicht-lateinische Alphabete oft deutlich mehr als 26 Zeichen verwenden, so etwa „das japanische Alphabet“ mit angeblich 46 Zeichen. Abgebildet sind dann 46 Zeichen Katakana, was den Fall hinreichend und schlüssig beweist. Schade nur, dass es eben gar kein „japanisches Alphabet“ gibt, denn erstens vertreten die Zeichen nur im Fall der Vokale einen einzelnen Laut in unserem Sinne, während alle anderen Zeichen eine Zusammensetzung aus Konsonant und Vokal repräsentieren (nur das ン steht für einen Nasal am Silbenende), zweitens gibt es mit Katakana und Hiragana mindestens zwei originär japanische Aufschreibsysteme, drittens steht die Zahl 46 für eine recht restriktive Zählung der im Gebrauch befindlichen Kana (eigentlich gibt es mindestens 51 unterschiedliche Zeichen, die zudem auch noch abgewandelt werden können [vgl. oben das Umlautschicksal!]) und viertens sollte man sicherlich auch über Kanjis reden, wenn man schon über japanische Schriftzeichen spricht. Aber 46 Buchstaben im japanischen Alphabet geht natürlich auch. Ist zwar falsch, prägt sich aber gut ein, wie einer meiner Professoren in Tübingen seine Falschinformationen zu rechtfertigen pflegte.
Ich höre jetzt auf. Wie man leicht sieht, bietet das Büchlein einem besserwisserisch veranlagten Menschen tage-, vielleicht auch wochenlang Spaß und Gelegenheit, seinen Mitgeschöpfen auf die Nerven zu gehen. Andererseits ist er, hat er den ersten Fehler entdeckt, so sehr mit der Prüfung der anderen Grafiken beschäftigt, dass man auch stundenlang Ruhe vor ihm hat. Ob dies alles die verlangten 10 Euro wert ist, muss natürlich jede/er für sich selbst beurteilen. Ich jedenfalls werde mein Rezensionsexemplar sogleich verschenken. An jemanden, der allem Gedruckten blind vertraut: „Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.“
Sprache in Bildern. Zahlen, Fakten & Kurioses aus der Welt der Wörter. Berlin: Bibliographisches Institut, 2017. Bedruckter Pappband, 111 Seiten. 10,– €.