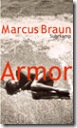Eine etwas andere Literaturgeschichte will Peter Braun mit diesem Buch liefern. Es wendet sich offensichtlich an jugendliche Leser, deren Sympathien Braun im Vorwort dadurch zu gewinnen sucht, dass er feststellt, er selbst erinnere sich an keine einzige seiner Schullektüren, habe dann aber später das Lesen für sich entdeckt usw. usf. Diese Misere sei durch eine falsche Präsentation der Literatur in den Schulen zu verantworten, und seine andere Literaturgeschichte erzähle nun die spannenden Geschichten über die Autoren klassischer Werke, die in Brauns Schulausbildung nie erwähnt wurden.
Eine etwas andere Literaturgeschichte will Peter Braun mit diesem Buch liefern. Es wendet sich offensichtlich an jugendliche Leser, deren Sympathien Braun im Vorwort dadurch zu gewinnen sucht, dass er feststellt, er selbst erinnere sich an keine einzige seiner Schullektüren, habe dann aber später das Lesen für sich entdeckt usw. usf. Diese Misere sei durch eine falsche Präsentation der Literatur in den Schulen zu verantworten, und seine andere Literaturgeschichte erzähle nun die spannenden Geschichten über die Autoren klassischer Werke, die in Brauns Schulausbildung nie erwähnt wurden.
So weit, so gehöft. Man kann eine solche Theorie natürlich vertreten, und ob sie viel besser oder schlechter als irgendeine andere das Phänomen beschreibt, dass die Schule aus den wenigsten Schülern gute Leser macht, mag dahingestellt bleiben. Merkwürdigerweise fehlen ähnliche Klagen über den Mathematik-Unterricht beinahe vollständig, obwohl sicherlich noch deutlich weniger gute Mathematiker aus diesem Unterricht hervorgehen als gute Leser aus dem Deutsch-Unterricht. Lassen wir das auf sich beruhen.
Brauns Ansatz ist nach diesem Auftakt berauschend unoriginell. Auch er tut nichts als das, was ein guter Deutsch-Unterricht auch tun sollte: Er stellt Autoren und behandelte Werke in den Zeithorizont ein, erzählt, warum diese Bücher für die Zeitgenossen spannend waren und was die behandelten Texte vor anderen ihrer Zeit auszeichnet. Er bedient sich dabei einer lockeren Schreibe, von der ich mir durchaus vorstellen kann, dass Jugendliche damit ganz gut zurecht kommen. Ich schlage das Buch auf und lese:
Heine war aus dem geistig engen, miefigen Deutschland nach Paris gezogen. Von dort aus schrieb er gegen die gesellschaftliche Eiszeit in Deutschland an, das in der politischen Winterstarre verharrte, die Heine zeit seines Lebens nicht ruhen ließ. »Denk ich an Deutschland in der Nacht«, schrieb er in Deutschland. Ein Wintermärchen, »dann bin ich um den Schlaf gebracht.« Der Titel passte zu diesem bedeutendsten Werk Heinrich Heines. [S. 90]
Nein, das schrieb Heine nicht in Deutschland. Ein Wintermärchen, sondern im Gedicht Nachtgedanken, und selbstverständlich haben diese Zeilen auch gar nichts mit der politischen Opposition Heines gegen das bürgerliche Deutschland zu tun – auch wenn sie immer und immer wieder in diesem Zusammenhang zitiert werden von all denen, die Heine im Munde führen, aber nicht in den Köpfen haben –, sondern die Nachtgedanken des Gedichtes drehen sich um die Mutter, die in Deutschland lebt und die der Dichter seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen hat.
Deutschland hat ewigen Bestand,
Es ist ein kerngesundes Land;
Mit seinen Eichen, seinen Linden,
Werd ich es immer wiederfinden.
Nach Deutschland lechzt’ ich nicht so sehr,
Wenn nicht die Mutter dorten wär;
Das Vaterland wird nie verderben,
Jedoch die alte Frau kann sterben.
Ob nun tatsächlich Deutschland. Ein Wintermärchen Heines bedeutendstes Werk ist, mag immerhin Geschmackssache sein und soll daher nicht diskutiert werden. Doch beginnen wir mit dem Lesen vorn:
Kriegszeiten sind Notzeiten, und weil Lessing sich durchschlagen musste, wurde er Schreiber eines Generals. Die eintönigen Feldlager aber ließen ihm die Freiheit zu schreiben – und zu spielen. [S. 22]
Das ist ja verständlich: Siebenjähriger Krieg, Lessing Sekretär – nicht Schreiber; das war ein gänzlich anderer Beruf – bei einem General, da wird es wohl ein Leben in Feldlagern gewesen sein. Nun war Bogislaw von Tauentzien zwar preußischer General, aber er war wesentlich auch Stadtkommandant von Breslau, und die Belagerung Breslaus durch Gideon Ernst von Laudon im Sommer 1760 war längst vorüber, als Lessing in Breslau erscheint. Von Feldlager kann also keine Rede sein. Nun könnte man über Lessings Breslauer Zeit die spannende Geschichte von dem Verdacht erzählen, dass Lessing vielleicht in die illegalen Münzgeschäfte des Generals von Tauentzien verwickelt war, aber dazu müsste man sich eben auskennen. Doch vielleicht hat Braun ja wenigstens einige Kenntnise des Werks:
Tellheim will die Verlobung lösen, um Minna nicht ins Unglück zu stürzen. Minna greift zur List: Sie sei enterbt, weil sie zu ihm halte. Der redliche Tellheim borgt sich Geld, löst den Verlobungsring aus, den sie verpfändet hat, will Minna beistehen und heiraten. [S. 24]
Wie belieben? Minna hat einen Verlobungsring verpfändet, den Tellheim dann auslöst? Da hätte ein Blick ins Buch auch nicht geschadet. Lesen wir weiter bei Goethe:
Überall und ständig wurde von nun an geflucht, ob im Alltag oder an den Höfen, und so auch am Weimarer Hof, dessen Herzog gerade erst achtzehn geworden war, als er Goethe zu sich einlud, weil er vom Götz begeistert war.
»In Weimar geht es erschrecklich zu. Der Herzog läuft mit Goethe wie ein wilder Bursche auf den Dörfern herum, er besauft sich und genießet brüderlich einerlei Mädchen mit ihm.« Um den jungen Herzog zu zerstreuen, veranstaltete Goethe Feste, Jagden, lagerte mit ihm im Wald, badete mit ihm in eiskalten Bächen und wurde dafür belohnt.
Das geklitterte Zitat über die Weimarer Zustände stammt aus einem Brief von Johann Heinrich Voß an seine Verlobte Ernestine Boie vom 14. Juli 1776. Voß sitzt zu diesem Zeitpunkt in Wandsbek und unterhält seine Briefpartnerin mit dem neuesten literarischen Klatsch. Er selbst weiß gar nichts über die Lage in Weimar, sondern reproduziert – wie die meisten anderen auch – nur die vom erzürnten Weimarer Adel gestreuten Gerüchte, die Goethe diskreditieren sollen. Verlässlicher ist da ein Wort Wielands über diese frühe Zeit Goethes in Weimar:
[…] Göthe, dessen große Kunst von jeher darin bestand, die Convenienzen mit Füssen zu treten, und doch dabei immer klug um sich zu sehn, wie weit ers gerade überal wagen dürfe. [zu Böttiger, 19. Januar 1797]
»Das sieht schon besser aus! Man sieht doch, wo und wie.« – Und Goethe ist also Weimarer Minister geworden zum Dank für die Feste und Jagden, die er organisiert hat? Wie schrieb Herzog Karl August von Sachsen-Weimar in dieser Sache an seinen ersten Minister Jakob Friedrich von Fritsch:
Sie fordern … Ihre Dienstentlassung, weil, sagen Sie, Sie nicht länger in einem Collegio, wovon der Dr. Goethe ein Mitglied ist, sitzen können. Dieser Grund sollte eigentlich nicht hinlänglich sein, Ihnen diesen Entschluß fassen zu machen. Wäre der Dr. Goethe ein Mann eines zweideutigen Charakters, würde ein jeder Ihren Entschluß billigen. Goethe aber ist rechtschaffen, von einem außerordentlich guten und fühlbaren Herzen. Nicht alleine ich, sondern einsichtsvolle Männer wünschen mir Glück, diesen Mann zu besitzen. Sein Kopf und Genie ist bekannt. Sie werden selbst einsehen, daß ein Mann wie dieser nicht würde die langweilige und mechanische Arbeit, in einem Landescollegio von unten auf zu dienen, aushalten. Einem Mann von Genie nicht an den Ort gebrauchen, wo er seine außerordentlichen Talente nicht gebrauchen kann, heißt, denselben mißbrauchen … Was das Urteil der Welt betrifft, welche mißbilligen würde, daß ich den Dr. Goethe in mein wichtigstes Collegium setzte, ohne daß er zuvor weder Amtmann, Professor, Kammer- oder Regierungsrat war, dieses verändert gar nichts. Die Welt urteilt nach Vorurteilen, ich aber und jeder, der seine Pflicht tun will, arbeitet nicht, um Ruhm u erlangen, sondern um sich vor Gott und seinen eignen Gewissen rechtfertigen zu können, und suchet auch ohne den Beifall der Welt zu handeln. [10. Mai 1776; Hervorhebung nicht im Original.]
Und so geht das fort und fort bei Braun: Goethe »entledigt« sich Schillers, indem er ihm eine Professur in Jena verschafft [S. 45] – wo Braun wohl meint, dass Jena liegt? »Mit Schillers Tod war das Jahrzehnt der Weimarer Klassik zu Ende. Der Bund Goethes und Schillers war schon weit früher zerbrochen.« [S. 54]
Feine Damen […] träumten sich fort zu den Inseln der Südsee, weil der ausgesetzte Matrose Alexander Selkirk von seinem einsamen Eiland gerettet worden war und Daniel Defoe sein Schicksal in Robinson Crusoe bekannt gemacht hatte. [S. 74]
Die Südsee-Begeisterung des 18. Jahrhunderts wurde also durch Defoes Roman ausgelöst und nicht durch die märchenhaften Berichte von den Reisen Bougainvilles und Cooks? Und der Vorwurf, Defoe habe im Robinson Crusoe in der Hauptsache aus Selkirks Tagebuch abgeschrieben, wird durch sein ehrwürdiges Alter auch nicht richtiger. Was Wunder, dass da E. T. A. Hoffmanns Märchen einmal mehr »Der goldene Topf« [S. 75] und Kleists Theaterstück »Der zerbrochene Krug« [S. 60] heißen. Ich will es gut sein lassen.
Über den titelgebenden Taugenichts stehen drei nichtssagende Sätze in dem Buch – und so ist auch der Rest! Peter Braun hat wenig Ahnung, wovon er schreibt. Alles ist viertelsgewusst und halbverdaut, und es ist ein Armutszeugnis für unseren Umgang mit Literatur, dass ein solcher Käse gedruckt und positiv besprochen werden kann.
Von einer Verbreitung dieses Buches ist dringend abzuraten!
Peter Braun: Von Taugenichts bis Steppenwolf. Eine etwas andere Literaturgeschichte. Bloomsburry Kinderbücher & Jugendbücher. Berlin: Berlin Verlag, 2006. Pappband, 224 Seiten. 14,90 €.
 Henry M. Broder ist zweifellos der bedeutendste deutschsprachige Polemiker unserer Zeit. Das Wort Polemiker hat seinen Ursprung im altgriechischen Wort für Krieg, πóλεμος. Ein Polemiker ist also ein Kriegstreiber, im besten Fall ein Krieger, jedenfalls jemand, dem es darum geht, einen Konflikt durchzukämpfen, nicht ihn beizulegen oder zu vermeiden. Danach muss man Broders Äußerungen bewerten, nicht entlang der Frage, ob er Recht hat, die Wahrheit vertritt, seine Meinung hilfreich ist oder ähnliches.
Henry M. Broder ist zweifellos der bedeutendste deutschsprachige Polemiker unserer Zeit. Das Wort Polemiker hat seinen Ursprung im altgriechischen Wort für Krieg, πóλεμος. Ein Polemiker ist also ein Kriegstreiber, im besten Fall ein Krieger, jedenfalls jemand, dem es darum geht, einen Konflikt durchzukämpfen, nicht ihn beizulegen oder zu vermeiden. Danach muss man Broders Äußerungen bewerten, nicht entlang der Frage, ob er Recht hat, die Wahrheit vertritt, seine Meinung hilfreich ist oder ähnliches.