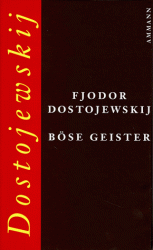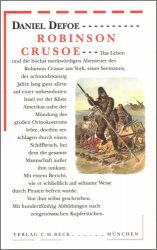Er war keineswegs dumm, und er war berechnend, aber hitzig und darüber hinaus unerfahren oder, besser gesagt, naiv, das heißt, er kannte sich weder in Menschen noch in der Gesellschaft aus.
Dieser vorletzte große Roman Dostojewskijs erschien bis Ende 1875 nach vergleichsweise kurzer Planung und Niederschrift (seit Februar 1874). Es handelt sich um Dostojewskijs unverstelltesten Beitrag zur Modeform des Entwicklungsromans, wie sie in Europa im 18. und 19. Jahrhundert im Schwange war. Er erfindet zu diesem Zweck einen jungen, naiven und impulsiven Ich-Erzähler, der aus einer nicht-ehelichen, aber langjährigen Beziehung des verarmten Adeligen Andrej Petrowitsch Werssilow und einer Bedienten stammt. Rechtlich gesehen ist der Erzähler Arkadij Makarowitsch der Sohn des Ehemanns seiner Mutter, Makar Iwanowitsch Dolgorukij, dem sein leiblicher Vater die Ehefrau Sofja abgekauft hatte, nachdem er sich leidenschaftlich in sie verliebte. Werssilow hat außerdem noch zwei Kinder aus einer früheren Ehe und eine weitere uneheliche Tochter Lisaweta, deren Mutter ebenfalls Sofja ist.
Die Haupthandlung des Romans setzt ein, als Arkadij nach dem Ende seiner schulischen Ausbildung in einem kleinen Internat auf Einladung seines Vaters nach Petersburg kommt. Er lebt für eine Weile im Haushalt seiner Mutter, in dem auch seine Schwester wohnt. Tägliche Gäste der Familie sind Werssilow und Tatjana Pawlowna Prutkowa, eine Art Faktotum Werssilows und ihm seit Jahrzehnten treu verbunden. Arkadij ist im Internat aufgrund seiner Herkunft als Außenseiter aufgewachsen, schikaniert und verspottet sowohl durch den Leiter der Schule als auch durch seine Mitschüler. Aus dieser Lage heraus hat er den Lebensplan entwickelt, durch den Erwerb eines großen Vermögens – sein Vorbild ist der Bankier Rothschild – Macht und soziale Unabhängigkeit zu erlangen. Außer diesem Ziel sucht er noch nach engem Kontakt zu seinem leiblichen Vater, von dessen Charakter er in Kindheit und Jugend eine stark idealisierte Vorstellung entwickelt hat.
Der verarmte Werssilow befindet sich zu Anfang der Handlung in einem Erbschafts-Prozess gegen das Fürstenhaus Sokolskij, der sehr bald zu seinen Gunsten entschieden wird und ihn von seinen permanenten Geldnöten befreit. Doch Arkadij besitzt aufgrund seiner früheren Moskauer Kontakte zwei „Dokumente“, die beide die Familie des Fürsten Sokolskij betreffen. Das erste ist eine Willenserklärung des Erblassers zu Ungunsten von Werssilows Anspruch; dies Dokument ist zwar juristisch nicht relevant, macht Werssilows Anspruch auf die Erbschaft aber moralisch anfechtbar. Arkadij überreicht Werssilow das Dokument, nachdem der Prozess entschieden ist, was dazu führt, dass Werssilow sofort auf die komplette, gerade erst gewonnene Erbschaft verzichtet. Dieses erste Dokument ist nur vorhanden, um Arkadij in seinem Wahn zu bestärken, dass es sich bei seinem Vater um ein gänzlich selbstloses Wesen von höchster moralischer Integrität handelt.
Um das zweite Dokument herum konstruiert Dostojewskij den eigentlichen Handlungsknoten des Romans, der allerdings erst im letzten Drittel die Handlung weitgehend bestimmen wird. Es handelt sich dabei um einen Brief der einzigen Tochter des Patriarchen Fürst Nikolaj Iwanowitsch Sokolskij, der verwitweten Generalin Katerina Nikolajewna Achmakowa, die in einer zurückliegenden Familienkrise bei einem Anwalt nachgefragt hatte, unter welchen Voraussetzungen es möglich sei, ihren Vater zu entmündigen, um so zu verhindern, dass er das Familienvermögen verschleudere. (Die unwahrscheinliche Vorgeschichte, warum Arkadij im Besitz dieses Briefes ist, kann man getrost vernachlässigen.) Katerina ist nun besorgt, dass ihr Vater sie enterben werde, wenn man ihm den Brief zuspielen würde. Dieses für den Romanschluss entscheidende Dokument hätte Arkadij vernünftigerweise auf Seite 250 verbrennen sollen und Autor und Leser so die ein wenig mühsamen letzten zwei Drittel des Romans ersparen können. Aber so geht es zu im Literaturbetrieb.
Wie bereits in „Böse Geister“ füllt Dostojewskij lange Passagen des Buches mit gesellschaftlichen Intrigen, vertraulichen Gesprächen, die zu überraschend unvertraulichen Handlungen führen, belauschten Aussprachen, ausschweifenden Reflexionen seines naiven und und auch sonst nicht übermäßig hellen Erzählers, Eifersuchtsanfällen, beleidigenden Briefen, ungewollten Schwangerschaften (zugegeben: es ist nur eine), unehelichen Kindern und so weiter und so fort, um dann im letzten Viertel des Romans auf eine vorgebliche Katastrophe zuzusteuern, die aber wenigstens diesmal knapp an der Erzeugung einer Leiche vorbeikommt.
Um die Katastrophe erzählerisch überhaupt als eine solche ausgeben zu können, ist es wesentlich, dass Dostojewskij sich eine literarisch inkompetente Erzählerfigur konstruiert, wie gleich zu Anfang des Romans wiederholt betont wird. Er benötigt zum einen einen Ich-Erzähler, den er ganze Tage von Hinz zu Kunz und zurück laufen lassen kann, wobei alles Entscheidende immer an Orten passiert, an denen sich der Erzähler gerade nicht befindet und von dem er dann um- und missverständlich unterrichtet werden muss. Zum anderen kann er die wirre, zugleich retardierende und dann immer wieder vorausgreifende Erzählweise, die das Ende des Romans bestimmt und die das einzige Mittel ist, mit dem er dem faden Plot zu einiger Spannung verhelfen kann, der Ungeschicklichkeit und Unerfahrenheit seines Erzählers in die Schuhe schieben.
Die Abläufe im Einzelnen nachzuerzählen, lohnt nicht. Der Leser kann aber beruhigt sein, dass sich am Ende alles zum Besten findet, Arkadij zur Vernunft kommt, wahrscheinlich ein Studium aufnehmen und zu einem nützlichen Idioten werden wird und alle anderen von ihren falschen Leidenschaften und unpassenden Heiratsplänen erlöst werden. Nur Russland kann nicht erlöst werden, weil es am rechten Glauben fehlt. Ganz am Ende hängt Dostojewskij einmal mehr ein Kapitel an, indem er erklären möchte, worauf es denn im Buch eigentlich ankommt, falls irgendwer das bei all dem Hin und Her übersehen haben sollte. Man hat es eben nicht leicht, wenn man Schmonzetten mit hochgeistigem Gehalt schreibt.
Sicherlich zu Recht der am wenigsten gelesene der fünf großen Romane.
Fjodor Dostojewskij: Ein grüner Junge. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Zürich: Ammann, 2006. Leinenband, Fadenheftung, 832 Seiten. Lieferbar als Fischer Taschenbuch für 15,– €.