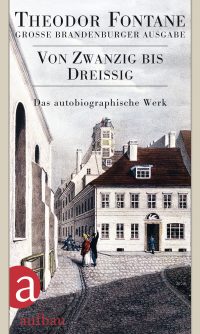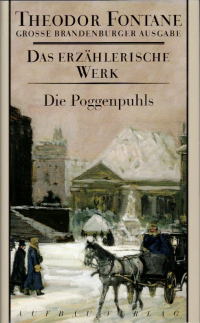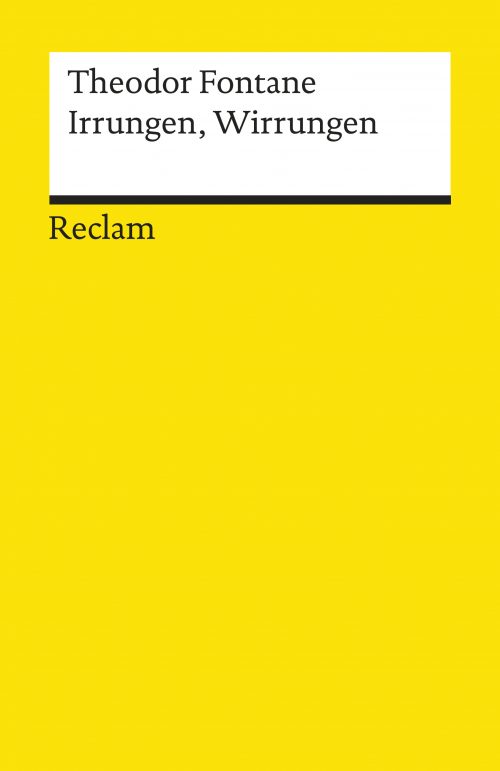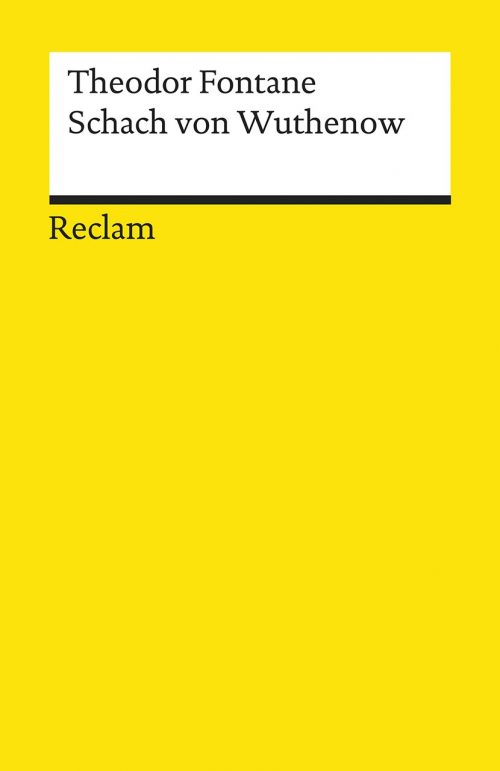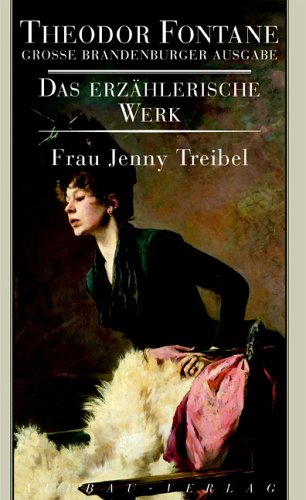Man hat wieder mal gelernt: aufpassen.
 Meine Lektüregeschichte zu »Effi Briest« ist lang und etwas kompliziert: Es ist der erste Roman Fontanes, den ich überhaupt gelesen habe – es muss 1981 gewesen sein – und ich war bei meiner erste Lektüre alles andere als angetan. Ich war damals – beeinflusst durch die intensive Lektüre Arno Schmidts und das langsame Erobern des »Ulysses« – ein sehr formaler Leser und hatte zugleich vom 19. Jahrhundert kaum mehr als eine Ahnung. Von daher erschien mir Fontane in der Hauptsache als ein laxer, unordentlicher Erzähler, der wenig um das Gerüst bzw. die Konstruktion seiner Erzählung gab. Während des Studium begriff ich dann langsam, um was es Fontane beim Erzählen dieses Romans gegangen war und lernte von den scheinbaren formalen Schwächen abzusehen.
Meine Lektüregeschichte zu »Effi Briest« ist lang und etwas kompliziert: Es ist der erste Roman Fontanes, den ich überhaupt gelesen habe – es muss 1981 gewesen sein – und ich war bei meiner erste Lektüre alles andere als angetan. Ich war damals – beeinflusst durch die intensive Lektüre Arno Schmidts und das langsame Erobern des »Ulysses« – ein sehr formaler Leser und hatte zugleich vom 19. Jahrhundert kaum mehr als eine Ahnung. Von daher erschien mir Fontane in der Hauptsache als ein laxer, unordentlicher Erzähler, der wenig um das Gerüst bzw. die Konstruktion seiner Erzählung gab. Während des Studium begriff ich dann langsam, um was es Fontane beim Erzählen dieses Romans gegangen war und lernte von den scheinbaren formalen Schwächen abzusehen.
Noch später dann verwendete ich »Effi Briest« als Gegenfolie zu Arno Schmidts sogenannter Etym-Theorie, indem ich spaßeshalber bei dem auf den ersten Blick unverdächtigen Fontane den bewussten Einsatz von Etym-Techniken nachwies, also Schmidts Rede von der »4. Instanz« konterkarierte. Und mit der Zeit stellte sich Effi Briest dann endlich auch in die Reihe der berühmten literarischen Frauengestalten des 19. Jahrhunderts ein.
Wenn man nach einer solchen Lektüregeschichte von fünf oder sechs Lektüren aus didaktischem Anlass erneut zu einem Buch zurückkehrt, besteht immer die Gefahr, dass man enttäuscht wird, dass die Faszination des Buches ausgeschöpft scheint. Doch auch diesmal hat sich Fontane als Erzähler bewährt.
Wie bekannt sein sollte, erzählt »Effi Briest« von Schicksal der zu Anfang 17-jährigen Titelheldin, die an einen mehr als doppelt so alten Mann, einen ehemaligen Bewerber um die Gunst ihrer Mutter verheiratet wird. Effi und Geert von Instetten passen nicht sehr gut zusammen oder, um nicht ungerecht zu sein, sie finden erst nach längerer Zeit die Ebene, auf der sie miteinander statt nebeneinander her leben können. In der Zwischenzeit aber hatte Effi aus Langeweile und Neugier eine kurze Affäre mit einem anderen Mann, die nicht nur gut sechs Jahre später ihre Ehe, sondern ihr gesamtes Leben ruinieren soll. Nach der Scheidung findet sich Effi gesellschaftlich isoliert, sogar zu ihrer eigenen Tochter findet sie keinen Kontakt mehr. Und, obwohl schuldig, endet ihr Leben tragisch: Zu unangemessen an ihren Fehltritt erscheint die Härte, mit der sie von ihrer Welt abgeschlossen wird. Selbst jenen, die ihr am nächsten standen, ihren Eltern und ihrem ehemaligen Ehemann, kommen Bedenken, aber auch ihnen fehlt eine wirkliche Alternative zu dem, was sie eben tun. Es tut ihnen leid, aber was soll man angesichts der Forderungen der Gesellschaft nach Moral und Gerechtigkeit anderes machen, als der Ungerechtigkeit nachgeben?
Daher müsste natürlich einmal gründlich über die Menschlichkeit der Fontaneschen Erzählungen geredet werden: Trotz der unbestreitbaren Ungerechtigkeit, die sich in Effis Schicksal manifestiert, ist keine der Hauptfiguren (vom Apotheker Gieshübler vielleicht einmal abgesehen) ganz schuldig oder ganz und gar unschuldig. Natürlich hätten sich sowohl Instetten als auch Effis Eltern anders verhalten können und sollen, als sie es getan haben, aber Fontane bleibt misstrauisch gegenüber solchen moralischen Anforderungen an das Individuum. Auch nützt es wenig, Effi oder Crampas anzuklagen; die eine, weil sie keine wirkliche Chance hat, sich der Verführung zu erwehren (I can resist everything except temptation.), den anderen, weil er eben auch nur seiner Natur folgt und sich jederzeit über die möglichen Folgen im Klaren ist, die er resignierend in Kauf nimmt. Und so geschieht hier das Böse ohne die Bösen (den Bösen waren wir schon in Goethes Faust losgeworden). Niemand, den man nicht verstehen könnte, der nicht seine Gründe hätte, sich erst einmal um sich und erst später um die Folgen für die anderen zu kümmern. Es gehört zu den besten bei Fontane zu findenden Einsichten, wie ganz obenhin, gedankenlos und zugleich unausweichlich die Grausamkeit der menschlichen Gesellschaft entsteht.
Darüber hinaus ist mir bei der jetzigen Lektüre deutlicher als zuvor die motivische Dichte des Romans aufgefallen: Überall finden sich Ehebrühe oder außereheliche sexuelle Beziehungen, ständig wird der Leser daran erinnert, welche eine dünne Lackschicht die offizielle Moral bildet über einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die von Sexualität in den unterschiedlichsten Formen umgetrieben wird.
Und wirklich, Briest hielt mit besonderer Zähigkeit eine ganze Zeit lang an dieser Anschauung fest. Erst nach der zweiten Probe, wo das »Käthchen«, schon halb im Kostüm, ein sehr eng anliegendes Sammetmieder trug, ließ er sich – der es auch sonst nicht an Huldigungen gegen Hulda fehlen ließ – zu der Bemerkung hinreißen, »das Käthchen liege sehr gut da,« welche Wendung einer Waffenstreckung ziemlich gleich kam oder doch zu solcher hinüber leitete.
Es ist erstaunlich, wie subtil und dennoch nicht weniger deutlich Fontane die zentrale Bedeutung sexueller Verhältnisse zu thematisieren vermag, ohne dabei für die Leserinnen der Familienblätter, für die er in erster Linie schrieb, anstößig zu werden. Zugleich macht er klar, dass ihm die unverstelltere Behandlung des Themas in der zeitgenössischen Literatur durchaus bekannt ist:
… die Zwicker sei reizend, etwas frei, wahrscheinlich sogar mit einer Vergangenheit, aber höchst amüsant, und man könne viel, sehr viel von ihr lernen; nie habe sie sich, trotz ihrer fünfundzwanzig, so als Kind gefühlt, wie nach der Bekanntschaft mit dieser Dame. Dabei sei sie so belesen, auch in fremder Literatur, und als sie, Effi, beispielsweise neulich von Nana gesprochen und dabei gefragt habe, »ob es denn wirklich so schrecklich sei,« habe die Zwicker geantwortet: »Ach, meine liebe Baronin, was heißt schrecklich? Da gibt es noch ganz anderes.« »Sie schien mich auch«, so schloß Effi ihren Brief, »mit diesem ›anderen‹ bekannt machen zu wollen. Ich habe es aber abgelehnt, weil ich weiß, daß Du die Unsitte unserer Zeit aus diesem und ähnlichem herleitest, und wohl mit Recht. Leicht ist es mir aber nicht geworden. Dazu kommt noch, daß Ems in einem Kessel liegt. Wir leiden hier außerordentlich unter der Hitze.«
Ein durch und durch wundervoller Roman, der auch in sieben Lektüren nicht auszulesen ist. Ich bin schon jetzt gespannt, wann ich wieder bei ihm vorbeikommen werde.
Theodor Fontane: Effi Briest. Große Brandenburger Ausgabe. Das erzählerische Werk, Bd. 15. Berlin: Aufbau Verlag, 1998. Leinenband, Fadenheftung, Lesebändchen, 534 Seiten. 25,– €.