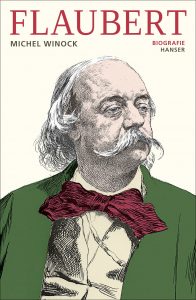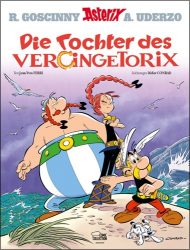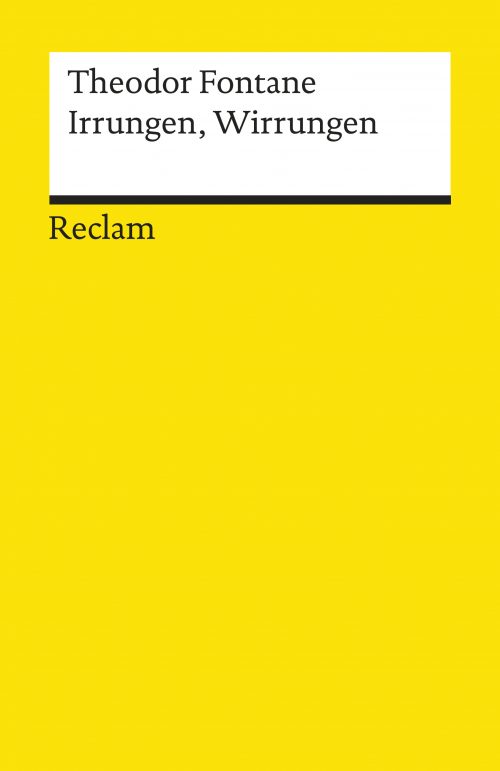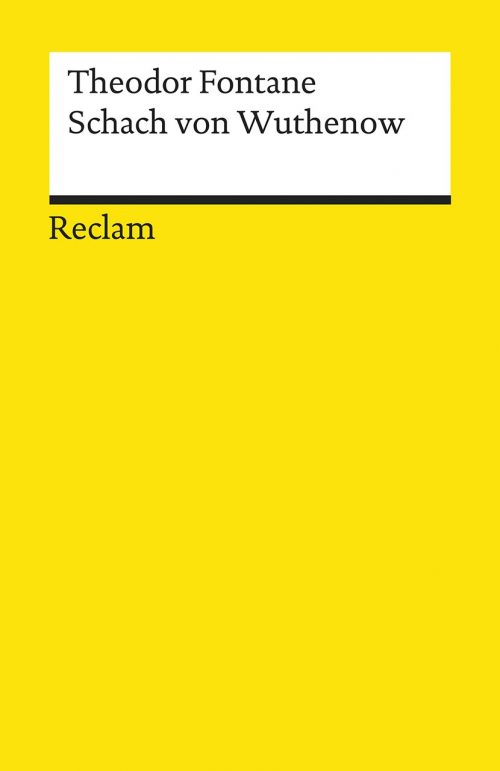Die Worte schienen ihm durchaus nicht zuzuströmen, für einen, dessen bürgerlicher Beruf das Schreiben ist, kam er jämmerlich langsam von der Stelle, und wer ihn sah, mußte zu der Anschauung gelangen, daß ein Schriftsteller ein Mann ist, dem das Schreiben schwerer fällt als allen anderen Leuten.
Thomas Mann
Der Hanser Verlag hat im Vorfeld des 200. Geburtstages von Gustave Flaubert die in Frankreich hochgelobte Biographie des Historikers Michel Winock aus dem Jahr 2013 ins Deutsche übertragen lassen. Winock ist zweifellos das, was man einen Fan nennen könnte, aber sein Buch bewahrt dennoch eine weitreichende Obejktivität, nicht nur, was Flaubert selbst angeht, sondern auch die vorhergehende Literatur über ihn betreffend. Es kommt dem Buch sicherlich sehr zugute, dass Winock kein Literaturwissenschaftler ist und so bei einigen der umstrittenen Themen der Flaubert-Forschung die gegensätzlichen Auffassungen schlicht einander gegenüberstellen und dann auf sich beruhen lassen kann. Ebenso ist seine souveräne Position zu Sartres überbordener Interpretation Flauberts erfrischend.
Gustave Flaubert ist ein erstaunlicher Autor: Sein Werk besteht im Wesentlichen aus drei schwierigen Romanen und drei Erzählungen, ergänzt durch das Fragment eines vierten Romans, der bis heute Leser eher irritiert als fasziniert. Zu seinen Lebzeiten scharfer Kritik ausgesetzt, stieg er im 20. Jahrhundert zu einem der Gründungsväter der modernen und Klassiker der französischen Literatur auf; sein Einfluss auf Schriftsteller seiner und nachfolgender Generationen kann kaum überschätzt werden.
Im Vergleich mit seine Kollegen hat Flaubert auf der einen Seite ein weitgehend einsiedlerisches Leben in der Provinz geführt, das der Arbeit an seinen Romane gewidmet war, die langsam und unter den größten stilistischen Skrupeln entstanden sind. Er musste stets seine juvenile Neigung zum Romantizismus und zum sprachlichen Überschwang im Zaum halten, und sein Glaube, dass ein Erzähler sich jedes Urteils über seine Figuren und deren Handlungen enthalten müsse, hat zu seinem bemerkenswert kühlen und distanzierten Stil geführt. Seine Stoffe entstammen einerseits unmittelbar seiner Gegenwart, andererseits einer phantastisch imaginierten Antike, in die er alle seine andern Orts unterdrückten Leidenschaften und schwarzen Gedanken projizierte.
Auf der anderen Seite war er ein aktiver Promoter und Regisseur der Theaterstücke seines Kollegen Louis Bouilhet, der ohne die Freundschaft mit Flaubert heute vollständig vergessen wäre, ein unermüdlicher Briefschreiber, der auf diese Weise durchaus intensive Freundschaften auch zu bedeutenden Kolleginnen und Kollegen (Georg Sand, Iwan Turgenew) unterhielt. Er hat eine Wohnung in Paris unterhalten und gehörte zum Künstlerkreis um die Brüder Goncourt, die in ihren Tagebüchern einige der schönsten und gehässigsten Porträts seiner Persönlichkeit geliefert haben. Er hat Nordafrika, Ägypten, den Nahen Osten und Istanbul bereist und war regelmäßig in England, wahrscheinlich um eine heimliche Geliebte zu treffen – tatsächlich so heimlich, dass auch heute noch nur darüber spekuliert werden kann. Zu diesen persönlichen Widersprüchen treten Flauberts soziologische und politische Vorurteile hinzu, die alles andere als ein einheitliches Weltbild ergeben und zu denen auch noch seine allgemeine Misanthropie und seine tiefe Verachtung der menschlichen, besonders aber der bürgerlichen Dummheit hinzutreten. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Winocks resümierendes, letztes Kapitel sich weitgehend in einer Auflistung dieser Gegensätze erschöpft. Flaubert war alles andere als eine gerundete und in sich geschlossene Persönlichkeit, und so erscheint er auch in Winocks Erzählung.
Was die sachliche Ebene angeht ist das Buch, soweit ich sehe, bis auf eine Winzigkeit fehlerfrei. In der ersten Hälfte habe ich als Leser ein wenig zu oft gedacht, das hätte ich so auch schon bei Maxime Du Campe oder Guy de Maupassant gelesen, aber das muss einen anderen Leser durchaus nicht stören. Die Interpretationen der Werke sind durchweg gut bis herausragend – wer sich einen Eindruck von der Qualität des Buches verschaffen will, lese die der Education sentimental gewidmeten Kapitel XVIII bis XX. Bei der Analyse von Leben und Werk wird nebenbei eine kurze Geschichte Frankreichs von der Juli-Revolution bis in die frühen Jahre der Dritten Republik hinein mitgeliefert. Zudem finden sich knappe biographische Portraits etwa von Louis Bouilhet, George Sand oder Maxime Du Camp.
Alles in allem eine runde, gut lesbare und ausgewogene Biographie, nach deren Lektüre man sich als ausreichend informiert und gerüstet für die Lektüre der Werke Flauberts fühlen darf.
Michel Winock: Flaubert. Aus dem Französischen von Horst Brühmann und Petra Willim. München: Hanser, 2021. Pappband, Lesebändchen, 655 Seiten. 36,– €