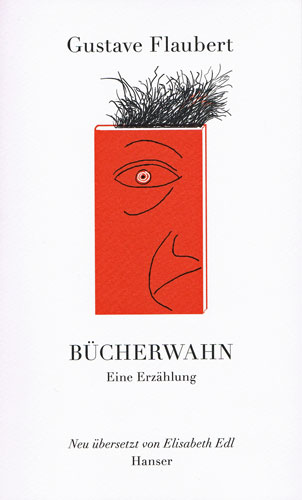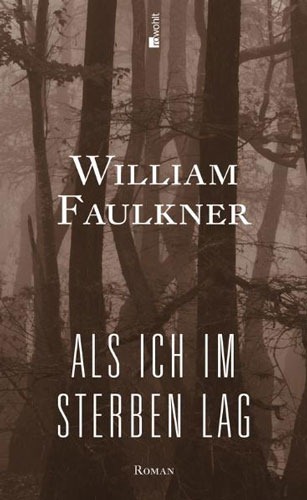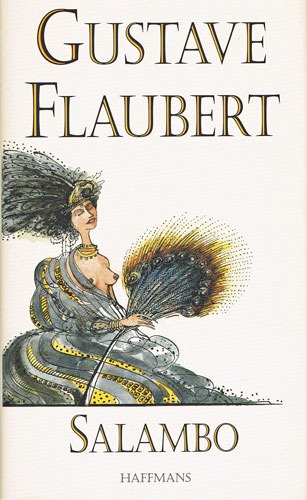Das «Mittelalter» ist ein typisch europäisches, genauer sogar ein westliches Phänomen. Weder die Hochzivilisationen Indiens oder des Fernen Ostens, noch das christliche Byzanz oder die Länder des Islam kennen ein vergleichbares Wahrnehmen einer abgesteckten, als minderwertig verworfenen und auf der Suche nach den Quellen der eigenen Kultur geradezu auszuschabenden «aetas media».
 Einem gut 550-seitigen Text, der einen Zeitraum von 1.000 Jahren verhandelt, auch nur als Leser, geschweige denn als Rezensent gerecht zu werden, ist kaum möglich. Johannes Fried ist die Problematik seines Versuchs, das gesamteuropäisches Phänomen des Mittelalters in einem Überblick zu erfassen, durchaus bewusst; entsprechend defensiv ist auch das Vorwort gehalten. Leider ist aber wenigstens mir bei der Lektüre nicht klar geworden, wen Fried sich als Leser für dieses Buch vorgestellt hat und was genau er ihm vermitteln wollte.
Einem gut 550-seitigen Text, der einen Zeitraum von 1.000 Jahren verhandelt, auch nur als Leser, geschweige denn als Rezensent gerecht zu werden, ist kaum möglich. Johannes Fried ist die Problematik seines Versuchs, das gesamteuropäisches Phänomen des Mittelalters in einem Überblick zu erfassen, durchaus bewusst; entsprechend defensiv ist auch das Vorwort gehalten. Leider ist aber wenigstens mir bei der Lektüre nicht klar geworden, wen Fried sich als Leser für dieses Buch vorgestellt hat und was genau er ihm vermitteln wollte.
Ein Buch, das kaum eine halbe Seite hat, um ein Jahr Geschichte abzuhandeln, und dabei nicht nur die äußerlichen historischen Ereignisse vermitteln, sondern auch über Gesellschaft, Kunst und Kultur sprechen will, muss zwangsläufig bei allem an der Oberfläche bleiben. Wie wenig befriedigend das ist, zeigt sich hauptsächlich an zwei Phänomenen: Beim Abhaspeln der historischen Chronologie stellt sich zum einen nur ganz selten tatsächlich ein geschlossenes Bild ein, das dem Leser das Nach- und Miteinander der Ereignisse und ihre Bedingtheit deutlich macht. Wenn man sich selbst mit einem Abschnitt der Geschichte etwas intensiver auseinandergesetzt hat, kann man Fried durchaus folgen, aber dort, wo einem selbst die Zusammenhänge eher vage vorschweben, hilft seine Darstellung oft kaum weiter. Das gilt aber durchaus nicht für alle Abschnitte: Den Einfall der Mongolen nach Europa etwa und seine Folgen weiß er kompakt und bildhaft zu schildern, was den Mangel an Geschlossenheit an anderen Stellen nur um so schärfer hervortreten lässt.
Zum anderen tritt an Stellen, an denen man selbst halb ein Kenner ist, häufig ein ratloses Schulterzucken auf. Wenn es etwa über die Vier-Ursachen-Lehre des Aristoteles heißt
Die Natur zu erforschen bedeutete, die Ursachen der Bewegung zu erfassen, deren vier zu unterscheiden waren: die causa materialis, die causa formalis, die causa efficiens und die causa finalis, Materie, Form, Beweger und Zweck oder Ziel. (S. 360)
so kann das für eine der mittelalterlichen Aristoteles-Interpretationen durchaus richtig sein (Fried verrät uns nicht, welche dafür in Frage käme), aber für Aristoteles selbst ist die auslegende Übersetzung der causa efficiens als Beweger zumindest ungeschickt, wenn nicht sogar irreführend, denn der (unbewegte) Beweger ist bei Aristoteles als causa finalis gedacht. Auch wäre es wahrscheinlich geschickter, statt von der mit neuzeitlichen, physikalischen Ideen assoziierten Materie vom Stoff zu sprechen. Und da der Leser über die Vier-Ursachen-Lehre nicht mehr als das oben Zitierte erfährt, entsteht bestenfalls ein schiefes Bild der ganzen Angelegenheit.
Auch sprachlich ist das Buch nicht immer auf der Höhe:
Der Hundertjährige Krieg warf England endgültig auf die Insel zurück; Frankreichs Wiedergeburt konnte es nicht verhindern. (S. 517)
Zumindest ich habe beim ersten Lesen das es nicht auf England, sondern auf den Vorgang des Zurückwerfens bezogen. Ähnliche Holprigkeiten finden sich öfter.
Aber es mag auch einfach nur sein, dass ich nur der falsche Leser für das Buch bin und ein anderer mit all dem bestens zurecht kommt. Mir jedenfalls scheint es nicht ganz und gar gelungen zu sein, wenn ich auch dem Autor gern zugestehe, dass er sich angesichts der kaum zu leistenden Aufgabe einer Gesamtdarstellung des Mittelalters in nur einem einzigen Band sehr beachtlich aus der Affäre gezogen hat. Man kann mit einem solchen Projekt auch ganz allerliebst kompletten Schiffbruch erleiden.
Wie so oft ein Buch, das seinesgleichen sucht und von dem man sich dennoch leicht enttäuscht verabschiedet.
Johannes Fried: Das Mittelalter. Geschichte und Kultur. Jubiläumsedition. München: C. H. Beck, 2013. Broschur (22 × 15 cm), 606 Seiten. 16,– €.