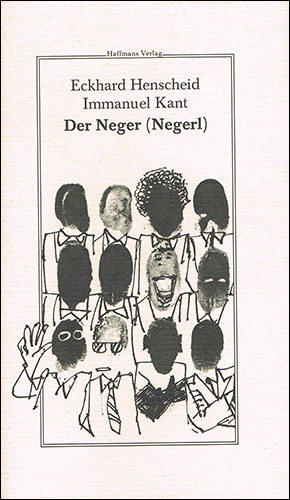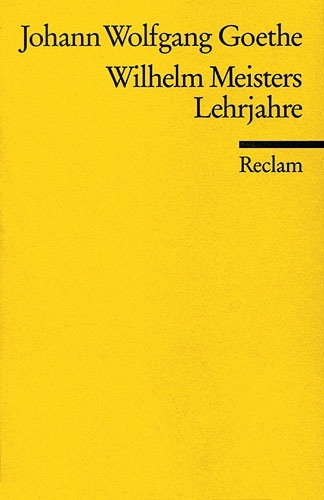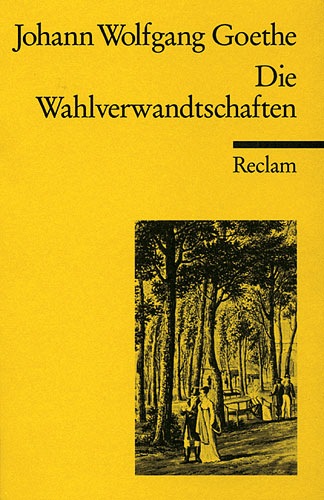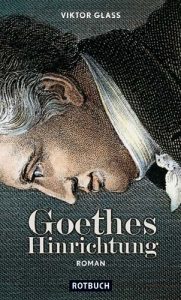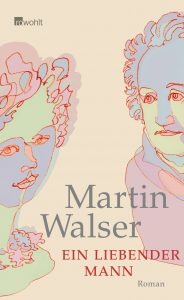Sigrid Damms neues, nettes und weithin belangloses Lesebuch erzählt in dem weitgehend beliebigen Stil, der für Sigrid Damms Bücher inzwischen typisch geworden ist, Goethes letzte Lebensmonate. Den Rahmen bildet, abgesehen vom letzten Kapitel, das von Goethes Sterben berichtet, die letzte mehrtägige Abwesenheit Goethes von Weimar im August 1831. Um den Weimarer Feierlichkeiten zu seinem 82. Geburtstag zu entgehen, macht sich Goethe mit seinen beiden Enkeln Walther und Wolfgang auf die Reise ins nahegelegene Ilmenau, besucht die Jagdhütte auf dem Kickelhahn noch einmal, macht einige Ausflüge und kehrt am 31. August wieder nach Weimar zurück.
In diesen Rahmen passt Sigrid Damm zahlreiche Reflexion zu diversen anderen Themen und Zeiten in Goethes Leben ein: Seine Bemühungen um den Ilmenauer Bergbau, seine letzte Liebe zu Ulrike von Levetzow, das Gedicht Über allen Gipfeln ist Ruh, der Tod seines Sohnes August in Rom, Goethes Glaube an das Fortbestehen des Geistes nach dem Tode, Gestaltung und Inhalt des zweiten Teils des Faust und Vulkanismus contra Neptunismus dürften die wichtigsten sein. Alles wird locker aneinander gereiht und ist mit dem Hauptthema des Buches – als das sich schließlich Goethes Tod, seine „letzte Reise“, erweisen wird – mehr oder weniger eng und sinnfällig verknüpft.
Das meiste gerät dabei zur Nacherzählung der gerade für den Text benutzten Quellen, wobei sich die Redundanzen im Vergleich zu Christiane und Goethe in Grenzen halten, aber auch nicht vermieden werden. Anderes wird einfach daherzitiert und erweckt weniger den Eindruck einer Erzählung als den eines ausgekippten Zettelkastens, so etwa die Geschichte Friedrich Augusts von Fritschs (S. 246 f.).
Die lockere Struktur mag jenen entgegenkommen, die ein eher empathisches als reflektives Verhältnis zu Goethes Werk und Leben pflegen. Nicht umsonst fallen Fragen wie „Stellt nicht diese Dichtung die höhere Wahrheit dar?“ (S. 200), selbstverständlich ohne eine Antwort zu erfahren; die hinweisende Geste verbindet all jene, die gleichen Geistes sind. An anderen Stellen spricht Damm davon, wie „berührt“ oder „angerührt“ sie ist, ohne dass der Text auch nur einen einzigen Schritt über die Emotion hinausgelangt. An einer Stelle bleibt Damms Lektüre der Quelle gar so oberflächlich, dass eine echte Pointe resultiert. Sie zitiert einen Brief Goethes an Amalie von Levetzow, die Mutter Ulrikes:
Dabey, hoff ich, wird sie nicht abläugnen, daß es eine hübsche Sache sey, geliebt zu werden, wenn auch der Freund manchmal unbequem fallen möchte.
Und nun folgen im typischen Damm-Stil einige Fragen, die die Interpretation nicht leiten, sondern ersetzen:
Und der Schluß des Satzes, worauf deutet er? Wohl nicht auf den Troubadour, der vor den Augen der Angebeteten auf den Knien liegt, sondern auf den alten Mann, der ausrutscht und sich nicht wieder aufzurichten vermag? (S. 207)
Damm liest die Wendung „unbequem fallen“ tatsächlich im Sinne von „stürzen“, nicht als „lästig fallen“, wie sie offensichtlich gemeint ist.
An wieder anderer Stelle wird vergessen, was nur wenige Seiten zuvor berichtet worden ist, so wenn auf S. 285 ein Brief des Enkels Wolfgang zitiert wird, der die geplante Rückreise nach Weimar über Schwarzburg und Rudolstadt ankündigt, und Enttäuschung der Enkel darüber vermutet wird, dass man nun doch den gleichen Weg zurück nehmen wird, den man gekommen ist. Auf Seite 317 wird dann spekuliert, dass man diesmal in Stadtilm ein „dem hohen Gast angemessenes Mittagsmahl“ vorgesetzt haben könnte:
Bei der Herfahrt hat man die Bestellung aufgegeben. Da die Gasthofrechnung nicht überliefert ist und auch Krauses Tagebuch keine Auskunft gibt, können wir es nur vermuten.
Ja, vermuten kann man vieles. Warum man allerdings ein Mittagsmahl bestellen soll, wenn man weder den Rückreisetag kennt noch plant, überhaupt auf der Rückfahrt wieder vorbeizukommen, können wir nicht einmal vermuten – nur Sigrid Damm könnte.
Insgesamt nur ein weiteres oberflächliches, unordentlich erzähltes Buch von Sigrid Damm. Inzwischen macht es keinen Unterschied mehr. Für diejenigen, die sich als Goethe-Freunde empfinden und jene, die von Goethe wenig wissen und sich einen ersten, flüchtigen Eindruck verschaffen wollen, sicherlich kein schlechtes Lesebuch. Für den ernsthaft an Goethe und seiner Zeit Interessierten gänzlich unerheblich.
Sigrid Damm: Goethes letzte Reise. Frankfurt/M: Insel Verlag, 2007. Pappband, 364 Seiten. 19,80 €.