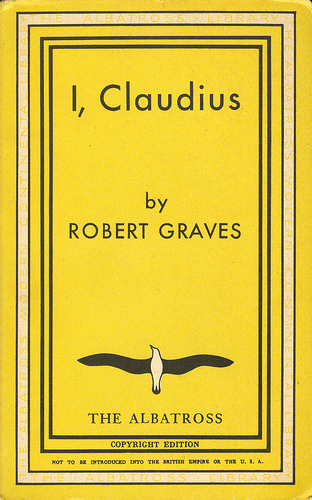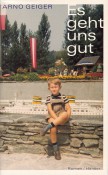Es ist ein merkwürdiger Torso, den dtv im November 2003 mit seiner neuen, anspruchsvollen Übersetzung des Gibbon dem deutschen Publikum vorgelegt hat: Mit Michael Walter übersetzt einer der profiliertesten und besten Kenner des Englischen des 18. Jahrhunderts das bedeutende Geschichtswerk der vorromantischen Epoche neu und – lässt es zugleich bleiben. Edward Gibbons »Decline and Fall of the Roman Empire« ist im englischsprachigen Raum wahrscheinlich die bis heute meistgelesene umfangreiche geschichtliche Darstellung überhaupt. Das Buch sorgte aufgrund seines distanzierten Blicks auf das frühe Christentum im Römischen Reich schon während seines Erscheinens europaweit für Aufregung, und die ersten Bände wurden bereits vor Abschluss des Gesamtwerks erstmals ins Deutsche übersetzt. Seitdem hat Gibbons monumentale Darstellung immer neue Auflagen sowohl des Gesamtwerks als auch diverser Ausgliederungen erlebt.
Es ist ein merkwürdiger Torso, den dtv im November 2003 mit seiner neuen, anspruchsvollen Übersetzung des Gibbon dem deutschen Publikum vorgelegt hat: Mit Michael Walter übersetzt einer der profiliertesten und besten Kenner des Englischen des 18. Jahrhunderts das bedeutende Geschichtswerk der vorromantischen Epoche neu und – lässt es zugleich bleiben. Edward Gibbons »Decline and Fall of the Roman Empire« ist im englischsprachigen Raum wahrscheinlich die bis heute meistgelesene umfangreiche geschichtliche Darstellung überhaupt. Das Buch sorgte aufgrund seines distanzierten Blicks auf das frühe Christentum im Römischen Reich schon während seines Erscheinens europaweit für Aufregung, und die ersten Bände wurden bereits vor Abschluss des Gesamtwerks erstmals ins Deutsche übersetzt. Seitdem hat Gibbons monumentale Darstellung immer neue Auflagen sowohl des Gesamtwerks als auch diverser Ausgliederungen erlebt.
Der Text der neuen dtv-Ausgabe umfasst die ersten drei der insgesamt sechs Bände des Originals und endet mit dem Untergang des Weströmischen Reiches. Die nachfolgenden drei Bände, die die Geschichte Ostroms, sprich Byzanz’ bzw. Konstantinopels bis zur Eroberung der Stadt im Jahr 1453 enthalten, fehlen kommentarlos. Es findet sich weder eine herausgeberische Reflexion zu dieser Halbierung noch etwa die Ankündigung einer Fortsetzung oder Vervollständigung der vorgelegten Ausgabe.
Eine weitere Merkwürdigkeit tritt hinzu: Mit Michael Walter zeichnet, wie bereits gesagt, ein profilierter und stilistisch brillanter Übersetzer für den deutschen Text dieser Teil-Ausgabe verantwortlich, wenigstens für einen Teil des Teils. Denn Walter scheint seine Übersetzung nach dem Kapitel XXXII abgebrochen zu haben; alle Fußnoten, die Kapitel XXXIII bis XXXVIII und die den dritten Band des Gesamtwerks abschließenden »General Observations on the Fall of the Roman Empire in the West« sind von Walter Kumpmann übersetzt. Auch diesen Umstand thematisiert die Ausgabe so wenig wie möglich, geschweige denn, dass sie ihn erklärt.
 Als sei dies alles nicht merkwürdig genug, hat sich der Verlag der Digitalen Bibliothek, die normalerweise für umfängliche und möglichst vollständige Ausgaben steht, entschlossen, den Torso des dtv-Verlages unverändert (inklusive der Druckfehler) und ohne Ergänzungen auf einer CD-ROM zu publizieren. Dabei ist das mit den »Ergänzungen« allerdings auch leichter hingeschrieben als getan, denn die letzte einigermaßen vollständige Ausgabe des »Verfalls und Untergangs« stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts und dürfte vermutlich in einem auffälligen stilistischen Kontrast zu Walters Übersetzung stehen. Und die Beigabe des englischen Textes hätte die digitale Ausgabe nicht nur im Preis bedeutend teurer (und damit unverkäuflicher) gemacht, sondern den fragmentarischen Charakter dieser deutschen Ausgabe entweder verdoppelt oder überaus auffällig gemacht, je nachdem ob man nur drei oder alle sechs Bände im Englischen beigegeben hätte.
Als sei dies alles nicht merkwürdig genug, hat sich der Verlag der Digitalen Bibliothek, die normalerweise für umfängliche und möglichst vollständige Ausgaben steht, entschlossen, den Torso des dtv-Verlages unverändert (inklusive der Druckfehler) und ohne Ergänzungen auf einer CD-ROM zu publizieren. Dabei ist das mit den »Ergänzungen« allerdings auch leichter hingeschrieben als getan, denn die letzte einigermaßen vollständige Ausgabe des »Verfalls und Untergangs« stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts und dürfte vermutlich in einem auffälligen stilistischen Kontrast zu Walters Übersetzung stehen. Und die Beigabe des englischen Textes hätte die digitale Ausgabe nicht nur im Preis bedeutend teurer (und damit unverkäuflicher) gemacht, sondern den fragmentarischen Charakter dieser deutschen Ausgabe entweder verdoppelt oder überaus auffällig gemacht, je nachdem ob man nur drei oder alle sechs Bände im Englischen beigegeben hätte.
Sieht man von all diesen Halbheiten einmal ab, so präsentieren die beiden Ausgaben den seit ungefähr 200 Jahren vollständigsten und sicherlich lesbarsten Gibbon in deutscher Sprache. Für den heutigen Leser ist weniger die sachliche Richtigkeit der Darstellung Gibbons en détail entscheidend als vielmehr sein erzählender Stil, sein origineller Blick und sein Humor, denn dies sind die Eigenschaften, die den konstanten Erfolg des Buches über die Jahrzehnte hinweg garantiert haben.
Mit dem ehrwürdigen Prokonsul [Gordian] wurde zugleich sein Sohn, der ihn als Legat nach Africa begleitet hatte, zum Kaiser erklärt. Er war weniger sittenstreng, doch im Wesen ebenso liebenswürdig wie sein Vater. Zweiundzwanzig anerkannte Konkubinen und eine zweiundsechzigtausend Bände umfassende Bibliothek bezeugten die Vielfalt seiner Neigungen, und wie seine Hervorbringungen beweisen, dienten beide Sammlungen mehr dem Gebrauch als zur Prahlerei.
Die Ausgabe wird ergänzt durch zahlreiche Bibliographien, ein Personenregister und einen hervorragenden, knapp 100 Seiten langen Essay von Wilfried Nippel über Gibbon. Zwischen der gedruckten und der digitalen Ausgabe besteht ein Preisunterschied von 48,– € und dies könnte ein Vermarktungsmodell für die Zukunft darstellen: Umfangreiche Werke, die im Taschebuch erscheinen, werden nach einigen Jahren als digitale Ausgaben auf den Markt gebracht, die so zum Taschenbuch des Taschenbuchs werden könnten. Die üblichen Vorteile einer digitalen Ausgabe mit der bewährten Software der Digitalen Bibliothek mit Volltextsuche, Lesezeichen, Notizen und Markierung verstehen sich als Dreingaben inzwischen ja beinahe von selbst.
Edward Gibbon: Verfall und Untergang des römischen Imperiums. Bis zum Ende des Reiches im Westen. Aus dem Englischen von Michael Walter und Walter Kumpmann. 6 Bde. dtv, 2003. Kartoniert, 2296 Seiten. 78,– €.
Edward Gibbon: Verfall und Untergang des römischen Imperiums. Bis zum Ende des Reiches im Westen. Aus dem Englischen von Michael Walter und Walter Kumpmann. Digitale Bibliothek Band 161. Berlin: Directmedia Publishing, 2007. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 32 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000 oder XP) oder MAC ab MacOS 10.3; 128 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. Empfohlener Verkaufspreis: 30,– €.
Eine Software für Linux-User kann von der Homepage der Digitalen Bibliothek heruntergeladen werden.