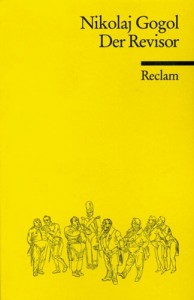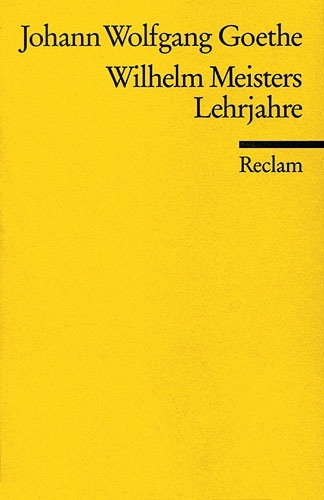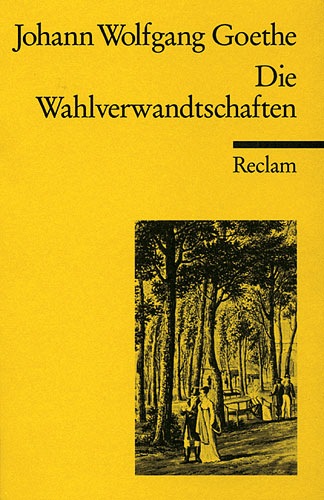[…] eine der größten Komödien: Gogols ›Revisor‹.
Friedrich Dürrenmatt
»Der Revisor« wird in der Kritik nahezu durchgehend als eine herausragende Komödie bewertet: Ob Kollegen (s. o.), ob Kritiker (etwa der unvermeidliche Marcel Reich-Ranicki), alle machen ihren Diener vor diesem Theaterstück. Das könnte den Zuschauer einer der immer noch zahlreichen Inszenierungen wundern, denn auf den ersten Blick enthält die Komödie wenig wirklich überraschendes und unterscheidet sich nur unwesentlich von der allgemeinen Durchschnittsware:
Die Handlung der Revisors ist ebensowenig der Rede wert wie die der übrigen Bücher Gogols. […] Darüber hinaus ist im Falle des Stücks die Anlage Gemeinbesitz aller Dramatiker: ein amüsantes Quidproquo bis zum letzten Tropfen auszuquetschen. [Vladimir Nabokov: Nikolaj Gogol, S. 55]
Diese Handlung ist rasch erzählt: In einer russischen Provinzstadt ist die korrupte Exekutive beunruhigt über die mögliche Ankunft eines inkognito reisenden Revisors, dessen Ankunft dem Stadthauptmann durch einen vertraulichen Brief angezeigt wurde. Wie der Zufall es will, wird der sich auf der Durchreise befindliche kleine Beamte Iwan Alexandowitsch Chlestakow, der beim Kartenspiel all sein Geld verloren hat, irrtümlich für den angekündigten Revisor gehalten und daher von den Honoratioren der Stadt entsprechend hofiert. Er nimmt gern alle Gefälligkeiten und Bestechungsgelder an, verführt die Tochter des Stadthauptmanns und verschwindet gerade noch rechtzeitig, bevor als Paukenschlag am Ende des Stücks die Ankunft des tatsächlichen Revisors angekündigt wird.
Innerhalb dieses Rahmens gibt es das übliche Abhaspeln komischer Situationen: vom anfänglichen Aneinandervorbeireden über die zu erwartenden doppelbödigen Dialoge und Situationen bis zur abschließenden Auflösung des Irrtums. Seine außergewöhnliche Wirkung scheint das Stück aber auf drei Ebenen entfaltet zu haben: auf einer satirischen, einer parodistischen und einer dramaturgischen.
Von der ersten Aufführung an ist das Stück als eine Satire auf die Verhältnisse der russischen Provinz verstanden worden, auch wenn sich sein Autor immer wieder gegen diese Deutung ausgesprochen hat. Angesichts der durchgehend negativen Zeichnung der Honoratioren der Provinzstadt als dumme und korrupte Egoisten ist es kein kleines Wunder, dass das Stück überhaupt aufgeführt werden konnte und nicht der Zensur zum Opfer fiel. Da aber der Zar selbst sein Wohlgefallen an dem Stück bekundete, blieben es und sein Autor unbehelligt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass schon Mitte des 19. Jahrhunderts die menschliche Ebene des Stücks als stärker empfunden wurde als die politische.
Dieser Aspekt hat unmittelbar mit den parodistischen Tendenzen des Stücks zu tun: Gogols ursprüngliches Publikum war vertraut mit der bürgerlich Komödie des frühen 19. Jahrhunderts, für die nicht nur in Deutschland August von Kotzebue einer der herausragenden Vertreter war. »Der Revisor« erinnert sicher nicht zufällig an Kotzebues »Die deutschen Kleinbürger«, denen ein ähnlicher Verwechslungs-Plot zugrunde liegt. In Ermanglung einer Kenntnis dieser Vorlage bzw. Vorlagen geht der parodistische Gehalt des Stücks für die meisten heutigen Zuschauer natürlich verloren.
Bleibt der dramaturgische Gehalt des Stückes, der wohl dafür verantwortlich ist, dass das Stück heute noch von Theaterleuten und Schriftstellern geschätzt wird. Es ist schwer zu beurteilen, ob Gogols Wahl der Struktur des »Revisors« einer Inspiration oder schlicht mangelhafter Kenntnis der Tradition entsprungen ist, aber diese Unterscheidung ist unerheblich für die Position des Stückes in der historischen Entwicklung der Dramaturgie. Traditionell gehorcht die überwiegende Menge aller Dramen einem sehr abstrakten Grundmuster: Betrachtet man das Personal eines Stücks als Repräsentation einer Gesellschaft, so findet sich diese Bühnengesellschaft zu Anfang des Stückes in einem gestörten, disharmonischen Zustand: Zwei Familien, die miteinander seit langem verfeindet sind, eine Bevölkerung, die von einer nicht weichen wollenden Seuche bedroht ist, ein Königshaus, das durch den unerwarteten Tod des Königs und die rasche Wiederheirat der Königinwitwe seine Balance verloren hat etc. Die Handlung des Theaterstücks dient nun dazu, diese Störung wegzuspielen und am Ende einen neuen stabilen, im besten Fall harmonischen Zustand herzustellen.
Im Gegensatz dazu hinterlässt »Der Revisor« die Bühnengesellschaft in genau dem Zustand, in dem er sie zuerst vorgeführt hat: Die korrupten Honoratioren sehen sich unverändert der Bedrohung durch die Prüfung des allmächtigen Revisors ausgesetzt und sind keinen einzigen Schritt weiter und um einige hundert Rubel ärmer als zuvor. »Der Revisor« verweigert sich der Illusion des Fortschritts und der Auflösung der dramatischen Spannung. Gerade aus dieser Verweigerung gewinnt der Schluss der Komödie, auf den Gogol so stolz war, seine Kraft. Diese Struktur ist wegweisend für die Entwicklung des Dramas der Moderne.
Aus dramaturgischer Sicht ist daher Nabokovs oben zitierter Einschätzung zu widersprechen: »ein amüsantes Quidproquo bis zum letzten Tropfen auszuquetschen«, hätte bedeutet, den echten Revisor bereits in der Mitte des Stückes auftreten zu lassen und die sich daraus entwickelnden Verwerfungen, Verwicklungen und Vertauschungen durchzuspielen, um am Ende alles in einem Happy End aufzulösen, in dem der Betrüger sich als lange verlorener Sohn des Revisors erweist und die verführte Tochter des Stadthauptmanns heiratet, den Dorfrichter auf seiner Position ablöst und die ganze Familie glücklich und korrupt in die Zukunft blickt. Dass Gogol sich dem verweigert, bringt das Stück um viel Klamauk und schenkelklopfendes Gelächter, hat es aber zugleich leuchtend über die oben bereits angeführte Durchschnittsware der Zeit herausgehoben.
Nikolaj Gogol: Der Revisor. Aus dem Russischen von Bodo Zelinsky. RUB 837. Broschur, 188 Seiten. 5,– €.
 Das Büchlein über Gogol ist 1942 als zweites auf englisch geschriebenes Buch Nabokovs entstanden und 1944 im selben Verlag wie sein Vorgänger »The Real Life of Sebastian Knight« erschienen. Es ist der erste umfangreiche literaturwissenschaftliche Text Nabokovs, dem später seine Vorlesungen über russische und westeuropäische Literatur folgen sollten. In allen diesen Büchern erweist sich Nabokov als ein – um es positiv zu formulieren – sehr origineller Leser, der oft die Ansätze anderer Interpreten als unsinnig oder irrelevant verwirft und weitgehend nur den ihn selbst interessierenden Zugriff gelten lässt. Dies bedeutet in den meisten Fällen eine unnötige Verengung der Werke auf einzelne Aspekte.
Das Büchlein über Gogol ist 1942 als zweites auf englisch geschriebenes Buch Nabokovs entstanden und 1944 im selben Verlag wie sein Vorgänger »The Real Life of Sebastian Knight« erschienen. Es ist der erste umfangreiche literaturwissenschaftliche Text Nabokovs, dem später seine Vorlesungen über russische und westeuropäische Literatur folgen sollten. In allen diesen Büchern erweist sich Nabokov als ein – um es positiv zu formulieren – sehr origineller Leser, der oft die Ansätze anderer Interpreten als unsinnig oder irrelevant verwirft und weitgehend nur den ihn selbst interessierenden Zugriff gelten lässt. Dies bedeutet in den meisten Fällen eine unnötige Verengung der Werke auf einzelne Aspekte.