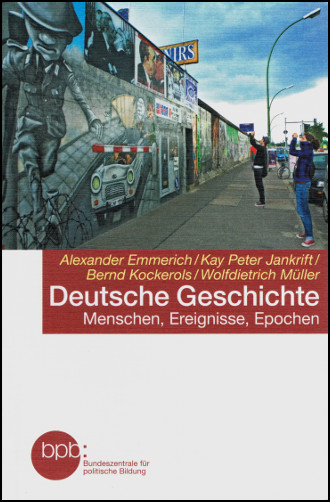Also wer ist denn bloß dieser lange Lulatsch in dem Macintosh da drüben? Ich gäb was drum, wenn ich nur wüßt. Das heißt, es schert mich imgrunde ja einen Dreck. Immer taucht doch plötzlich jemand auf, an den man nicht im Traum gedacht hätte. Eigentlich könnte man ohne weiteres auch sein ganzes Leben alleine leben. Jawohl, könnte man durchaus. Müßte dann bloß jemand auftreiben, der einen unter den Rasen bringt, wenn man gestorben ist, obwohl man sich natürlich auch vorher ein eigenes Grab buddeln könnte. Tun wir sowieso alle. Bloß der Mensch begräbt. Nee, Ameisen ebenfalls. Das erste, was jedem einfällt. Die Toten begraben. Robinson Crusoe etwa, gilt doch als lebensechte Figur. Tja, und dann hat ihn ja auch Freitag begraben. Jeder Freitag begräbt einen Donnerstag, wenn mans recht überlegt.
Ach du armer Robinson Crusoe,
Wie kamst du da bloß zu so?Armer Dignam! Sein letztes Lager auf Erden in einer Kiste. Wenn man denkt, daß das allen so geht, kommts einem doch glatt wie Holzverschwendung vor. Wird ja alles zernagt. Könnten stattdessen ne hübsche Bahre mit gleitendem Boden erfinden, eine Art Falltür mit Rutschbahn, und auf die Art dann einfach durch und runter damit. Jaja, aber dann würde gleich wieder jeder seine eigene Rutsche haben wollen. Da sind sie nun mal pingelig. Laßt mich in Heimaterde ruhn. Ein Kleckschen Lehm aus dem Heiligen Land. Nur Mutter und totgeborenesKind werden zusammen in einem Sarg beerdigt. Seh den Sinn schon ein. Ganz klar. Schutz für den Kleinen so lange wie möglich, selbst in der Erde noch. Des Irländers Haus ist sein Sarg. Einbalsamieren in Katakomben, Mumien, derselbe Gedanke. Mr. Bloom stand weit hinten, den Hut in der Hand, und zählte die baren Häupter. Zwölf. Ich bin die dreizehn. Nein. Der Kerl da im Macintosh ists. Todeszahl. Wo zum Teufel ist der plötzlich hergekommen? In der Kapelle war er noch nicht, das kann ich beschwören. Blödsinniger Aberglaube, das mit der dreizehn.
James Joyce
Ulysses
Kategorie: IJ
Henry James: Die Kostbarkeiten von Poynton
Der arme Owen ging mit offener Furcht vor dem Denken der Menschen durchs Leben: Es gab Erklärungen, die zu bekommen er sich fast ebenso scheute, wie sie zu liefern.
 Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die erste Hälfte der 1890er Jahre für Henry James so etwas wie eine Wendezeit dargestellt hat: Der Tod seiner Schwester Alice 1892, der Selbstmord seiner Freundin Constance Fenimore Woolson 1894 und nicht zuletzt sein Scheitern als Bühnenautor mit der Premiere von „Guy Domville“ Anfang 1895 bilden die Eckpunkte eine Krise, die zu seiner Neuerfindung als Romanautor führen. Der kleine Roman “The Spoils of Poynton” erschien 1897 und ist nach “The Other House” der zweite Roman, der Ergebnis dieser Neubesinnung war. Der Roman dürfte in Deutschland zu den unbekannteren von James gehören; Manesse legt ihn in seiner Reihe von Neuübersetzungen in einer Übertragung von Nikolaus Stingl erneut vor.
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die erste Hälfte der 1890er Jahre für Henry James so etwas wie eine Wendezeit dargestellt hat: Der Tod seiner Schwester Alice 1892, der Selbstmord seiner Freundin Constance Fenimore Woolson 1894 und nicht zuletzt sein Scheitern als Bühnenautor mit der Premiere von „Guy Domville“ Anfang 1895 bilden die Eckpunkte eine Krise, die zu seiner Neuerfindung als Romanautor führen. Der kleine Roman “The Spoils of Poynton” erschien 1897 und ist nach “The Other House” der zweite Roman, der Ergebnis dieser Neubesinnung war. Der Roman dürfte in Deutschland zu den unbekannteren von James gehören; Manesse legt ihn in seiner Reihe von Neuübersetzungen in einer Übertragung von Nikolaus Stingl erneut vor.
Im Mittelpunkt des Buches steht die junge Fleda Vetch, die zufällig die Bekanntschaft der vergleichsweise wohlhabenden Witwe Adela macht. Mrs. Gereth hat sich zusammen mit ihrem Mann im Herrenhaus von Poynton ein kleines, privates Museum zusammengestellt. Bei ihren jahrelangen Reisen durch Europa haben sie auf Märkten, Basaren und in Antiquariaten Schmuckstücke der europäischen Kultur erworben, die nun in Poynton eine, zumindest in den Augen der Hausherrin einmalige Sammlung bilden. An dieser Sammlung hängt denn auch ihr Herz, und sie befürchtet, dass ihr Sohn Owen, der nach seiner Hochzeit das Haus und seine Einrichtung erbt, eine Frau heiraten wird, die den Wert der Sammlung weder zu schätzen, noch zu bewahren wissen wird. Die entsprechende Kandidatin ist bereits vorhanden: Mona Brigstock, die durch die Geschmacklosigkeit der Ausstattung des elterlichen Hauses und ihre offenbare Gleichgültigkeit den Schätzen von Poynton gegenüber ausreichend als Barbarin entlarvt ist. Ganz im Gegensatz zu ihr stellt die gesellschaftlich unbedeutende Fleda Vetch in den Augen von Mrs. Gereth die ideale Schwiegertochter dar: Ästhetisch feinfühlig, emphatisch und intelligent wäre sie diejenige, der Mrs. Gereth ihre Sammlung bedenkenlos überlassen würde.
Nachdem sich Owen mit Mona verlobt hat, erweist sich einzig die Übergabe des Hauses von Poynton als Hinderungsgrund für die Hochzeit. Mrs. Gereth sollen ein kleineres Haus umziehen, das der Familie seit dem Tod eines Tante gehört, die Inneneinrichtung Poyntons aber bis auf einige wenige Stücke, die Owen ihr mitzunehmen gestatten will, zurücklassen. Zwar kommt Mrs. Gereth zwar dem Wunsch nach, das Haus zu räumen, aber sie zieht mit nahezu der kompletten Ausstattung aus Poynton aus.
In dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen Mutter und Sohn wird Fleda zur Vermittlerin zwischen den Parteien, die beide im Glauben sind, sie befinde sich wesentlich auf ihrer Seite. Fleda ist in dem Konflikt nicht ohne eigene Interessen, da sie sich in Owen verliebt hat, aber heroisch auf ihn zu verzichten gedenkt, da sie die von ihm eingegangene Verlobung auf keinen Fall stören möchte. Owen wiederum, der von Mona solange hingehalten wird, bis er die Sachen von seiner Mutter zurückbekommen hat, verliebt sich nun in Fleda, erklärt sich ihr gegenüber auch, erhält aber natürlich aus dem oben genannten ethischen Motiv heraus von ihr einen Korb. James versteht es, die Situation so zu entwickeln, dass dem Leser lange Zeit unklar bleibt, wie sich die Spannung lösen wird. Auch hier sollen die Auflösung und die abschließende Pointe nicht verraten werden.
Der Roman ist ereignisarm, dialoglastig und gerät an mehreren Stellen in gänzlich statische Sackgassen, die dennoch erzählerisch über Seiten und Seiten hinweg aufrechterhalten werden. Sein im Wesentlichen auf drei Personen beschränktes Personal (selbst Mona bildet nur eine Nebenfigur) kann den Leser dazu verführen, das ganze als eine Art soziologisches Experiment zu lesen, das die Frage stellt, was geschieht, wenn ein wirklich anständiges Mädchen mit den Gepflogenheiten der Gesellschaft kollidiert.
Die Neuübersetzung wird dem anspruchsvollen Roman weitgehend gerecht, dessen Hauptproblem darin besteht, die voraussetzungsreichen und zumeist indirekt geführten Dialoge angemessen zu übersetzen, so dass sie weder unverständlich noch banal werden. Diese Gratwanderung ist gut gelungen; einzig den naiven Ton des Gentlemans Owen hätte ich mir noch deutlicher herausgearbeitet gewünscht.
Ein Roman für Henry-James-Leser und alle, die am psychologischen Realismus der Jahrhundertwende interessiert sind.
Henry James: Die Kostbarkeiten von Poynton. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Zürich: Manesse, 2017. Leinenband, Lesebändchen, 288 Seiten. 24,95 €.
„Deutsche Geschichte“
Der handliche Band liefert auf knapp 300 Seiten ein Gerüst zur deutschen Geschichte vom 2. vorchristlichen Jahrhundert bis heran an die Gegenwart. Das Buch ist im Originalverlag unter dem Reihentitel „Allgemeinbildung Kompakt“ erschienen, was eine recht gute Vorstellung davon vermittelt, was der Band liefert. Die Behandlung von mehr als 2.000 Jahren in dieser knappen Form (wobei zu betonen ist, dass der Zeit nach 1815 mehr als die Hälfte des Umfangs gewidmet ist) zwingt die Autoren dazu, sich auf das wesentlichste Geschehen und die grundlegendsten Zusammenhänge zu konzentrieren. Je näher der Leser der Gegenwart kommt, desto schmerzlicher wird bewusst, wie notwendig unzureichend die Darstellung bleiben muss.
Andererseits liefert das Buch mehr oder weniger jene Informationen, die ein Abiturient idealerweise aus dem Geschichtsunterricht mit in sein Bildungsleben nehmen sollte. Es ist gut geeignet, um sich einen raschen, aber dennoch soliden Überblick über eine Zeit und ihre wesentlichen geschichtlichen Eckpunkte zu verschaffen. Die Kapitel lesen sich gut, da sie nicht aus einer blanken Auflistung von Daten, Personen und Orten bestehen, sondern in kurzen, erzählenden Absätzen eine rudimentäre, aber dennoch zusammenhängende Geschichtserzählung liefern.
Der Band ist – wie immer nur für kurze Zeit – bei der Bundeszentrale für politische Bildung für den einer Schutzgebühr gleichkommenden Preis von 1,50 € erhältlich. Für diesen Preis sollte er auf keinem Schreibtisch fehlen.
Alexander Emmerich / Kay Peter Jankrift / Bernd Kockerols / Wolfdietrich Müller: Deutsche Geschichte. Menschen, Ereignisse, Epochen. Lizenzausgabe. Schriftenreihe der bpb, Bd. 10023. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2017. Broschur, 296 Seiten. 1,50 €.
Aus gegebenem Anlass (XXIII) – Bloomsday
Er trug ein langes ärmelloses Gewand aus jüngst erst abgezogener Ochsenhaut, welches als loser Kilt ihm bis auf die Knie reichte, und ward dasselbe um seine Mitte gehalten von einem Gürtel aus geflochtenem Stroh und Binsen. Darunter trug er Hochländerhosen aus Hirschleder, gar roh mit Darm genähet. Seine untern Extremitäten waren von hohen Balbriggan-Halbstiefeln umschlossen, gefärbt in Flechtenpurpur, und seine Füße mit groben Stiefeln beschuht aus gepökelter Kuhhaut, welche mit der Luftröhre desselben Tieres geschnürt waren. Von seinem Gürtel hing eine Kette aus Kieseln, welche bei jeder Bewegung seiner unheilkündenden Gestalt zusammenschlugen, und es waren eingegraben auf ihnen mit roher, doch überraschender Kunst die Stammeszeichen vieler irischer Helden und Heldinnen des Altertums, Cuchulin, Conn von hundert Schlachten, Niall von den neun Geiseln, Brian von Kincora, Der Ardri Malachi, Art MacMurragh, Shane O’Neill, Pater John Murphy, Owen Roe, Patrick Sarsfield, Red Hugh O’Donnell, Red Jim MacDermott, Soggarth Eoghan O’Growney, Michael Dwyer, Francy Higgins, Henry Joy M’Cracken, Goliath, Horace Wheatley, Thomas Conneff, Peg Woffington, Der Dorf-Schmied, Captain Moonlight, Captain Boycott, Dante Alighieri, Christoph Columbus, St. Fursa, St. Brendan, Marschall MacMahon, Karl der Große, Theobald Wolfe Tone, Die Mutter der Makkabäer, Der Letzte Mohikaner, Die Rose von Kastilien, Der Mann für Galway, Der Mann der die Bank von Monte Carlo sprengte, Der Mann in der Bresche, Die Frau die es nicht tat, Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, John L. Sullivan, Cleopatra, Savourneen Deelish, Julius Caesar, Paracelsus, Sir Thomas Lipton, Wilhelm Tell, Michelangelo, Hayes, Mohammed, Die Braut von Lammermoor, Peter der Einsiedler, Peter der Packer, Dunkel Rosaleen, Patrick W. Shakespeare, Brian Confuzius, Murtagh Gutenberg, Patricio Velasquez, Kapitän Nemo, Tristan und Isolde, Der erste Prince of Wales, Thomas Cook und Sohn, Der Junge Tapfere Soldat, Arrah na Pogue, Dick Turpin, Ludwig Beethoven, Die Colleen Bawn, Waddler Healy, Angus der Kuldeer, Dolly Mount, Sidney Parade, Ben Howth, Valentine Greatrakes, Adam und Eva, Arthur Wellesley, Boss Croker, Herodot, Jack der Riesentöter, Gautama Buddha, Lady Godiva, Die Lilie von Killarney, Balor mit dem Bösen Blick, Die Königin von Saba, Acky Nagle, Joe Nagle, Alessandro Volta, Jeremiah O’Donovan Rossa, Don Philip O’Sullivan Beare. Ein hingestreckter Speer aus gespitztem Granit ruhte neben ihm, indessen zu seinen Füßen ein wildes Tier aus der Rasse der Hunde lag, dessen schnarchende Atemzüge verkündeten, daß es in unruhigen Schlaf gesunken sei, eine Vermutung, bestätigt von heiserem Grollen und krampfartigen Bewegungen, welche sein Herr von Zeit zu Zeit vermittels besänftigender Schläge mit einer mächtigen, roh aus paläolithischem Gestein gefertigten Keule unterdrückte.
James Joyce
Ulysses
Aus gegebenem Anlass (XX) – Bloomsday
– Wie lautet denn Ihre Hamlet-Idee? fragte Haines Stephen.
– Nein, nein! schrie Buck Mulligan voller Qual. Ich bin im Moment Herrn Thomas von Aquin und den fünfundfünfzig Gründen, auf die er die Sache gestellt hat, nicht gewachsen. Wartet, bis ich ein paar Pinten intus habe.
Er wandte sich Stephen zu und sagte, während er säuberlich die Spitzen seiner primelgelben Weste herunterzog:
– Du kriegtest es auch unter drei Pinten selber gar nicht hin, Kinch, was?
– Es hat so lange gewartet, sagte Stephen lustlos, es kann auch noch länger warten.
– Sie reizen meine Neugier, sagte Haines liebenswürdig. Handelt es sich um ein Paradoxon?
– Ach was, sagte Buck Mulligan. Oscar Wilde und die Paradoxa haben wir hinter uns. Die Sache ist ganz einfach. Er weist per Algebra nach, daß Hamlets Enkel Shakespeares Großvater ist und er selber der Geist seines eigenen Vaters.
– Was? sagte Haines und zeigte mit zögerndem Finger auf Stephen. Er selber?
Buck Mulligan schlang sein Badetuch wie eine Stola um den Hals, und indem er sich in hemmungslosem Gelächter krümmte, sagte er Stephen ins Ohr:
– O du Schatten von Kinch dem Älteren! Japhet auf der Suche nach einem Vater!
– Wir sind morgens immer etwas müde, sagte Stephen zu Haines. Und es ist nicht mit ein paar Worten zu erzählen.
Buck Mulligan, der sich wieder in Bewegung gesetzt hatte, hob die Hände.
– Die heilige Pinte allein kann Dedalus die Zunge lösen, sagte er.
– Also ich finde, erklärte Haines Stephen, während sie hinter ihm hergingen, daß der Turm und die Klippen hier doch irgendwie an Helsingör erinnern. An den Felsen, der in die See nickt über seinen Fuß. Heißt es nicht so?James Joyce
Ulysses
Henry James: Eine Dame von Welt
Das letzte Wort zu alldem musste lauten, dass Mrs. Headway ein Quälgeist war.
 „Eine Dame von Welt“ heißt im Original “The Siege of London”, also Die Belagerung von London. Dass der Verlag eine solche Umbenennung für notwendig hielt, macht deutlich, dass James in Deutschland mittlerweile so unbekannt ist, dass man mit einer getreuen Übersetzung des Titels die Leser historischer Romane in die Irre zu leiten fürchtet. Ich vermute, dass es inzwischen in China eine Ausgabe von Thomas Manns „Der Zauberberg“ unter dem chinesischen Titel Das Sanatorium gibt, um die chinesischen Fantasy-Leser nicht zu verwirren. Einerseits ist eine solche Haltung in Zeiten eines immer breiteren und zugleich immer differenzierteren Buchmarktes verständlich (dazu gehört auch die hinzuerfundene Gattungsbezeichnung „Eine Salonerzählung“), andererseits nimmt die deutsche Ausgabe mit dieser Entscheidung dem intelligenteren Leser ein von James bewusst an den Anfang gesetztes Signal, um den Ton der Erzählung einschätzen zu können. Aber was nützt das beste Straßenschild, wenn es kaum wer als solches erkennt? Da kann man an derselben Stelle auch gleich eine Reklametafel aufstellen. Denn immerhin existiert ja noch die Straßenverkehrsordnung, wenn die auch kaum mehr wer kennt. „Das ist ein prächtiger Anfang! Wenn jeder nur erst wieder von Null ausgeht, da müssen die Fortschritte in kurzer Zeit außerordentlich bedeutend werden“, bemerkte Goethe zu Johann Daniel Falk am 17. April 1808. Wie rasch doch die unbedeutendsten Dinge zu vollständig nutzlosen Betrachtungen führen können.
„Eine Dame von Welt“ heißt im Original “The Siege of London”, also Die Belagerung von London. Dass der Verlag eine solche Umbenennung für notwendig hielt, macht deutlich, dass James in Deutschland mittlerweile so unbekannt ist, dass man mit einer getreuen Übersetzung des Titels die Leser historischer Romane in die Irre zu leiten fürchtet. Ich vermute, dass es inzwischen in China eine Ausgabe von Thomas Manns „Der Zauberberg“ unter dem chinesischen Titel Das Sanatorium gibt, um die chinesischen Fantasy-Leser nicht zu verwirren. Einerseits ist eine solche Haltung in Zeiten eines immer breiteren und zugleich immer differenzierteren Buchmarktes verständlich (dazu gehört auch die hinzuerfundene Gattungsbezeichnung „Eine Salonerzählung“), andererseits nimmt die deutsche Ausgabe mit dieser Entscheidung dem intelligenteren Leser ein von James bewusst an den Anfang gesetztes Signal, um den Ton der Erzählung einschätzen zu können. Aber was nützt das beste Straßenschild, wenn es kaum wer als solches erkennt? Da kann man an derselben Stelle auch gleich eine Reklametafel aufstellen. Denn immerhin existiert ja noch die Straßenverkehrsordnung, wenn die auch kaum mehr wer kennt. „Das ist ein prächtiger Anfang! Wenn jeder nur erst wieder von Null ausgeht, da müssen die Fortschritte in kurzer Zeit außerordentlich bedeutend werden“, bemerkte Goethe zu Johann Daniel Falk am 17. April 1808. Wie rasch doch die unbedeutendsten Dinge zu vollständig nutzlosen Betrachtungen führen können.
Wie so oft bei James ist es nicht einfach zu entscheiden, wessen Geschichte eigentlich erzählt wird. Es beginnt mit einer Begegnung der beiden US-Amerikaner George Littlemore und Rupert Waterville mit Nancy Headway in der Pariser Comédie Française. Littlemore kennt Nancy aus seiner Zeit im Westen der USA; damals hieß sie noch Nancy Beck, und seit damals hat sie einige Ehen hinter sich gebracht. Nachdem sie mit dem Versuch, in die New Yorker High Society aufgenommen zu werden, gescheitert ist, versucht sie jetzt ihr Glück in London. Zu diesem Zweck hat sie dem deutlich jüngeren Sir Arthur Demesne den Kopf verdreht, den sie zu heiraten gedenkt, wenn er sich denn dazu bringen lässt. Dem steht im Wesentlichen seine Mutter im Weg, die den Verdacht hegt, Mrs. Headway sei nicht gesellschaftsfähig, es aber nicht nachweisen kann. Sie versucht sowohl Waterville, der für die US-Botschaft in London arbeitet, als auch Littlemore die entsprechenden Informationen zu entlocken. Littlemore, der mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun haben will, knickt schließlich ein und bestätigt Lady Demesnes Verdacht. Doch es ist zu spät: Nancy ist bereits verlobt mit Sir Arthur und setzt sich gegen die Mutter letztlich durch.
Der moralische Konflikt ist interessanterweise der Littlemores: Nancy ist eine rücksichtslose Karrieristin, die schlicht versucht, ihre Interessen durchzusetzen; sie betrachtet das Normensystem der besseren Gesellschaft und seine Vertreter schlicht als Gegner, gegen die es sich durchzusetzen gilt. Waterville dagegen will als Vertreter des Normensystems erscheinen, ist aber nicht bereit, die daraus folgenden Konsequenzen zu ziehen: Von Lady Demesne nach der Vergangenheit von Nancy Headway befragt, windet er sich aus der Verantwortung heraus, obwohl er sie moralisch ebenso verurteilt wie die Fragestellerin oder seine Mutter oder Schwester. Littlemore schließlich, der das ganze als eine Art oberflächlichen Spiels ansieht und auf dem Standpunkt steht, dass Nancy jedes Recht hat zu versuchen, sich gegen den Widerstand der Gesellschaft durchzusetzen, ist derjenige, der Lady Demesne am Ende das liefert, was sie braucht. Er tut dies in dem Wissen, dass eine Verlobung bereits stattgefunden hat, und in der Überzeugung, dass seine Antwort wahrscheinlich nichts mehr ändern wird. Dennoch ist er es, der als einziger der moralischen Forderung nach Wahrhaftigkeit im Umgang miteinander nachkommt. Ob Lady Demesne einen Anspruch auf diese Wahrhaftigkeit erheben kann, bleibt dabei ebenso ungeklärt wie die Frage, ob das moralische Urteil, das sich die High Society über Nancy Headway anmaßt, berechtigt ist oder nicht.
Hält man diese distanzierte Haltung des Erzählers mit dem historisierenden Originaltitel zusammen, bekommt man einen Eindruck von der über dem Ganzen der Erzählung liegenden Ironie: James erzählt diese Episode, als würde sie beispielsweise am Hofe Heinrich VIII. spielen, und er hält sie in ihren moralischen Konsequenzen wahrscheinlich für ähnlich relevant, als hätte sie sich dort abgespielt. Nimmt man allerdings an, die Erzählung sei eine Salonerzählung und handle von einer Dame von Welt, könnte dies im Einzelfall beim Leser zu einem ganz grundsätzlichen Missverständnis führen. Doch die Hauptsache ist natürlich, dass der Vertrieb zufrieden ist.
Ergänzt wird der Band durch einen Essay von Henry James, indem er unter anderem über eines der Vorbilder der Erzählung, Alexandre Dumas’ Komödie „Le Demi-Monde“, schreibt.
Henry James: Eine Dame von Welt. Eine Salonerzählung. Aus dem Englischen von Alexander Pechmann. Berlin: Aufbau, 2016. Flexibler Leinenband mit Banderole, Lesebändchen, 176 Seiten. 16,95 €.
Henry James: Daisy Miller
»Sie tat, was sie wollte!«
 „Daisy Miller“ ist eine der frühen Erzählungen Henry James’, erstmals veröffentlicht im Jahr 1878. Das Original trägt den etwas differenzierteren Titel “Daisy Miller: A Study”, was in dieser Neuausgabe bei dtv auf die schlichte Gattungsbezeichnung „Eine Erzählung“ reduziert wird. Der Geschichte seiner Titelheldin stand James im Alter eher reserviert gegenüber, musste aber hinnehmen, dass sie zu seinen bekanntesten und beliebtesten gehörte.
„Daisy Miller“ ist eine der frühen Erzählungen Henry James’, erstmals veröffentlicht im Jahr 1878. Das Original trägt den etwas differenzierteren Titel “Daisy Miller: A Study”, was in dieser Neuausgabe bei dtv auf die schlichte Gattungsbezeichnung „Eine Erzählung“ reduziert wird. Der Geschichte seiner Titelheldin stand James im Alter eher reserviert gegenüber, musste aber hinnehmen, dass sie zu seinen bekanntesten und beliebtesten gehörte.
Interessanterweise ist der eigentliche Protagonist aber der junge US-Amerikaner Frederick Winterbourne, der bereits als Kind nach Europa gekommen ist. Zur Zeit der Erzählung lebt er in Genf, wo er vorgeblich studiert, tatsächlich aber eine Beziehung zu einer älteren Frau pflegt. Daisy Miller lernt er zufällig kennen, als er seine Tante im Kurort Vevey besucht. Sie fällt ihm sofort nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen ihres sehr freien und selbstbewussten Verhaltens auf. Sie lässt sich schon nach kurzer Bekanntschaft mit Winterbourne darauf ein, zusammen mit ihm – und nur mit ihm – das nahegelegene Schloss Chillon zu besichtigen.
Winterbournes Tante reagiert auf seinen Bekanntschaft mit Daisy etwas reserviert, da sie von den Millers gesellschaftlich nicht viel hält. Daisy, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrem viel jüngeren Bruder in Europa unterwegs ist, stammt aus einer Industriellenfamilie, die aber nicht zur High Society der USA zu rechnen ist. Für Winterbournes Tante machen sich diese Leute allein schon deshalb unmöglich, weil sie mit ihrem europäischen Cicerone zusammen essen und überhaupt einen vertrauten Umgang mit ihm pflegen. Daisy lebt in Europa offenbar ein außergewöhnlich freies Leben, da ihre Mutter sich als gänzlich unfähig erweist, der Selbstständigkeit ihrer Tochter irgendwelche Grenzen zu setzen.
Als Winterbourne seinen Besuch in Vevey bereits nach wenigen Tagen beendet, lässt Daisy für einen einzigen Moment durchblicken, dass ihr ironisches und distanziertes Spiel mit Frederick nur eine Farce ist, und sie an dem jungen Mann doch ernsthafter interessiert sein könnte. Sie nötigt ihm jedenfalls das Versprechen ab, sie im Winter in Rom aufzusuchen, was in Fredericks Pläne passt, da auch seine Tante sich dann in Rom aufhalten wird.
Winterbourne trifft etwa acht Monate später erwartungsvoll in Rom ein und hofft eine Daisy vorzufinden, die ihn sehnsüchtig erwartet. Stattdessen amüsiert sich die junge Frau prächtig in der römischen Gesellschaft, pflegt Freundschaften mit italienischen Junggesellen und kümmert sich wenig darum, was die amerikanische Gemeinde in Rom von ihr denkt. Diese Spannung kommt zur Entladung, kurz nachdem Frederick in Rom eingetroffen ist: Daisy wird von einer der Grande Dames der Amerikaner dazu aufgefordert, einen Spaziergang mit ihrem italienischen Freund Giovanelli abzubrechen und zu ihr in die Kutsche zu steigen; als Daisy sich weigert, das zu tun, wird sie bei nächster Gelegenheit öffentlich abgekanzelt und aus der guten Gesellschaft ausgestoßen.
Winterbourne reagiert in einer Mischung aus Enttäuschung, Eifersucht und Unsicherheit ebenfalls abweisend; er versucht zwar noch, Daisy auf den rechten Weg zu führen, gibt sie dann aber letztlich ebenfalls auf. James bringt die Erzählung zu einem recht abrupten Ende, indem er Daisy an der Malaria erkranken und kurz darauf sterben lässt. Am Grab kommt Frederick zur Einsicht, die junge Frau und ihre Handlungen falsch be- und sie daher verurteilt zu haben. Doch allzu tief scheint es ihn nicht getroffen zu haben, denn letztlich kehrt er zu seinem eigenen unmoralische Verhältnis in Genf zurück.
Es ist nicht ganz einfach zu bestimmen, wovon James in diesem Text eigentlich erzählt; es könnte sogar der Verdacht aufkommen, dass er das selbst nicht so ganz genau gewusst hat. Der für James typische Gegensatz zwischen nordamerikanischen und europäischen Sitten bildet nur die Folie für eine Geschichte, in der einen junge Frau von der sie umgebenden Gesellschaft dafür verurteilt und abgestraft wird, dass sie sich Freiheiten herausnimmt, die bei einem US-amerikanischen Mann in Europa selbstverständlich toleriert werden. Dass James das Thema nicht vollständig durchführen konnte, zeigt sich an dem hilfsweisen Tod Daisys, für den zum Teil ihr eigener Starrsinn, zum Teil die Leichtfertigkeit Giovanellis verantwortlich gemacht werden. Daisy scheitert an der Gefährlichkeit der Natur, der sie sich aussetzt, nicht an der Gesellschaft, von der sie verurteilt wurde. Das ermöglicht eine Tragik, für die am Ende keiner wirklich verantwortlich zeichnet, ohne dass das kritische Potenzial der Erzählung damit aufgehoben würde. Wahrscheinlich ist es diese eigentümliche Konstruktion, die zu ihrem dauerhaften Erfolg wesentlich beigetragen hat.
Die Neuübersetzung von Britta Mümmler liest sich gut und ist, soweit ich sie geprüft habe, in der Sache korrekt, nimmt sich für meinen Geschmack aber stilistisch ein wenig zu viele Freiheiten heraus – fehlende oder hinzugefügte Worte, Verwechslung von Subjekt und Objekt und andere Änderung von Satzstrukturen habe ich allein auf den ersten Seiten gefunden; den kastrierten Titel muss man wahrscheinlich dem Verlag und nicht der Übersetzerin anlasten. Wer den englischen Text nicht kennt, wird aber mit dieser deutschen Ausgabe ganz zufrieden sein; die Erläuterungen im Anhang sind gut gesetzt und hilfreich. Alles in allem eine gute deutsche Leseausgabe.
Henry James: Daisy Miller. Aus dem Englischen von Britta Mümmler. Kindle-Edition. München: dtv, 2015. (Druckausgabe: 128 Seiten.) 9,99 €.
Jahresrückblick 2015
Auch für das vergangene Jahr die Höhen und Tiefen der Lektüre in einem kurzen Überblick diesmal mit einer sich zufällig ergebenden Aufteilung zwischen Belletristik und Sachbuch.
Die drei besten Lektüren des Jahres 2015:
- Philip Roth: Der menschliche Makel – ein sehr fein gearbeiteter Roman über grobe Vorurteile und die Macht des moralischen Klatsches.
- William Faulkner: Absalom, Absalom! – einer der ganz großen US-amerikanischen Romane des 20. Jahrhunderts über Folgen des Rassismus und anderer Lügen.
- Henry James: Die Gesandten – subtile Neuübersetzung eines der bedeutenden Spätwerke Henry James’, in dem beinahe nichts passiert und sich dennoch alles ständig in Bewegung befindet.
Die drei schlechtesten Lektüren des Jahres 2015:
- Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit – ein gutes Beispiel dafür, wie man mit einem halbverstandenen und gar nicht durchdachten Konzept die Welt nicht begreifen kann.
- Hazel Hutchison: Henry James – eines der schlampigsten Bücher, das ich je in der Hand gehabt habe: Inhalt, Übersetzung und Lektorat sind indiskutabel.
- Orlando Figes: Hundert Jahre Revolution – ein weiteres Exemplum für ein schludriges Sachbuch eines eigentlich versierten Historikers, das auf ein breites Publikum abzielt, das es ohnehin nicht besser weiß.
Henry James: Die Gesandten
Vorherrschend jedoch blieb an diesem Ort und in dieser Stunde die Freiheit; es war die Freiheit, was ihm am stärksten seine eigene, vor langer Zeit versäumte Jugend zurückbrachte.
 Auch der Hanser Verlag liefert in seiner Klassiker-Reihe einen Beitrag zum bevorstehenden Henry-James-Jubiläumsjahr: James’ später Roman „The Ambassadors“ (1903) erscheint in einer Neuübersetzung von Michael Walter, einem der renommiertesten deutschen Übersetzer. „Die Gesandten“ gelten einerseits als eines der späten Meisterwerke James’, sie stellen andererseits hohe Ansprüche an ihre Leser, heute wahrscheinlich mehr als noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Auch der Hanser Verlag liefert in seiner Klassiker-Reihe einen Beitrag zum bevorstehenden Henry-James-Jubiläumsjahr: James’ später Roman „The Ambassadors“ (1903) erscheint in einer Neuübersetzung von Michael Walter, einem der renommiertesten deutschen Übersetzer. „Die Gesandten“ gelten einerseits als eines der späten Meisterwerke James’, sie stellen andererseits hohe Ansprüche an ihre Leser, heute wahrscheinlich mehr als noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Die Handlung des Romans ist – wie oft bei Spätwerken anspruchsvoller Autoren – stark reduziert und bildet nicht mehr als ein Gerüst für das eigentliche Interesse des Erzählers: Erzählt wird ein knappes halbes Jahr aus dem Leben des US-Amerikaners Lewis Lambert Strether – wahrscheinlich benannt nach dem Titelhelden von Balzacs Roman „Louis Lambert“ (1845) –, der Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem kleinen und fiktiven amerikanischen Städtchen Woollett in der Nähe Bostons nach Paris reist. Strether, 55 Jahre alt und Witwer, ist im Auftrag seiner Chefin und Verlobten Mrs. Newsome unterwegs, um deren Sohn Chad in Paris loszueisen und nach Amerika zurückzubringen. Chad befindet sich inzwischen seit drei Jahren in Europa, und in Woollett vermutet man, dass er sich eine Beziehung zu einer moralisch fragwürdigen Frau zugezogen hat. In Woollett dagegen erwartet ihn nicht nur eine finanziell überaus lukrative leitende Position im väterlichen Unternehmen, sondern auch eine dieser Stellung angemessene Heirat mit der „fabelhaften“ – das für nahezu alle Personen ständig benutzte Epitheton Strethers – Mamie Pocock, mit deren Bruder Jim bereit Chads Schwester Sarah verheiratet ist.
In Paris zeigt sich Strether allerdings ein recht anderes Bild: Chad hat sich unter der leitenden Hand der verheirateten Comtesse Marie de Vionnet zu einem jungen Gentleman gemausert, der auf Strether einen gewaltigen Eindruck macht. Sein gehobener Umgang, seine vornehme Wohnung, seine Lebensart schlechthin überwältigen Strether so sehr, dass er bei ihrer ersten Begegnung zwar seinem Auftrag nachkommt, Chad zur Rückkehr aufzufordern, jedes ernsthafte Drängen in dieser Richtung aber unterlässt und anschließend seine Tage in Paris mehr oder weniger vorbeitreiben lässt. Er lernt die Comtesse und ihre ihn entzückende Tochter Jeanne kennen, befreundet sich mit John Bilham, einem von Chads US-amerikanischen Freunden und berichtet über all das brav und aufrichtig in Briefen nach Woollett. Als Chad sich dann endlich zur Abreise bereit erklärt, verhindert Strether dies in dem klaren Bewusstsein, dass Mrs. Newsome ihm weitere Gesandte nachschicken wird. Er lebt in der Überzeugung oder wenigstens der Hoffnung, dass auch diese Chads Verwandlung erkennen und seinen Verbleib in Europa befürworten werden. Um Strethers Haltung richtig einschätzen zu können, muss man noch wissen, dass er nahezu die einzige Figur des Romans ist, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten muss: Er ist Herausgeber einer von seiner Verlobten finanzierten Woolletter Zeitschrift, so dass er damit rechnen muss, nicht nur seine berufliche Stellung, sondern auch seine Alterssicherung zu verlieren, wenn er sich den Zorn der allmächtig im Hintergrund bleibenden Mrs. Newsome zuzieht.
Wie erwartet, tauchen nach einigen Wochen drei weitere Abgesandte in Paris auf: Chads Schwester mit Ehemann und Schwägerin. Entgegen Strethers Hoffnung ist Sarah von Chads Entwicklung nicht im geringsten beeindruckt, hält seine platonische Freundschaft mit der Comtesse schlicht für ein unmoralisches Verhältnis mit einer verheirateten Frau, die Comtesse selbst für eine adelige Schlampe und bringt überhaupt nur deshalb für einige Wochen Geduld mit Chad auf, weil sie selbst Urlaub in Paris zu machen gedenkt. Doch bevor sie mit ihrer Entourage zu einer kleinen Rundreise durch Europa aufbricht, setzt sie Chad und Strether die Daumenschrauben an. Und da sich Strether nicht vorbehaltlos auf ihre Seite schlägt, erklärt sie, nun „mit ihm fertig“ zu sein, wobei sie durchaus nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mutter spricht. Bevor der Roman endet, steht Strether noch eine herbe Überraschung und Einsicht bevor, aber auch diese bewältigt er ganz und gar als der wahre Gentleman, der er ist. Das Ende des Romans bleibt mehr oder weniger offen: Ob Chad tatsächlich dauerhaft in Paris bei der Comtesse blieben wird und wie es in der privaten und beruflichen Zukunft Strethers, der vorerst einmal in die USA zurückkehrt, weitergehen wird, wird höchstens angedeutet.
Im Zentrum des Romans steht die Einsicht Strethers, sein Leben vertan zu haben. James selbst hat darauf hingewiesen, dass Strethers kleine Rede an den jungen Bilham über die „Illusion der Freiheit“ das eigentlichen Thema des Romans prägnant zusammenfasst:
Immerhin haben wir die Illusion der Freiheit; vergessen Sie deshalb nicht, so wie ich heute, diese Illusion. Ich war im entscheidenden Augenblick entweder zu dumm oder zu klug, mich daran zu erinnern; ich weiß nicht, was von beiden. Jetzt spricht aus mir die Reaktion auf diesen Fehler; und der Stimme der Reaktion sollte man fraglos nie ohne Vorbehalt begegnen. Das ändert aber nichts daran, dass für Sie jetzt die richtige Zeit da ist. Die richtige Zeit ist jede Zeit, die man zum Glück noch besitzt. […] Verpassen Sie bloß nichts aus Dummheit. […] Tun Sie, was Sie wollen, bloß begehen Sie nicht meinen Fehler. Denn es war ein Fehler. Leben Sie, leben Sie!
Dieses kleine Plädoyer für das Leben – das ursprünglich von James’ Freund und Mentor William Dean Howells stammt und die erste Idee zum Roman lieferte – beschreibt auf den Punkt, woraus sich Strethers Loyalität gegenüber Chad selbst dann noch speist, als er einsehen muss, von diesem belogen und manipuliert worden zu sein.
All dies wird in einem sehr langsamen und detaillierten Stil beschrieben. Die weitgehend personale Erzählperspektive des Romans und die damit einhergehende langsame und sozusagen schichtweise Einsicht in die bestehenden Sachverhalte sowie das Überwiegen dialogischer und reflektierender Passagen stellen einige Ansprüche an Geduld und Aufmerksamkeit der Leser. Der Roman unterläuft, wie Herausgeber Daniel Göske in seinem durchweg informativen Nachwort richtig anmerkt, alle damals gängigen Lesererwartungen an einen in Paris spielenden Roman: Er ist weder ein sozialkritischer Zeitroman, noch eine romantische Komödie, eine moralisierende Liebesgeschichte oder ein tragischer Ehebruchsroman. Auch für den Protagonisten eines Entwicklungsromans ist Strether deutlich zu alt. Auch der von James so ausgiebig bearbeitete Gegensatz Europa/USA spielt in diesem Fall nur eine untergeordnete, hintergründige Rolle. Für den Leser kommt es ganz und gar darauf an, sich auf die Person Strethers einlassen zu können; wer den sentimentalen Konflikt des Protagonisten nicht erfasst, für den ist der Roman verloren.
Die Neuübersetzung durch Michael Walter ist – bis auf winzige Kleinigkeiten – meisterlich. Walter versteht es, die komplexen Strukturen, in denen sich die Gedanken Strethers bewegen, im Deutschen perfekt nachzubauen. Die schwierigste Aufgabe bestand aber zweifelsohne darin, die nahezu immer nur indirekten und vieldeutigen Dialoge zwischen den Figuren wiederzugeben. Kaum jemals sagt in diesem Roman eine Figur unmittelbar, was sie meint; beinahe jede Äußerung enthält nicht nur eine Andeutung, sondern auch die Möglichkeit, sie misszuverstehen, und garantiert dem Sprecher zugleich die Möglichkeit der Ausflucht, nichts von alledem, was man verstehen könnte, tatsächlich gemeint zu haben. Das geht soweit, dass James eine der Nebenfiguren von der Bühne fliehen lässt, als sie sich in die Notlage versetzt sieht, Strether entweder geradewegs belügen oder gänzlich schweigen zu müssen. Dieses fragile System der Kommunikation, das schon im Original unendliche Mühe gemacht haben muss, ins Deutsche gerettet zu haben, ist kein kleines Meisterstück!
Ein Roman für Leser, die Zeit und Sorgfalt in seine Lektüre zu investieren bereit sind. Ich verspreche, dass sie dafür reicher belohnt werden als durch die Lektüre von zehn zeitgenössischen Krimis (von denen ich zugestandenermaßen keine Ahnung habe).
Henry James: Die Gesandten. Aus dem Englischen von Michael Walter. München: Hanser, 2015. Leinen, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 699 Seiten. 39,95 €.
Henry James: Die Europäer
Man muss schon sagen – und das ist mir bereits früher aufgefallen, – nichts übersteigt die Zügellosigkeit, die sich die Fantasie puritanischer Leute manchmal erlaubt.
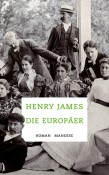 Bei „Die Europäer“ handelt es sich um einen kurzen, frühen Roman von Henry James (je nachdem, ob man „Watch and Ward“ als vollwertigen Roman gelten lässt, handelt es sich um seinen dritten oder vierten). Er ist 1878 erschienen, seine Handlung ist aber – wie die zahlreicher anderer Texte James’ auch – deutlich vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg in Boston angesiedelt. Die Europäer des Romans sind zwei Geschwister, Baronin Eugenia Münster (im Original Munster, was akustisch deutlich näher bei Monster liegt) und ihr jüngerer Bruder Felix Young, ein immer gut gelaunter Liebhaber der Malerei. Die Baronin floh vom alten Kontinent, da ihre Ehe zum Bruder des regierenden Fürsten von Silberstadt-Schreckenstein in einer Krise steckt: Der Fürst möchte seinen Bruder gern standesgemäß verheiraten und daher dessen morganatische Ehe mit Eugenia lösen; da er aber nicht nur ein schreckensteinischer Herrscher, sondern auch ein Gentleman ist, macht er die Verwirklichung seiner Pläne von Eugenias Zustimmung abhängig.
Bei „Die Europäer“ handelt es sich um einen kurzen, frühen Roman von Henry James (je nachdem, ob man „Watch and Ward“ als vollwertigen Roman gelten lässt, handelt es sich um seinen dritten oder vierten). Er ist 1878 erschienen, seine Handlung ist aber – wie die zahlreicher anderer Texte James’ auch – deutlich vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg in Boston angesiedelt. Die Europäer des Romans sind zwei Geschwister, Baronin Eugenia Münster (im Original Munster, was akustisch deutlich näher bei Monster liegt) und ihr jüngerer Bruder Felix Young, ein immer gut gelaunter Liebhaber der Malerei. Die Baronin floh vom alten Kontinent, da ihre Ehe zum Bruder des regierenden Fürsten von Silberstadt-Schreckenstein in einer Krise steckt: Der Fürst möchte seinen Bruder gern standesgemäß verheiraten und daher dessen morganatische Ehe mit Eugenia lösen; da er aber nicht nur ein schreckensteinischer Herrscher, sondern auch ein Gentleman ist, macht er die Verwirklichung seiner Pläne von Eugenias Zustimmung abhängig.
So besuchen Eugenia und Felix in Boston ihre amerikanischen Verwandten: Mr. William Wentworth, der Halbbruder ihrer Mutter, lebt dort mit seinen drei Kindern in gut situierten Verhältnissen. Seine beiden noch unverheirateten Töchter Charlotte und Gertrude befinden sich passenderweise gerade im besten heiratsfähigen Alter, aber der Jüngste, Clifford, macht seinem Vater etwas Sorgen, da er wegen eines Falls von öffentlicher Trunkenheit eine Zwangspause im Studium einlegen muss. Das Umfeld der Familie bilden Robert Acton und seine Schwester Lizzie sowie Mr. Brand. Robert Acton hat bereits als junger Mann sein ererbtes Vermögen beim Handel in China verfünffacht und scheint nun gar nichts zu tun (überhaupt arbeitet niemand in diesem Roman für seinen Lebensunterhalt), seine Schwester dient als potentielles Ehefrau Cliffords, und der Unitarische Geistliche Mr. Brand ist sowohl für die moralische Besserung Cliffords zuständig als auch als Ehemann für Gertrude vorgesehen. Der aufmerksame Leser beginnt sogleich, im Geiste Pärchen zu bilden.
So kommt es denn, wie es kommen muss, oder wenigstens beinahe: Felix heiratet am Ende Getrude, Mr. Brand heiratet Charlotte, Clifford heiratet Lizzie und nur Eugenia und Robert bekommen einander nicht, sondern Eugenia verlässt das für sie unerträglich langweilige Amerika wieder und begibt sich zurück zu ihrer gefährdeten Ehe in Silberstadt-Schreckenstein, was ihr immer noch lieber zu sein scheint, als sich in ein vernünftiges, solides Leben in Boston einzufinden neben einem Mann, der zwar sie liebt, den sie aber nicht zu lieben versteht.
Die Vernunft ist deprimierend fade. Das ist eine Suppe ohne Salz.
Seinen milden Witz bezieht der Roman aus der Verunsicherung der altehrwürdigen Puritaner durch die weit weniger traditionell erscheinenden, in ihren Manieren wenigstens äußerlich freieren Europäer. Alles in allem muss man aber feststellen, dass die Figuren des Romans vergleichsweise flach bleiben. So müssen sich die Leser den Konflikt, den die Baronin in sich austrägt, und die Umstände ihrer amerikanischen Langeweile weitgehend selbst zusammenreimen, da sie vom ihren europäischen Lebensumständen kaum etwas Konkretes erfahren; auch der ewig gutgelaunte Felix, der selbst die direktesten Grobheiten mit Leichtigkeit und naiver Harmlosigkeit vorträgt, ermangelt jeglichen tatsächlichen Charakters. Die einzige Figur, bei der James etwas anderes als ein Komödienklischee gelungen ist – Gertrude – kommt so selten im Buch vor, dass auch sie mehr zu einem raunenden Geheimnis als zu einer tatsächlichen Person gerät.
Ein leichter, eingängiger, kurzer Roman ohne besonderen Tiefgang, der nur an wenigen Stellen ahnen lässt, was für ein Schriftsteller aus James noch werden sollte. Vom Publikum seiner Zeit ist er gut aufgenommen worden; seine heutigen deutschen Leser werden ihn wohl eher nur en passant zur Kenntnis nehmen.
Henry James: Die Europäer. Aus dem Englischen von Andrea Ott. Zürich: Manesse, 2015. Leinenband mit grünem Farbschnitt, Lesebändchen, 248 Seiten. 24,95 €.