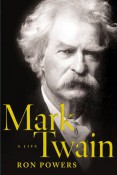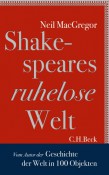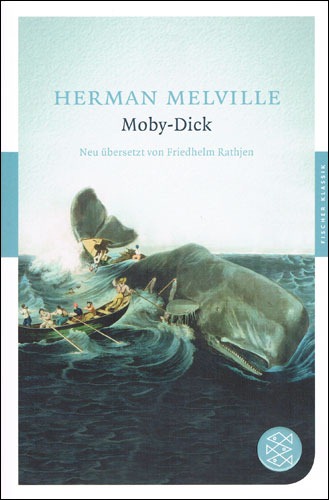Gott bewahre mich davor, jemals etwas zu vollenden. Dieses ganze Buch ist nur ein Entwurf – nein, nur der Entwurf zu einem Entwurf. Oh, Zeit, Kraft, Geld und Geduld!
Ein Buch, bei dem sich ein Rezensent bestenfalls blamieren kann! »Moby-Dick« ist zu unterschiedlichen Zeiten so unterschiedlich bewertet worden, dass zu vermuten ist, dass zukünftige Generationen sich köstlich über unsere Unfähigkeit amüsieren werden, diesen Roman einzuordnen. Und wahrscheinlich werden sie auch damit Unrecht behalten.
Dieses Buch, von dem sich Melville merkwürdigerweise einiges erhofft hatte, war ein grandioser Misserfolg und das vorläufige Ende seiner Karriere als Schriftsteller. Es wurde wenig gekauft, durchweg schlecht besprochen und schließlich zum Abenteuer- und Jugendbuch umgeschrieben. Erst nachdem die Moderne die erzählerische Tradition des 19. Jahrhunderts kräftig durchmischt hatte, konnte »Moby-Dick« entdeckt werden als das literarische Wagnis, das es gewesen war: die Geschichte von einem, der auszog in einem Meer von Wörtern ein literarisches Monstrum zu erlegen.
Erzählt, das dürfte wenigstens aus dem Fernsehen bekannt sein, wird die Geschichte des Kapitäns Ahab, der versucht, Rache an einem Wal zu nehmen, der ihm auf der letzten Walfang-Fahrt einen Unterschenkel amputiert hat. Der Erzähler Ishmael lässt keinen Zweifel daran, dass es sich bei Ahab um einen Wahnsinnigen handelt, der die Gemeinschaft an Bord des Walfängers Pequod auf einen irrationalen Rachefeldzug einschwört und sie auf diese Weise schließlich ins Verderben führt. Moby Dick (merkwürdigerweise schreibt Melville den Namen im Titel mit Bindestrich, im Text dann durchgehend ohne; auch dies ein ungehobenes Rätsel des Buches) wird nicht nur Ahab töten, er versenkt mit einem Rammstoß auch die Pequod mit Mann und Maus, und nur der Erzähler überlebt, auf einem Sarg treibend, die Katastrophe. Soweit im Groben die Abenteuergeschichte.
Für Melville und seinen Erzähler aber geht die Reise der Pequod weit über dieses Abenteuer hinaus: Nicht nur liefert Melville die erste panoramatische Darstellung der Walfangindustrie des 19. Jahrhunderts, nicht nur erhebt er den Anspruch, die cetologische Literatur seiner Zeit zu einer klärenden Gesamtschau zusammenzufassen, nicht nur will er aus seinem Walfänger die Bühne Shakespeares machen, die die Welt bedeutet, die Fahrt der Pequod in den Untergang ist ohne Zweifel auch eine spirituelle Reise zu den Abgründen des Menschen und seiner verzweifelten Stellung in der Welt. Und damit ist noch gar nicht von der Ebene der politischen Allegorie die Rede oder von der praktizierten Toleranz in Glaubens- und Rassefragen, die Mitte des 19. Jahrhunderts alles andere als selbstverständlich war.
Das Buch ist sprachlich chaotisch und formal so unförmig, wie ein an Land gespülter Wal:
Den lebenden Wal in seiner ganzen Majestät und Bedeutung kriegt man nur auf See in unergründlich tiefen Gewässern zu Gesicht; und in schwimmendem Zustand ist der Großteil von ihm der Sicht vorenthalten wie bei einem vom Stapel gelassenen Linienschiff; und es ist eine Sache, die für den sterblichen Menschen auf ewig unmöglich bleibt, ihn aus jenem Element mit ganzem Leib in die Luft emporzuhieven und solchermaßen all seine mächtigen Ausbauchungen und wallenden Erhebungen festzuhalten.
Melville war sich im Klaren darüber, dass er ein Risiko lief, dass »Moby-Dick« ein Buch sein würde, wie es die Welt zwischen zwei Buchdeckeln noch nicht erblickt hatte. Er hoffte, dass wenigstens die fortschrittlicheren seiner Zeitgenossen ihm auf diesem Weg würden ein weniges folgen können. Doch er war ihnen in seiner Jagd nach dem, was der Literatur möglich sein könnte, zu weit voraus.
So wahr mir Gott helfe, und auf meine Ehr, die Geschichte welche ich Euch erzählt, Gentleman, ist im Kern und in ihren wesentlichen Punkt wahr. Ich weiß, daß sie wahr ist; es geschah auf diesem Erdenrund; ich betrat das Schiff; ich kannte die Mannschaft […].
Es müssen noch ein paar Sätze zur Übersetzung gesagt werden: Bis vor acht Jahren lagen im Deutschen nur mehr oder weniger mangelhafte Übersetzungen des Buches vor, selbst wenn man einmal von den »für die heranreifende Jugend bearbeiteten« Ausgaben absieht. Die Übersetzer wussten es entweder besser als Melville, wie dieser Roman hätte geschrieben werden sollen, und griffen massiv in den Text ein, oder sie opferten zumindest auf dem Altar der Lesbarkeit und verflachten Melvilles vulkanische Sprache zu einer zumutbaren Einheitssauce, die sie zum halb verrotteten Wal servierten. Im Jahr 2004 erschienen dann gleich zwei Neu-Übersetzungen: die von Friedhelm Rathjen bei 2001 und die von Matthias Jendis bei Hanser (als Eröffnung einer Werkauswahl, die inzwischen ins Stocken geraten zu sein scheint). Der Text von Jendis verheimlichte nicht, dass es sich bei ihm um eine Bearbeitung der Rathjenschen Übersetzung handelte. Rathjen hatte seine Übersetzung nämlich im Auftrag des Hanser Verlages erstellt, doch der schließlich gefundene Herausgeber Daniel Göske war mit ihrer Radikalität nicht einverstanden. Nach langem Hin und Her einigten sich Übersetzer, Herausgeber und Verlag schließlich darauf, dass Friedhelm Rathjen die Rechte an seiner Fassung zurückerhalten und bei Hanser eine Bearbeitung dieser Übersetzung unter dem Namen des Bearbeiters erscheinen würde.
Im Endeffekt hat dies für den Leser den Vorteil, dass er sich seinen »Moby-Dick« heute aussuchen kann: Wer den ganzen Genuss des sprachlichen Abenteuers und der Gefahren und Stürme des Erzählens erleben will, greift zu Rathjens Text, wer seichtere und ruhigere Gewässer vorzieht, kauft die öligere Variante von Jendis. Wie sagte Friedhelm Rathjen jüngst bei anderer Gelegenheit so richtig: »Es gibt Bücher, von denen es gar nicht zu viele Übersetzungen geben kann.«
Herman Melville: Moby-Dick. Deutsch von Friedhelm Rathjen. Fischer Tb. 90195. Frankfurt/M.: Fischer, 42012. Broschur, 927 Seiten. 12,50 €.