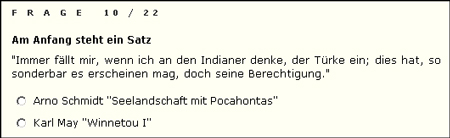What a book! Ian McEwan war mir bislang nur dem Namen und einigen Titeln nach geläufig, und ich will gleich vorweg betonen, dass mich die Dichte und Intensität dieses Buches überwältigt haben! »Abbitte« ist ein gewaltiges Buch, ein Buch der Reflexion, der Introspektion, der erlebten Rede. Die wenigen Figuren, die im Fokus stehen, sind von einer Einprägsamkeit und Schlüssigkeit, wie man sie nur selten findet. Die sparsame Handlung ist der Figurenpsychologie deutlich nachgeordnet, obwohl es gerade die ausgefeilte Anfangskonstellation ist, die die differenzierte psychologische Darstellung fundiert und überhaupt erst ermöglicht.
What a book! Ian McEwan war mir bislang nur dem Namen und einigen Titeln nach geläufig, und ich will gleich vorweg betonen, dass mich die Dichte und Intensität dieses Buches überwältigt haben! »Abbitte« ist ein gewaltiges Buch, ein Buch der Reflexion, der Introspektion, der erlebten Rede. Die wenigen Figuren, die im Fokus stehen, sind von einer Einprägsamkeit und Schlüssigkeit, wie man sie nur selten findet. Die sparsame Handlung ist der Figurenpsychologie deutlich nachgeordnet, obwohl es gerade die ausgefeilte Anfangskonstellation ist, die die differenzierte psychologische Darstellung fundiert und überhaupt erst ermöglicht.
Der Roman ist in drei Teile und einen Epilog gegliedert: Der erste Teil erzählt von einem einzigen Sommertag des Jahres 1935 auf dem Schloss der Familie Tallis. Anwesend sind außer der Hausherrin Emily Tallis ihre beiden Töchter Cecilia und Briony, 23 und 13 Jahre alt, Robbie Turner, der vom Hausherrn geförderte Sohn einer Bediensteten, sowie die Nichte Lola und zwei Neffen der Hausherrin. Im Laufe des Tages kommt noch Cecilias und Brionys Bruder Leon hinzu, der als Gast einen jungen, erfolgreichen Unternehmer, Paul Marshall, mitbringt. Der Hausherr befindet sich in London, wo ihn seine beruflichen Pflichten in einem Ministerium und eine Geliebte festhalten.
Die eigentliche Handlung des ersten Teils, der etwa die Hälfte des Romans umfasst, zusammenzufassen, fällt schwer, da er überaus reich an Perspektivwechseln und Mißverständnissen ist. Er ist in 13 Abschnitte gegliedert, die jeweils aus einer wechselnden personalen Perspektive erzählt sind. Wesentlich ist, dass sich an diesem Tag aus der Kinder- und Jugendfreundschaft zwischen Cecilia und Robbie eine leidenschaftliche Liebe entwickelt, was aufgrund einer Reihe von Zufällen, Mißverständnissen und Fehlleistungen in Briony den Eindruck wachruft, bei Robbie Turner handele es sich um einen »Psychopathen«, ohne dass sie eine genaue Vorstellung davon hat, was das bedeuten soll. Dieses Vorurteil, dessen Entstehung skrupulös nachgezeichnet wird, führt sie dazu, Robbie wenige Stunden später der Vergewaltigung ihrer Kusine Lola zu bezichtigen, obwohl sie sich schon zu diesem Zeitpunkt darüber im Klaren ist, dass sie den Täter im Dunkel der Nacht nicht wirklich erkannt hat.
Teil zwei spielt etwa fünf Jahre später: Robbie Turner ist nach dreieinhalb Jahren im Gefängnis in die Armee entlassen worden und befindet sich zusammen mit zwei Unteroffizieren auf der Flucht vor den deutschen Truppen Richtung Dünkirchen. Er ist verletzt, trägt einen Schrapnellsplitter in sich herum. Wir erfahren, dass sich Cecilia von ihrer Familie getrennt hat, in der Zeit, in der Robbie im Gefängnis war, Krankenschwester geworden ist und auf Robbies Rückkehr nach England wartet. Auch ihre Schwester Briony, die eigentlich Schriftstellerin hatte werden wollen, ist inzwischen in der Ausbildung zur Krankenschwester, und wir lesen in einem Brief Cecilias an Robbie, dass sich Briony inzwischen bewusst ist, was ihre Aussage angerichtet hat und sie sich auch sicher ist, wer der tatsächliche Vergewaltiger Lolas war. Der Abschnitt enthält eine intensive Schilderung der Flucht Robbies unter wiederholten Angriffen der deutschen Luftwaffe. Robbie und seine Begleiter erreichen zwar Dünkirchen, aber der Bericht wird zunehmend von den Fieberphantasien Robbies überlagert und bricht ab, bevor wir erfahren, ob Robbie lebend ausgeschifft wurde.
Teil drei berichtet über annähernd denselben Zeitraum wie Teil zwei, diesmal aus Brionys Sicht: Sie ist als Lehrschwester in einem Londoner Krankenhaus beschäftigt und muss die erste Welle verletzter Soldaten, die aus Frankreich herüberkommen, versorgen. Es sind diese Erfahrungen, die Briony endgültig erwachsen werden lassen und sie dazu bringen, sich der Verantwortung für ihre Lüge zu stellen. Am nächsten freien Tag besucht sie die Hochzeit ihrer Kusine Lola mit Paul Marshall und sucht anschließend ihre Schwester auf, die sie seit fünf Jahren nicht mehr gesprochen hat. Dort findet sie auch Robbie vor, der ihr aufträgt, ihre Eltern von ihrer Lüge in Kenntnis zu setzen, sie auch vor einem Notar zu bezeugen und ihm einen Brief zu schreiben, in dem sie ausführlich die Umstände schildert, die zu ihrer Lüge geführt haben. Nicht versöhnt, aber doch einander wieder angenähert, trennen sich Cecilia, Robbie und Briony auf dem Londoner U-Bahnhof Balham. Der Abschnitt schließt mit der Unterschrift:
BT
London 1999
Die weiteren Überraschungen, die der Epilog noch bereit hält, sollen hier nicht verraten werden.
Sowohl die intensiven Beschreibungen der Kriegsschrecken als auch die Figurenpsychologie zeichnen dieses Buch aus. Ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor so klare und zugleich detaillierte und stimmig entwickelte psychologische Portraits gleich mehrerer Figuren gelesen zu haben. Ohne Frage eines der letzten Meisterwerke des 20. Jahrhunderts!
Ian McEwan: Abbitte. Aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Zürich: Diogenes, 2002. Lizenzausgabe für die SPIEGEL-Edition: Hamburg, 2006. Pappband, 507 Seiten. 9,90 €.