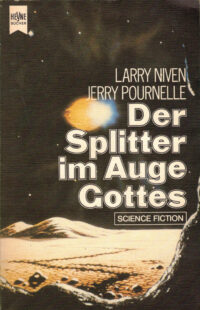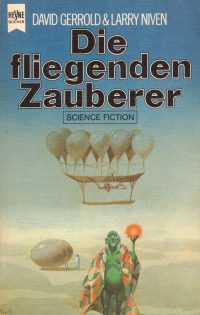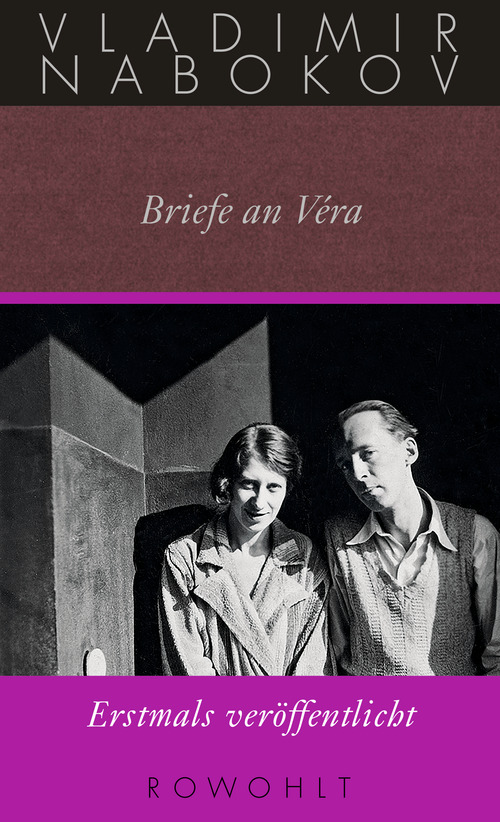Die ganze Befehlsgeberkaste ist zu Großen Narren geworden, nach meiner Meinung. Sie glauben, sie könnten den Lauf der Zyklen beenden, wenn sie in den Weltraum auswandern und andere Sonnensysteme besiedeln.
Ein weiterer Fund aus der zweiten Reihe: Ein Roman um die erste Begegnung der Menschheit mit einer außerirdischen Intelligenz zu Anfang des 4. Jahrtausends u. Z. Am Rande des Zweiten Galaktischen Imperiums taucht ein Raumschiff mit Lichtsegel auf, das offensichtlich vor langer Zeit von einem Sonnensystem gestartet wurde, das den Namen Der Splitter im Auge Gottes trägt. Aus ihm wird ein asymmetrisch gebautes Alien tot geborgen. Der Kaiser entschließt sich, zwei Kriegsschiffe mithilfe des von der Menschheit seit mehr als 1.000 Jahren benutzten Sprungantriebs zu diesem System zu senden. Dort findet man eine offensichtlich uralte Zivilisation vor, der es aber nie gelungen ist, ihr Sonnensystem zu verlassen, was in der Hauptsache daran liegt, dass das andere Ende des Sprungpunktes in ihrem System innerhalb einer Sonne endet und so alle Schiffe, die die Aliens auf diesen Weg gebracht haben, zerstört worden sind.
Die Menschen stoßen auf eine hoch technisierte Zivilisation, deren Träger sich in mehreren Unterarten entwickelt haben. Es gibt Meister, Vermittler, Techniker, Landarbeiter, Boten, Bastler und – sehr lange vor den Menschen verborgen – auch eine Kaste von Kriegern. Das eigentliche Problem dieser Zivilisation ist, dass die Aliens einen hormonellen Zyklus durchlaufen, indem Geschlechtswechsel und Schwangerschaften notwendig aufeinanderfolgen und der nur auf Kosten des individuellen Lebens unterbrochen werden kann. Es herrscht daher ein extremer Bevölkerungsdruck, der regelmäßig zu Kriegen und dem Zusammenbruch der Zivilisation führt. Der einzige Ausweg scheint zu sein, andere Planeten zu besiedeln, also das Splitter-Sonnensystem zu verlassen, was das Ziel der Aliens in den dem ersten Kontakt folgenden Verhandlungen ist. Anbieten können sie im Gegenzug eine Technologie, die in Teilen der der Menschheit weit überlegen ist. Die Autoren haben sich für den daraus entwickelten Konflikt ein überraschendes, wenn auch nicht sehr wahrscheinliches Ende ausgedacht.
Es handelt sich um einen ganz unterhaltsam geschriebenen Abenteuerroman, wenn auch besonders das letzte Viertel Längen aufweist, die allerdings auch dazu benutzt werden zu zeigen, dass sich die menschliche und außerirdische Zivilisation so sehr nicht unterscheiden. Die außerirdische Zivilisation ist sehr hübsch erfunden und – obwohl immer wieder das Gegenteil behauptet wird – letztlich durchaus verständlich konstruiert. Was mich bei der Wiederlektüre am meisten erstaunt hat, ist, dass dies offensichtlich einmal einer meiner Lieblingsromane war (das vorliegende Exemplar stammt aus dem Jahr 1983, ich habe das Buch aber ganz sicher zuerst in den 70-er Jahren gelesen), während ich es heute eher mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen habe: Ganz nett erfunden, aber zu lang und deutlich zu sehr auf ein eher konventionelles Lesepublikum hin geschrieben.
Larry Niven / Jerry Pournelle: Der Splitter im Auge Gottes. Übersetzt von Yoma Cap. Heyne SF 3531. München: Heyne, 61983. Broschur, 624 Seiten. Derzeit nur antiquarisch lieferbar.