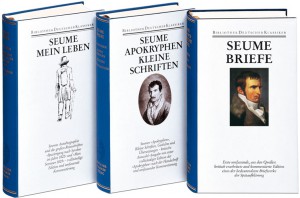Habent sua fata libelli.
1. Seume – Johann Gottfried Seume (1763–1810) ist einer von jenen Zeitgenossen Goethes mit einer Biographie von unten, wie Walter Jens das einmal genannt hat. Er wird daher heute normalerweise zusammen mit Karl Philipp Moritz und Ulrich Bräker in einer der kleineren Schubladen der Literaturgeschichte des ausgehenden 18., beginnenden 19. Jahrhunderts abgelegt. Seume war Sohn eines Landwirts und ehemaligen Böttchers, erwies sich als begabter Knabe, studierte zuerst Theologie an der Universität von Leipzig, machte sich noch als Student auf den Weg nach Paris, wurde aber von Zwangswerbern des Landgrafen von Hessen-Kassel aufgegriffen und zusammen mit zahlreichen Landeskindern als Soldat nach Amerika verkauft. Doch hatte er Glück im Unglück: Als er endlich in der Neuen Welt ankam, wurden seine Dienste als Soldat nicht mehr benötigt. Also schiffte man ihn wieder nach Deutschland ein, wo er umgehend aus hessischen Diensten desertierte, aber in der preußischen Armee landete, der er sich ebenfalls mehrfach durch Desertion zu entziehen suchte, was ihm eine Kerkerhaft eintrug. Erst 1789 gelingt es ihm, nach Leipzig zurückzukehren, diesmal um dort Jura, Philosophie und Geschichte zu studieren. Nach dem Studium gerät er über den Umweg einer Hofmeisterstelle wieder ins Militär, diesmal in die russische Armee, bis er 1796 endgültig ins Zivilleben zurückkehrt.
Seume arbeitet nun einige Jahre als Korrektor für den ehemals Leipziger, nun Grimmaschen Verleger Göschen, bevor er im Oktober 1801 zu einem längeren Spaziergang aufbricht, der ihn in gut zehn Monaten von Grimma aus nach Syrakus und wieder zurück bringen wird. Bereits im Jahr 1803 erscheint dann der umfangreiche Bericht zur Reise als Buch, wobei einiges von dem Material, noch während Seume unterwegs ist, in Wieland »Teutschem Merkur« zu lesen gewesen war. Das Buch ist ein so großer Erfolg, dass bereits nach einem knappen halben Jahr eine zweite Auflage nötig ist. Und dem ersten Reisebuch folgt ein zweites: Von April bis September 1805 unternimmt Seume eine Reise durch Polen, Russland, Finnland, Schweden und Dänemark, aus der dann nach nun bewährtem eigenen Vorbild im Jahr darauf das Buch »Mein Sommer 1805« hervorgeht. Der »Sommer« wird allerdings kein ähnlicher Verkaufserfolg wie der »Spaziergang«, er sorgt dafür in anderem Sinne für Furore, indem er kurz nach seinem Erscheinen in Russland, Österreich und Süddeutschland aufgrund der unverhohlen republikanischen Gesinnung seines Autors verboten wird. Das letzte große Prosabuch Seumes, die Autobiographie seines wechselvollen Lebens, bleibt Fragment, da Seume im Juni 1810 nur 47-jährig stirbt.
Dass Seumes vergleichsweise dünnes Werk es geschafft hat, den Zeitläuften bis heute zu trotzen, liegt wohl in der Hauptsache an einer seltenen Kombination von Eigenschaften: Seumes Neigung zu unverstellter Ehrlichkeit, seinem direkten und zugleich immer persönlichen Stil, der Komplexität seiner politischen Auffassung (um nicht Auffassungen zu schreiben) und nicht zuletzt seinem kantigen, wenig kompromissbereiten Charakter. Aus dieser Vielfalt konnten sich zahlreiche Interessengruppen des 19. Jahrhunderts immer das heraussuchen, was ihnen am besten in ihren Kram passte: Die einen lasen ihn als Vorläufer des Vormärz und deutschen Republikaner, den anderen war er ein deutscher Nationalist von echtem Schrot und Korn, den Dritten wieder war er ein individualistischer Querdenker, der eine spannungsreiche Alternative sowohl zur Weimarer Klassik als auch zur Jenaer Romantik lieferte. So beginnt Seumes Kanonisierung als Deutscher Klassiker bereits im 19. Jahrhundert, als seine Schriften in mehreren Gesamt- und Werkausgaben gleichrangig mit denen Goethes, Schillers, Shakespeares und anderer deutscher Nationalschriftsteller ediert werden.
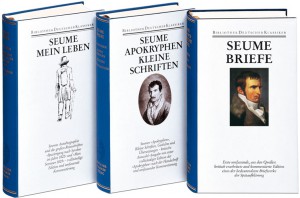
2. Sein Verlag – Damit sind hier weder Göschen noch Hartknoch gemeint, sondern der 1981 gegründete Deutsche Klassiker Verlag (DKV), dessen edelste und zugleich einzige Aufgabe darin bestand, die Bibliothek deutscher Klassiker (BdK) herauszubringen. Gegründet wurde er von Siegfried Unseld als Schwesterverlag zu Suhrkamp und Insel, und die BdK sollte wohl so etwas wie ein verlegerisches Denkmal für diesen etwas eitlen deutschen Verleger werden: Eine nach einheitlichen Kriterien und in einheitlicher Aufmachung erstellte, kanonische Sammlung dessen, was in der deutschen Literaturtradition gut und wichtig war und ist.
Da es bei großen Dingen bekanntlich genügt, sie gewollt zu haben, fiel auch die Größe dieses intellektuellen Gebirges weit bescheidener aus, als man es sich aus der Idee allein imaginieren würde: Zwar wurde eine halbwegs ansehnliche Auswahl mittelalterlicher Texte zusammengestellt, aber die deutschsprachige Literatur vom Beginn der Neuzeit bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ist wie üblich äußerst dünn repräsentiert. Erst mit Lessings Werken beginnt eine einigermaßen kanonisch-umfassende Präsentation wichtiger Autoren und Werke. Man bemerkt auch bei der Auswahl für das 18. und 19. Jahrhundert leicht, dass die BdK nicht viel anderes ist als eine Neuauflage eines sehr traditionellen und weitgehend unoriginellen Literaturkanons, wie man ihn ähnlich auch im 19. Jahrhundert schon kennt. Hier und da kann die Auswahl trotzdem überraschen:
- Herder etwa wird mit einer umfangreichen Ausgabe aufgenommen, obwohl er zwar zu den einflussreichsten, aber sicherlich nicht mehr zu den populären Weimarer Klassikern gehört.
- Novalis, der es als Vertreter der Romantik sicherlich verdient hätte, wenigstens in einer bedeutenden Auswahl präsentiert zu werden, fehlt.
- Dagegen würdigt man Bettine von Arnim gleich mit vier Bänden und den doch etwas randständigen, eher für Germanisten und Historiker interessanten Karl August Varnhagen von Ense (dessen »Denkwürdigkeiten« zu edieren zweifellos eine Großtat war) gleich mit fünf Bänden. (Witzigerweise kommt die Vanhagen-von-Ense-Ausgabe im sogenannten Gesamtverzeichnis des Deutschen Klassiker Verlages 2008/2009 überhaupt nicht vor. Vielleicht weiß beim Verlag inzwischen niemand mehr, dass man das einstmals gedruckt hat.)
- Heine fehlt, obwohl er sicherlich weit bedeutender und einflussreicher ist als etwa Gottfried Keller (ohne damit etwas gegen Keller als Schriftsteller sagen zu wollen).
- Grillparzer ist vorgesehen, nicht aber Grabbe oder Hebbel.
Damit sind wir bei den Schwächen der Realisierung des ambitionierten Projekts angekommen. Zahlreiche der angefangenen Ausgaben wurden nicht abgeschlossen: Wieland bleibt ein Fragment (drei Bände erscheinen), ebenso Tieck (fünf Bände) und Grillparzer (zwei Bände); bei der Kant-Ausgabe blamiert man sich komplett, da man nicht nur falsch einschätzt, dass kein Mensch Kant in einer Ausgabe des DKV lesen, geschweige denn zitieren wird, so dass man dieses Seitenstück nach dem einzigen erschienenen Band einfach für abgeschlossen erklärt. Und natürlich sind auch die tatsächlich abgeschlossenen Ausgaben durchaus nicht auf einem einheitlichen Niveau: Während etwa die Herausgeber der Kleist-Ausgabe bei ihrem Kommentar offenbar davon ausgehen, dass Kleist in der Hauptsache von Sechstklässlern gelesen wird, scheint der Herausgeber der Hölderlin-Ausgabe zu der Ansicht gekommen zu sein, es handele sich bei dem von ihm kommentierten Autor um einen Verfasser literarischer Rätsel – jedenfalls gleicht sein Kommentar einem Lösungsteil und sollte in zukünftigen Ausgaben daher besser auf dem Kopf stehend gedruckt werden.
Natürlich ist nicht alles schlecht: Zur Herder-Ausgabe gibt es keine rezente Alternative; die Lessing-Ausgabe überzeugt auch und besonders durch die Briefsammlung und auch die E.T.A.-Hoffmann-Ausgabe weiß zu gefallen. Hinzukommt, dass die Ausstattung der Leinen- bzw. Lederbände mit Fadenheftung, je zwei Lesebändchen und gutem Dünndruckpapier überzeugt. Im Bücherschrank machen sich die Bände gut, und auch in der Hand liegen sie so, wie das sein soll. Typographisch ist eine solche Massenausgabe (Masse nur, was die Menge der Texte angeht, nicht im Sinne der potenziellen Käuferschicht) natürlich immer ein Kompromiss, aber auch das ist mehr als annehmbar gelöst worden.
Aus all diesen Gründen habe ich zur BdK immer eine gewisse Hass-Liebe gehegt: Man hätte so vieles an ihr besser machen können, aber andererseits muss man angesichts des Umfangs und dessen, was gewollt wurde, zugestehen, dass es auch viel schlimmer hätte kommen können.
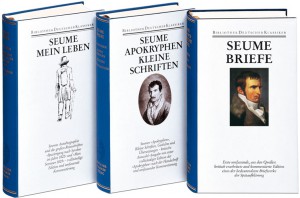
3. Einer seiner Leser – Das alles steht hier aus einem ganz konkreten Anlass: Vor zwei Jahren hatte ich mich endlich entschlossen, mir für eine unbestimmte Zukunft endlich doch die Herder-Ausgabe des DKV zuzulegen: Mein Buchhändler – Gott schütze das Gewerbe! – war so nett, mir die Bände zu liefern und mir zu erlauben, sie in monatlichen Raten abzustottern. Als wir damit fertig waren, hatte ich mich inzwischen entschlossen, noch ein paar andere Ausgaben zu kaufen, besonders weil mir klar war, dass sich das Lager des DKV in absehbarer Zeit sehr lichten und ich mich vielleicht doch am Ende ärgern würde, wenn ich die wenigen, für mich noch interessanten Ausgaben nicht gekauft hätte.
Also gab ich noch einmal eine Bestellung für eine umfangreichere und zwei der kleineren Ausgaben auf. Darunter auch die Seume-Auswahl, die drei Bände umfasst: Band 1 bringt die drei großen und mehr oder weniger bekannten autobiographischen Texte, Band 2 eine Auswahl der Kleineren Schriften und Gedichte und Band 3 schließlich eine Sammlung von Briefen Seumes, die die eigentliche Perle der Ausgabe ist. Wahrscheinlich um im Lager endlich Platz zu schaffen, gab es seit einiger Zeit alle drei Bände zum Gesamtpreis von 128 €, was etwa 65 % des ursprünglichen Preises entspricht. Nun ließ sich an der Ausgabe durchaus einiges aussetzen: Das wissenschaftliche Renommee des Herausgebers wird wohl am besten dadurch charakterisiert, dass die Titanic ihn einst Jörg »Professor« Drews genannt hat, die Auswahl der Kleineren Schriften fällt eher dürftig aus und die drei Texte des ersten Bandes standen natürlich längst in akzeptablen Ausgaben im Bücherschrank. Andererseits kostete der Band 3 mit den Briefen allein schon 80 €, so dass man die Bände 1 und 2 zum reduzierten Preis beinahe geschenkt bekam. Daher wurde die Ausgabe mitbestellt.
Als mein Buchhändler dann im vergangenen Januar mit dem Verlagsvertreter zusammensaß, schüttelte der bedenklich den Kopf: Die Seume-Ausgabe sei leider derzeit nicht lieferbar, da Band 1 fehle. Aber angesichts der doch nicht unerheblichen Gesamtbestellung griff er zum Telefon, fragte beim Verlag nach und erhielt die Auskunft: Band 1 werde in jedem Fall entweder im März oder im Mai nachgedruckt und die Ausgabe zu dem günstigen Preis wieder angeboten. Unter dieser Voraussetzung bestellte mein Buchhändler für mich. Als mir das erzählt wurde, gab ich zu Bedenken, dass derzeit noch ein einzelnes, neues Exemplar bei Amazon lieferbar sei und ich mich ärgern würde, wenn sich die Zusicherung von Suhrkamp als falsch erwiese. Doch mein Buchhändler war optimistisch, und so blieb es dabei.
Als im Juni dann von der Seume-Ausgabe immer noch nichts zu sehen war, fragte mein Buchhändler beim Verlag nach, bei genau jenem Mitarbeiter, der im Januar den Nachdruck von Band 1 fest zugesagt hatte. Er erhielt daraufhin per E-Mail die Auskunft, dass der Band 1 nicht mehr nachgedruckt werde, dass überhaupt mit dem Erscheinen der Register-Bände der Goethe-Ausgabe (ein tragikomisches Stück deutscher Editionskunst für sich) die Produktion des DKV zum Ende gekommen sei. Die jetzt fragmentarischen Ausgaben würden nicht mehr vervollständigt; auch weitere Taschenbuch-Ausgaben würden nicht mehr hergestellt. Man könne ersatzweise Band 2 und 3 der Seume-Ausgabe zum reduzierten Preis und Band 1 in der Leder-Ausgabe zum Preis bei Abnahme der Gesamtedition liefern, was zusammen allerdings noch deutlich über dem ursprünglichen Gesamtpreis der Leinenausgabe gelegen hätte, den ich ja schon nicht hatte zahlen wollen. Und das einzige, im Januar noch lieferbare Exemplar bei Amazon war natürlich auch längst verkauft.
Ich habe dann den Fehler begangen, den Mitarbeiter bei Suhrkamp selbst anzurufen, anstatt meinen Buchhändler alles Weitere regeln zu lassen. Der Mann war von meinem Anruf alles andere als begeistert, meinte dass er den Band 1 nicht habe und daher auch nicht liefern könne und auch bei der entsprechenden Lederausgabe könne er mir preislich nicht weiter entgegenkommen. Ich war – bei allem Verständnis für die schwierige Lage des Verlags – alles andere als begeistert davon, dass er sich bei einem durchaus guten Kunden nicht einmal dafür entschuldigte, dass er im Januar den Nachdruck noch fest zugesagt hatte und das nun alles nicht mehr stimmen sollte. Er beendete das Gespräch dann mit der Vertröstung, dass er einmal schauen wolle, was er für mich noch tun könne und dass er sich noch einmal melden würde.
So weit, so schlecht. Dass ich mich abgewimmelt fühlte und nicht mehr daran glaubte, noch etwas von Suhrkamp zu hören, versteht sich von selbst. Doch als mein Buchhändler vierzehn Tage später nachfragte, ob sich in der Sache denn noch etwas getan habe, bekam er die überraschende Auskunft, Suhrkamp werde die Ausgabe wie bestellt liefern. Der Mitarbeiter von Suhrkamp hatte sich die Mühe gemacht, ein einzelnes Exemplar der Leinenausgabe des ersten Bandes in einer Lieferung von Remittendenexemplaren ausfindig zu machen, die an einen Berliner Buchhändler verkauft worden war. Er hat den Buchhändler angerufen, der den Band herausgesucht und zurückgelegt hat, ist persönlich dort vorbeigegangen und hat das Buch für mich dort abgeholt. Seit Dienstag bin ich nun im Besitz eines vollständigen, neuwertigen Exemplars der Seume-Ausgabe zum versprochenen Preis.
Eigentlich wollte ich mich hier nur kurz bedanken! Das war außergewöhnlich nett von ihm und ich werde, immer wenn ich eines der Bücher zur Hand nehme, an ihn und daran denken, wie die Bände in mein Regal gelangt sind!
- Johann Gottfried Seume: Werke in zwei Bänden. Hg. v. Jörg Drews. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1993. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 1101 u. 927 Seiten. Nur noch Band 2 lieferbar: 76,– € bei Einzelbezug.
- Derselbe: Briefe. Hg. v. Jörg Drews und Dirk Sangmeister. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag, 2002. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 1135 Seiten. 80,– € bei Einzelbezug.
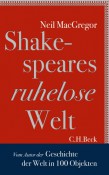 Neil MacGregor ist der Direktor des Britischen Museums und hat im Jahr 2011 mit seiner Kulturgeschichte „Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“ einen internationalen Bestseller geschrieben, die die Entwicklung der Zivilisation anhand ausgesuchter Artefakte aus dem Bestand des Museums nacherzählte. In ähnlicher Weise aufgebaut folgt nun ein Buch zur Zeit und der Welt Shakespeares, also der Jahrzehnte um die Jahrhundertwende vom 16. zum 17. Jahrhundert.
Neil MacGregor ist der Direktor des Britischen Museums und hat im Jahr 2011 mit seiner Kulturgeschichte „Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“ einen internationalen Bestseller geschrieben, die die Entwicklung der Zivilisation anhand ausgesuchter Artefakte aus dem Bestand des Museums nacherzählte. In ähnlicher Weise aufgebaut folgt nun ein Buch zur Zeit und der Welt Shakespeares, also der Jahrzehnte um die Jahrhundertwende vom 16. zum 17. Jahrhundert.