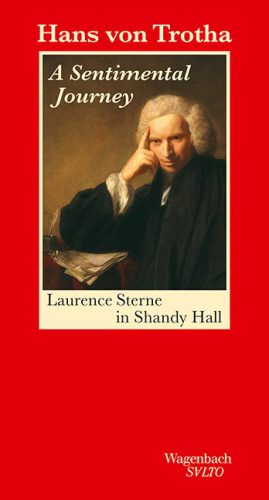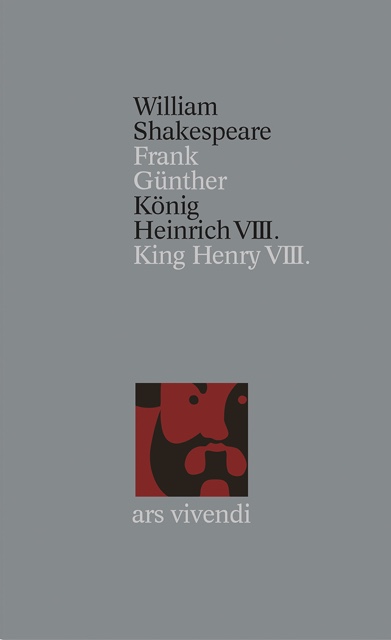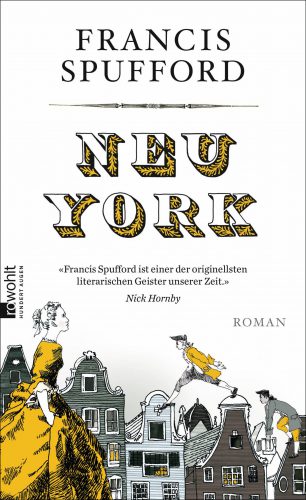Die schiere Existenz dieser Idee war ein unwiderlegbarer Beweis, dass sie den Tatsachen entsprach.

Frankensteins Monster, das so häufig direkt mit dem Namen seines Schöpfers identifiziert wird, ist eine der Ikonen des Schauders der wissenschaftlichen Laien angesichts der Errungenschaften der modernen Wissenschaft. Sein Schöpfer, Victor Frankenstein (kein „Baron“, kein „von“, kein „Dr.“!), steht stellvertretend für die Hybris der modernen Wissenschaft, die sich von ihren eigenen Schöpfungen verfolgt sieht, nachdem sie sie in die Welt entlassen hat. Natürlich ist das alles nur in den Köpfen der wissenschaftlichen Laien und der Naiven, Idealisten und Gutmenschen so, während die Wissenschaftler ihre objektive Distanz bewahren und die Dinge auch weiterhin so sehen, wie sie wirklich sind.
Nachdem wir auf diese Weise sowohl die metaphysisch als auch die wissenschaftstheoretisch relevanten Zugriffe auf den Stoff erledigt haben, wenden wir uns dem Buch zu: Manesse legt in einer überarbeiteten Übersetzung die Urfassung von Mary Shelleys berühmtem Roman Frankenstein aus dem Jahr 1818 vor. Die Unterschiede zur späteren Überarbeitung von 1831 sind nicht besonders gewichtig, nehmen dem Buch aber die eine oder andere autobiographische, satirische oder kritische Spitze. Dem Interessierten werden die wichtigsten Differenzen zwischen den beiden Versionen in den Anmerkungen zum Text ausreichend erläutert.
Mary Shelley selbst betont in ihrem Vorwort, dass der Roman aus einer Laune heraus entstanden ist: Sie verbrachte zusammen mit ihrem Mann, Lord Byron und Dr. Polidori einige regnerische Tage in der Gegend um Genf. Zur Unterhaltung las man gemeinsam eine Sammlung deutscher Schauergeschichten, die ins Französische übersetzt worden war. Man unterhielt sich mit den und über die Erzählungen und beschloss, jede und jeder einen Beitrag zum Genre zu liefern. Ganz und gar abgeschlossen wurde wohl nur der Roman von Mary Shelley, der spielerisch und um der schauerlichen Wirkung willen einige Themen der zeitgenössischen Wissenschaft aufnimmt und zur Gothic Novel umdichtet.
Der Roman beginnt mit einer Rahmenerzählung um den englischen Abenteurer Robert Walton, der sich auf einer Expedition zum Nordpol befindet, als er eines Tages den abgemagerten und kranken Victor Frankenstein von einer Eisscholle aufliest. Nach einigem Zögern erzählt Frankenstein seinem Retter seine Lebensgeschichte, die dieser aufzeichnet und seiner Schwester in England zusendet. Im Zentrum dieser ersten Binnenerzählung steht, wie schon angedeutet, ein übergeschnappter Wissenschaftler, der aus der Hybris seiner jugendlichen Genialität heraus den Entschluss fasst, das Unmögliche möglich zu machen und Leben aus leblosem Stoff zu erschaffen. Angesichts der damit verbundenen Schwierigkeiten der mikroskopischen Chirurgie fällt sein erstes und einziges Musterstück etwas grob aus, so dass selbst sein Schöpfer sich der spontanen Bezeichnung Monster nicht enthalten kann. Das namenlose Monster entflieht, nachdem es einmal zum Leben erwacht ist, dem Labor seines Schöpfers, der sich angesichts des eigenen Grauens vor seiner Kreatur ins Bett zurückgezogen hat. Als er wieder erwacht und das Monster entflohen findet, versucht er zur Tagesordnung überzugehen.
Von seiner um ihn besorgten Familie ins heimatliche Genf zurückgerufen, findet er bei seiner Rückkehr seinen jüngsten Bruder William ermordet und ein Hausmädchen der Familie des Verbrechens angeklagt. Da er aber in der Nacht seiner Ankunft das Monster in der Nähe des Tatorts gesehen zu haben glaubt, steht für ihn fest, dass er sich selbst die Schuld am Tod seines Bruders und der Verurteilung und Hinrichtung des unschuldig verdächtigten Mädchens zuschreiben muss. Um der Depression, die sich aus diesem Schuldgefühl ergibt, gegenzusteuern, unternimmt die Familie Frankenstein einen Ausflug nach Chamonix. Dort wird Victor bei einer Gletscherwanderung von seiner Kreatur gestellt, die ihm in einer weiteren ausführlichen und seitenschindenden Binnenerzählung ihr Leben nach der Flucht aus dem Laboratorium erzählt. Nach einigem Umherirren wird er zum versteckten Beobachter einer Familie, deren Schicksale nun in einer dritten Binnenerzählung eingeholt werden, die aber gänzlich unerheblich für den Roman ist und nur als eine schlecht erfundene Ausrede dafür herhalten muss, wie das Monster zu seiner intellektuellen und ethischen Erziehung kommt, die es nun befähigt, seinem Schöpfer mit einer Forderung entgegenzutreten: Er will eine Gefährtin erschaffen haben, ein Objekt und Subjekt der Liebe, die er in sich fühlt, aber nicht leben kann, da alle Menschen nur mit Entsetzen auf seine Erscheinung reagieren.
Bedroht von seiner Kreatur, die er zugleich bemitleidet, und beeinflusst von seiner Sorge um seine Familie, die das Monster mit Mord und Totschlag bedroht, stimmt Frankenstein zu, dem Monster eine solche Gefährtin an die Seite zu stellen. Er reist zu diesem Zweck mit seinem Jugendfreund Henry Clerval zuerst nach London und von dort weiter nach Schottland. Dort zieht er sich auf eine der Orkneyinseln zurück, um die zweite Kreatur zu erschaffen. Doch dann besinnt er sich eines anderen gerade in dem Moment, als ihn das Monster auf der Insel aufsucht. Frankenstein verweigert sich nun der Forderung seiner Kreatur, die ihm daraufhin droht, ihn in seiner Hochzeitsnacht wieder aufzusuchen. Das Monster flieht, ermordet unterwegs noch rasch Henry Clerval, ein Mord, der diesmal Victor Frankenstein zur Last gelegt wird, der aber auf wundersame und gänzlich unglaubhafte Weise von dem Verdacht rein gewaschen wird. Es lohnt nicht, die Geschichte noch weiter nachzuerzählen; es endet jedenfalls damit, dass Frankenstein sich selbst zur Jagd auf seine Kreatur verpflichtet und auf diesem Wege im Nordmeer endet, wo er von Robert Walton aufgelesen wird, der seine Lebensgeschichte aufzeichnet und wohl auch für ihre Publikation nach dem Tod des Monsterschöpfers Sorge getragen haben wird.
Sieht man von seiner ungeheuerlichen Berühmtheit und Ungelesenheit ab, so muss der Roman wohl leider als ziemlich miserabel bezeichnet werden. Nahezu alle seine Aspekte sind schlecht konstruiert und unglaubwürdig, an viel zu vielen Stellen merkt man, dass sich die Autorin nur etwas zusammenreimt, ohne auch nur eine geringe Ahnung davon zu haben, wie das, was sie beschreibt, ins Werk gesetzt werden oder auch schlicht nur geschehen sollte. Je tiefer die Binnenerzählungen geschachtelt sind, desto einfältiger und schematischer werden sie. Die Gespräche zwischen der Kreatur und ihrem Schöpfer sind so voller Plattitüden, dass es nur als unfreiwillige Ironie aufgefasst werden kann, dass gerade sie von Victor Frankenstein selbst „korrigiert und verbessert“ worden sein sollen, „hauptsächlich um die Gespräche zwischen ihm und seinem Widersacher lebhafter und geistreicher zu gestalten“. Und was soll man zu einem Buch sagen, das ernsthaft Sätze wie die folgenden enthält:
Landwirte führen ein über aus gesundes Leben, und es ist der am wenigsten schädliche oder eher der zuträglichste aller Berufe.
Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass noch nicht alles überstanden war und dass es abermals ein abnormes Verbrechen verüben würde, dessen Ungeheuerlichkeit die Erinnerungen an das vorherige womöglich gar in den Schatten stellte.
Ach! Victor, wenn Lüge der Wahrheit doch so ähnlich ist, wer kann sich dann noch seines Glücks sicher sein? Mir ist, als ginge ich am Rand eines Abgrunds entlang, an dem sich Tausende versammeln und mich in die Tiefe zu stoßen versuchen.
Auch ich begriff zum ersten Mal, welche Pflichten ein Schöpfer gegenüber seinem Geschöpf hat und dass ich für sein Glück sorgen sollte, bevor ich seine Bosheit beklagte.
Verzagen sie nicht. Keine Freunde zu haben ist wirklich ein großes Unglück. Doch die Herzen der Menschen sind voll brüderlicher Liebe und Güte, wenn sie nicht gerade wegen ihrer eigenen naheliegenden Interessen Vorurteile hegen.
Solche Lebensweisheiten und -einsichten sind leider omnipräsent im gesamten Text. Und das hat sich auch mit der späteren Fassung nicht geändert.
Wer das Genre schätzt, findet hier natürlich einen der ganz großen Klassiker, der die Quelle noch zahlloser Romane des 19. und 20. Jahrhunderts werden sollte. Wer das Genre historisch liest, nimmt das Buch achselzuckend zur Kenntnis als ein Beispiel für einen schwachen Text einer mäßig begabten Autorin, die aufgrund der Tatsache, dass sie zufällig und mehr schlecht als recht eine der mythologischen Unterströmungen unserer Kultur getroffen hat, einen Bestseller und Klassiker landen konnte. Manchmal hilft die Nutzung einer Wünschelrute eben doch.
Mary Shelley: Frankenstein oder Der moderne Prometheus. Urfassung von 1818. Aus dem Englischen von Alexander Pechmann. München: Manesse, 2017. Geprägter Pappband, Fadenheftung, Lesebändchen, 464 Seiten. 22,– €.