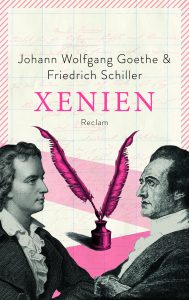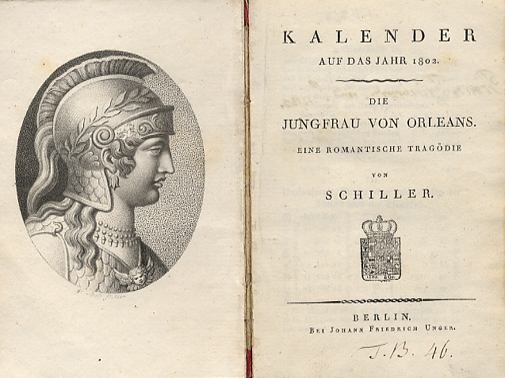Als 1794 die Zusammenarbeit Goethes und Schillers beginnt, befinden sich beide in einer Art von Isolation vom und Opposition zum literarischen Leben der Zeit: Schiller hatte drei Jahre lang von einem Stipendium gelebt und suchte im Anschluss daran nun eine Möglichkeit, seine Familie und sich mit der Herausgabe einer anspruchsvollen literarischen Zeitschrift – Die Horen – zu finanzieren, stand aber in einer gewissen Spannung zu der jungen Generation von Schriftstellern, die gerade in Mode war. Auch hatte er selbst zuletzt neben einem historischen Werk hauptsächlich theoretische Texte zur Literatur veröffentlicht. Sein Ruhm als einer der jungen Feuerköpfe der Literatur gehörte inzwischen der Vergangenheit an. Von daher war der in der Nachbarschaft lebende Goethe, dem ebenfalls der Ruf anhaftete, eine gewesenes Genie zu sein, eine natürliche Wahl als Mitstreiter für das neue Projekt. Auch Goethe hatte nach seiner Rückkehr aus Italien Schwierigkeiten, wieder ans gesellschaftliche und literarische Leben anzuknüpfen. Es ist daher nur zu verständlich, dass er sich für Schillers Vorschlag zur Mitarbeit an den Horen begeistern konnte: Es bestand die Aussicht, auf diesem Weg wieder innovative Akzente setzen und sich damit zurück in die literarische Diskussion der Zeit bringen zu können.
Diese Interessengemeinschaft wird im Laufe des Jahres 1795 zu einer Art Kampfbündnis und schließlich zu der Arbeitsgemeinschaft, über deren mehr als zehnjähriges Bestehen dann der Briefwechsel eine so umfassende Dokumentation liefern wird. Als erstes echtes Gemeinschaftsprojekt entstehen ab Dezember 1795 während eines knappen Jahres etwa 1.000 Distichen („Im Hexameter zieht der ästhetische Dudelsack Wind ein; [/] Im Pentameter drauf läßt er ihn wieder heraus“ wird Matthias Claudius spöttisch dichten), zuerst als satirische Kurzkritiken anderer Zeitschriften vorgeschlagen, dann aber zu einem Rundumschlag werdend gegen Schriftsteller und andere Zeitgenossen, literarische Tendenzen und Moden, poetologische Theorien und schließlich beinahe alles und jedes.
Peterskirche
Suchst Du das Unermeßliche hier? Du hast dich geirret,
537
Meine Größe ist die, größer zu machen dich selbst.
Die Zusammenarbeit ist dabei so eng, dass sich bei zahlreichen dieser sogenannten Xenien (wörtlich: „Gastgeschenke“, nach den Epigrammen Martials) auch heute nicht bestimmen lässt, wer der eigentliche Autor der einzelnen Verse ist. So werden die Xenien für gewöhnlich vollständig sowohl in die Werke Goethes als auch Schillers eingereiht.
Die Xenien waren übrigens ein vollständiger Erfolg, was ihre Wirkung angeht: Sie waren der literarische Skandal der Jahreswende 1796/1797, nachdem 400 von ihnen anonym bei Cotta im Musen-Almanach für das Jahr 1797 erschienen waren. Es fühlten sich über den Kreis der Gemeinten hinaus zahlreiche andere Autoren getroffen und das allgemeine Palaver war vollkommen. Die beiden Weimarer Klassiker hatte einmal mehr bewiesen, dass sie noch dazu in der Lage waren, die literarische Welt aufzumischen.
Die jetzt von Reclam vorgelegte Ausgabe ist leider eine Enttäuschung: Nicht nur enthält sie nur eine Auswahl der Xenien, sondern sie bringt auch nur eine minimale Kommentierung dieser Texte, die bereits für die Zeitgenossen nicht immer leicht zu entschlüsseln waren. Das knappe Nachwort ist zwar inhaltlich untadelig, schafft es aber auf dem wenigen Raum, den es einnimmt, problemlos, sich zu wiederholen. Hier hätte man sich eine dem heutigen Leser weiter entgegenkommende Aufbereitung dieser oft kryptischen Verse gewünscht. Auch ist die vorgenommene Auswahl zwar durchaus nachvollziehbar, aber was einer vollständigen Ausgabe entgegensteht, will sich wenigstens mir auf Anhieb nicht eröffnen: Wenn sich schon jemand für die Xenien interessiert und sie nicht ohnehin als Teil eines umfassenden Werkausgabe besitzt, warum sollte der nicht eine vollständige und umfangreich kommentierte Ausgabe wünschen statt dieser konsequenten Halbheit? Am Preis kann es in diesem Fall wirklich nicht liegen.
Johann Wolfgang Goethe / Friedrich Schiller: Xenien. Eine Auswahl. Hg. v. Frieder von Ammon u. Marcel Lepper. RUB 14250. Stuttgart: Reclam, 2022. Broschur, 96 Seiten. 6,– €.