 Bernhard Schlink war mit »Der Vorleser« das kleine Wunder eines Weltbestsellers gelungen. Nachdem er 2001 seine Trilogie um den Detektiv Gerhard Selb abgeschlossen hatte, legt er nun seinen neuen Roman vor: »Die Heimkehr« ist ein vielschichtiger und komplexer Roman über die Suche eines Sohns nach seinem Vater.
Bernhard Schlink war mit »Der Vorleser« das kleine Wunder eines Weltbestsellers gelungen. Nachdem er 2001 seine Trilogie um den Detektiv Gerhard Selb abgeschlossen hatte, legt er nun seinen neuen Roman vor: »Die Heimkehr« ist ein vielschichtiger und komplexer Roman über die Suche eines Sohns nach seinem Vater.
Erzählt wird das Buch vom Ich-Erzähler Peter Debauer, der zu Anfang von seinen glücklichen und harmonischen Ferientagen bei seinen Großeltern väterlicherseits erzählt. Sein Vater, so glaubt Peter Debauer, ist im Zweiten Weltkrieg noch vor der Geburt seines Sohnes gestorben. Peter Debauer lebt mit seiner Mutter in Deutschland und besucht in den Sommerferien stets seine Großeltern in der Schweiz. Weil seine Großeltern für einen Verlag arbeiten, bekommt Peter mehr zufällig Druckfahnen eines Romans an die Hand, der von der Flucht einer Gruppe von deutschen Soldaten von Sibirien nach Deutschland erzählt. Der Roman fasziniert ihn, aber die Fahnen, deren Rückseiten Peter als Schmierpapier benutzt, enthalten schon nicht mehr das Ende des Romans. Viele Jahre nach der ersten Lektüre dieses Romans macht sich Peter Debauer auf die Suche nach dem Autor und gerät dabei zugleich immer mehr auch in eine Suche nach seinem Vater hinein, der in Wahrheit eine ganz andere Geschichte hat, als Peter sie von seiner Mutter erzählt bekommen hat. Ich will nicht zuviel von den zahlreichen Verwicklungen und Überraschungen der Romans verraten.
Das Buch ist in dem schon aus seinen früheren Texten bekannten ruhigen und gelassenen Stil Schlinks verfasst. Schriftstellerische Aufgeregtheit ist Schlink wesentlich fremd. Seine Geschichte ist auch diesmal sorgfältig durchkonstruiert und literarisch reichhaltig unterfüttert. Mir persönlich hilft zwar dem Protagonisten ein wenig zu oft ein glücklicher Zufall auf den richtigen Weg, aber so etwas ist oft nur eine Frage des Geschmacks und mag andere Leser gar nicht weiter stören.
Allerdings erschöpft sich das Buch nicht im Erzählen der durchaus verwickelten Handlung, sondern auf einer zweiten Ebene verhandelt Schlink einmal mehr seine Lieblingsthemen: Die Nachwirkungen und die Nachgeschichte des Nationalsozialismus und die Frage nach der Gerechtigkeit. Dabei geht es besonders zum Ende des vierten und im fünften Teil durchaus anspruchsvoll zur Sache, wobei allerdings gefragt werden kann, ob es nicht mehr beim Anspruch bleibt als dass es zur Erfüllung dieses Anspruchs kommt. Da spielt zum Beispiel die Philosophie des Dekonstruktivismus eine nicht unbedeutende Rolle. Nun ist dem Autor durchaus klar, dass ein Großteil seiner potentiellen Leser mit dem Wort wenig werden anfangen können und will ihnen deshalb ein wenig Hilfestellung leisten:
Dekonstruktivismus bedeutet Ablösung des Texts von dem, was der Autor mit ihm gemeint hat, und Auflösung in das, was der Leser aus ihm macht; er geht sogar weiter und kennt keine Wirklichkeit, sondern nur die Texte, die wir über sie schreiben und lesen.
Das ist nicht falsch, aber es besagt so zusammenhanglos, wie es auch im Buch stehen bleibt, wenig und ist am Ende nur eine philosophische Klippschuldefinition. Dabei ist – wie gesagt – das Thema Dekonstruktivismus nicht nur eine intellektuelle Verzierung des Romans, sondern gehört zum gedanklichen Kernbestand dessen, worum es Peter Debauer und seinem Autor geht: Um die Frage nämlich, ob und in welcher Form das Böse, das im Nationalsozialismus in fürchterlichster Form in Erscheinung tritt, heute noch immer wirksam ist und in einem »modernen intellektuellen Faschismus« fortsetzt wird. Und ob und wie sich die Generation der Söhne von den Theorien der Väter absetzen kann, ohne dass es ihnen gelingt, die Kernfrage nach dem Verhältnis von Gut und Böse auch nur annähernd zu beantworten.
Gerade in seinem denkerischen Kern bleibt das Buch halbherzig: Auf der einen Seite will es ein ernstes und anspruchsvolles Thema transportieren, auf der anderen Seite traut es sich nicht, seinen Lesern den dazu notwendigen Aufwand an gedanklicher Differenzierung und Theorie tatsächlich zuzumuten. Es will sein Thema einerseits nicht auf Kosten der Wahrhaftigkeit popularisieren, andererseits die Romanhandlung nicht durch langatmige theoretische Exkurse überfrachten. Und so fürchte ich, dass am Ende viele Leser Schlinks unbefriedigt bleiben: Diejenigen, denen diese Ebene letztlich unzugänglich bleibt, stehen ein wenig ratlos vor den letzten 110 Seiten, und diejenigen, die an der Auseinandersetzung teilnehmen könnten und wollten, sind enttäuscht, weil das Buch nirgends wirklich ein Niveau erreicht, auf dem es über intellektuelle Banalitäten hinausgelangen würde. Und so ist das Buch – je nach Perspektive – entweder 150 Seiten zu lang oder 700 Seiten zu kurz geraten.
Bernhard Schlink: Die Heimkehr. Diogenes Verlag, 2006. Leinen; 375 Seiten. 19,90 €.
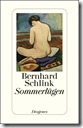 Männer lügen. Sie lügen, weil es bequem ist, weil sie glauben, damit durchzukommen, weil sie emotional distanziert oder auch weil sie geile Trottel sind. Trottel sind sie auf jeden Fall. Hier und dann lügt auch einmal eine Frau, aber wahrscheinlich ist es nur eine Alibi-Lüge oder eine Quoten-Lüge, damit der Autor nicht in den Verdacht gerate, er schreibe genau den Unfug, den er schreibt.
Männer lügen. Sie lügen, weil es bequem ist, weil sie glauben, damit durchzukommen, weil sie emotional distanziert oder auch weil sie geile Trottel sind. Trottel sind sie auf jeden Fall. Hier und dann lügt auch einmal eine Frau, aber wahrscheinlich ist es nur eine Alibi-Lüge oder eine Quoten-Lüge, damit der Autor nicht in den Verdacht gerate, er schreibe genau den Unfug, den er schreibt.
