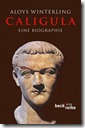Ein kurzer Überblick über die Zeit von Beginn der europäischen Zivilisation auf Kreta bis zum Übergang der archaischen Periode zur klassischen Antike. Der im vergangenen Jahr verstorbene Althistoriker Karl-Wilhelm Welwei war zu Recht als einer der besten Kenner des antiken Griechenlands bekannt; entsprechend detailreich und dicht ist seine Darstellung geraten. Welwei behandelt alle wichtigen Aspekte der historischen Entwicklung, wobei er angenehmerweise gar nicht erst versucht, für die sogenannten Dunklen Jahrhunderte (ca. 1200–800 v.u.Z.) eine Erklärung zu liefern. Zwar erwähnt er die als mitursächlich anzunehmenden Erdbeben, deren Zerstörungen sich faktisch nachweisen lassen, doch verzichtet er darauf, die Spekulationen des 19. und 20. Jahrhunderts (barbarische Eroberer, Seuchen, rassische Degeneration etc.), für die es keinerlei archäologische Belege gibt, auch nur zu erwähnen.
Ein kurzer Überblick über die Zeit von Beginn der europäischen Zivilisation auf Kreta bis zum Übergang der archaischen Periode zur klassischen Antike. Der im vergangenen Jahr verstorbene Althistoriker Karl-Wilhelm Welwei war zu Recht als einer der besten Kenner des antiken Griechenlands bekannt; entsprechend detailreich und dicht ist seine Darstellung geraten. Welwei behandelt alle wichtigen Aspekte der historischen Entwicklung, wobei er angenehmerweise gar nicht erst versucht, für die sogenannten Dunklen Jahrhunderte (ca. 1200–800 v.u.Z.) eine Erklärung zu liefern. Zwar erwähnt er die als mitursächlich anzunehmenden Erdbeben, deren Zerstörungen sich faktisch nachweisen lassen, doch verzichtet er darauf, die Spekulationen des 19. und 20. Jahrhunderts (barbarische Eroberer, Seuchen, rassische Degeneration etc.), für die es keinerlei archäologische Belege gibt, auch nur zu erwähnen.
Im zweiten Teil der Darstellung liegt das Hauptgewicht auf der verfassungsrechtlichen Entwicklung verschiedener lokaler Ethnien, die schließlich zu der Form der athenischen Demokratie führte, die das populäre Bild des klassischen Zeitalters prägt. Nebenbei wird in einem kurzen Kapitel auch die kulturelle Entwicklung in Architektur, Plastik, Keramik und Dichtung behandelt, wobei auf den wenigen Seiten nur die ganz großen Linien angedeutet werden können.
Die gedrängte Darstellung zielt eher auf ein studentisches Publikum ab, ist also für eine allererste Einführung in das Thema nur bedingt geeignet. Wer allerdings bereits eine allgemeine Idee von der historischen Entwicklung der griechischen Frühzeit hat, wird kaum einen auch nur annähernd kompakten und zugleich kompetenten und informativen Überblick zum Thema finden.
Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Frühzeit. 2000 bis 500 v. Chr. BR 2185. München: C.H. Beck, 22007. Broschur, 128 Seiten. 8,95 €.