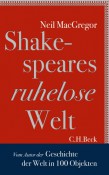Ich lebe in einer Welt, die sich jemand ausgedacht hat, ohne sich die Mühe zu machen, sie mir zu erklären – oder sie sich selbst zu erklären …
 Der Band versammelt fünf Erzählungen, darunter zwei Romane. Zur Werkausgabe insgesamt ist bereits bei der Besprechung des ersten Bandes etwas gesagt worden, das hier nicht wiederholt werden muss.
Der Band versammelt fünf Erzählungen, darunter zwei Romane. Zur Werkausgabe insgesamt ist bereits bei der Besprechung des ersten Bandes etwas gesagt worden, das hier nicht wiederholt werden muss.
»Die Schnecke am Hang« (entstanden 1965) erzählt zwei paralelle Handlungen, die auf einem nahezu gänzlich von Wald bedeckten Planeten spielen. Hintergrund der beiden Handlungsstränge bilden einerseits die von Menschen zum Zweck der Ausbeutung errichtete sogenannte Verwaltung, andererseits die Welt der Eingeborenen des Planeten, die sich wenigstens äußerlich von den Erdenmenschen nicht groß zu unterscheiden scheinen. Protagonist des in der Verwaltung spielenden Handlungsstrangs ist der Philologe Pfeffer, den es wohl aufgrund einer existenziellen Sehnsucht auf den Planeten verschlagen hat. Er hatte sich offenbar eine Art Erleuchtung von der Begegnung mit dem Wald erhofft, ist aber inzwischen angesichts der Absurdität der Anstrengungen der Verwaltung frustriert und möchte den Planeten wieder verlassen. An seinen vergeblichen, oft wie traumhaft wirkenden Bemühungen fortzukommen, offenbaren sich die Desorganisation und Ziellosigkeit aller Tätigkeiten der Verwaltung.
Im zweiten Handlungsstrang steht der Pilot Kandid im Zentrum. Er ist vor längerer Zeit mit seinem Helikopter über dem Wald abgestürzt und von Eingeborenen gefunden und gesund gepflegt worden. Kandids Ziel ist es, zur irdischen Verwaltung zurückzukehren, doch da die Eingeborenen, bei denen er lebt, nicht mehr als die nächste Umgebung ihres Dorfes einigermaßen kennen und den Wald fürchten, ist dies leichter gesagt als getan. Kandid macht sich trotz dieser Schwierigkeit zusammen mit einer eingeborenen Frau auf den Weg zur sogenannten Stadt, von der aus er den weiteren Weg zu finden hofft. Während er unterwegs ist, kommt er wenigstens zu einem rudimentären Verständnis der sozialen Struktur des Planeten: Offenbar existieren zumindest zwei verschiedene menschliche Spezies auf dem Planeten, eine hochentwickelte, rein weibliche, sich parthenogenetisch fortpflanzende, telepathisch begabte, die sich offenbar in einer Art Kriegszustand entweder untereinander oder mit einer weiteren Spezies befindet, und jene unter primitivsten Umständen existierende, die Kandid gerettet haben. Die erste scheint eine evolutionäre Weiterentwicklung der zweiten darzustellen. Zwar gelingt es Kandid, kurz die Aufmerksamkeit der höher entwickelten Art zu erregen, aber er findet sich doch schließlich in seinem Dorf wieder, wo er wie zu Anfang Pläne schmiedet, zur Stadt zu gelangen.
»Die Schnecke am Hang« wurde von der sowjetischen Zensur offenbar als Satire auf die sowjetischen Verhältnisse verstanden und dementsprechend wurde eine komplette Veröffentlichung des Romans vorerst nicht gestattet. So mussten die beiden Teile zuerst als eigene Erzählungen erscheinen, bevor das Werk 1968 erstmals komplett erscheinen konnte. Der Roman hat deutliche Längen, da er sich über weite Strecken absichtlich in Scheinbewegungen erschöpft, die die Protagonisten zu nichts führen. Die Hinweise darauf, was wirklich vorgeht, sind dünn gesät und drohen unter den albtraumartigen Erlebnissen der beiden Helden verloren zu gehen. So kann etwa vermutet werden, dass die mangelnde Effizienz der Verwaltung und ihr absurdes Abarbeiten an der offenbar nicht zu bewältigenden Aufgabe, den Wald auszubeuten, eine Folge von Interventionen der telepathischen Spezies der Eingeborenen ist; ebenso gut könnten es aber auch Einflüsse der Natur des Planeten selbst sein, die für die Orientierungslosigkeit der Menschen verantwortlich ist. All das und vieles mehr bleibt dem Leser so unklar wie den Menschen auf dem Planeten. Für diese erzählerische Technik scheint der Text zu lang geraten zu sein.
»Die zweite Invasion der Marsmenschen« (1967) ist eine längere Erzählung, die einerseits eine parodistische Fortsetzung von H. G. Wells’ »The War of the Worlds«, andererseits eine milde Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, Bequemlichkeit und Beschränktheit ist. Die Erzählung spielt in einer nicht näher bestimmten Gegenwart offenbar in Griechenland, was allein daran deutlich wird, dass alle Figuren Namen aus der griechischen Mythologie tragen. Das Land – und man darf vermuten der gesamte Planet – wird offenbar von den Marsmenschen erobert, wobei im ganzen Text kein einziger Marsmensch leibhaftig auftritt. Innerhalb kürzester Zeit stellen die Eroberer die Weltwirtschaft auf die Produktion von Magensaft um, dessen Qualität sie durch die Einführung einer neuen, schnell wachsenden, blauen Getreideart beeinflussen. Die Menschen werden weltweit offensichtlich zu einer Art Zuchtvieh umfunktioniert, dem regelmäßig sein Magensaft abgemolken wird.
Erzählt wird all dies aus der Perspektive eines pensionierten Lehrers in einem Dorf, in dem das Leben im Großen und Ganzen ungestört fortgeht. Zwar gibt es kurzzeitig einen Widerstand von vereinzelten Partisanengruppen, doch wird dieser bald von den Menschen selbst niedergeschlagen, da er den reibungslosen Ablauf der neuen Geschäfte mit blauem Getreide und Magensaft stört. Im Gegensatz zu Wells’ großer Schlacht um die Existenz der Menschheit, fügen sich die Menschen hier klaglos in die neuen Verhältnisse. Ihnen ist es ganz gleich, von wem sie beherrscht werden, und solange sie ihr Auskommen haben, sind ihnen auch Marsmenschen recht.
Auch der Roman »Die Last des Bösen« (1988) ist aus zwei Erzählsträngen zusammengefügt. Autor des Tagebuchs, das die Rahmenerzählung bildet, ist der Pädagogik-Student Igor Mytarin, der im Jahr 2033 in der fiktiven Stadt Taschlinsk an seiner Abschluss-Arbeit schreibt und seinen Pädagogik-Lehrer Georgi Analtoljewitsch Nossow tief verehrt, wenn er auch nicht immer einer Meinung mit ihm ist. Nossow hat seinem Studenten ein Manuskript in die Hand gedrückt, das von Ereignissen berichtet, die sich ungefähr 40 Jahre zuvor in derselben Stadt zugetragen haben sollen. Mytarin hält das Manuskript für eine offensichtliche Fiktion, ist sich aber nicht sicher, ob er Nossow die Autorenschaft an der seltsamen Erzählung zuschreiben soll.
Die Rahmenhandlung umfasst nur elf Tage, in denen sich in der Stadt Taschlinsk von offizieller Seite Widerstand gegen eine vor der Stadt lebende Jugendbewegung formiert. Die Jugendlichen verweigern die Teilnahme am bürgerlichen Leben und nehmen sich das vegetative Leben der Pflanzen zum Vorbild ihres Lebensentwurfs. Da immer mehr Jugendliche aus der Stadt zu den »Kindern der Flora« entlaufen, wächst der Druck auf die Stadtverwaltung, etwas gegen die Gruppierung zu unternehmen. So plant man, die Jugendlichen mit Hilfe der Polizei gewaltsam aus dem Stadtbezirk zu entfernen. Der Pädagoge Nossow ist der einzige unter den Honoratioren der Stadt, der sich für die »Kinder der Flora« einsetzt, auch weil – wie wir erst spät im Verlauf des Romans erfahren – sein Sohn einer der Führer der Gruppe ist. Trotz seines engagierten Einsatzes findet die Aktion statt, die selbst aber nicht mehr geschildert wird; jedoch deutet eine Bemerkung im Vorwort des Erzählers an, dass Nossow dabei wahrscheinlich ums Leben gekommen ist.
Das Manuskript im Manuskript, das peu à peu so wiedergegeben wird, wie es Mytarin während der Rahmenhandlung gelesen haben will, erzählt von der Wiederkehr Jesu auf die Erde. Begleitet wird er vom Evangelisten Johannes, der das Schicksal des »ewigen Juden« Ahasver hat übernehmen müssen, nachdem er diesen im Zorn getötet hatte. Er lebt zurzeit unter dem Namen Ahasver Lukitsch und gibt vor, ein Vertreter staatlicher Versicherungen zu sein, kauft aber in Wirklichkeit Menschen ihre Seele für die Erfüllung eines Wunsches ab. Die Binnenerzählung kommt nie bis zu einer Handlung im traditionelles Sinne, sondern gerät mehr und mehr ins Phantastische. Nach dem offensichtlichen Vorbild von Bulgakows »Der Meister und Margarita« wird einmal mehr die Geschichte Jesu und – in der Hauptsache – des Evangelisten Johannes neu erzählt. Der wiedergekehrte Jesus spielt nur eine Nebenrolle; überhaupt bleibt seine Rückkehr zur Erde ohne erwähnenswerte Folgen. In dem Moment, als der junge Nossow in der Binnenhandlung auftritt, bricht die Erzählung unvermittelt ab.
Der Roman ist offensichtlich sowohl eine unmittelbare Reaktion auf die politische Liberalisierung in der Sowjetunion unter Gorbatschow als auch ein Spiel mit der phantastischen Tradition der russischen Literatur. Was die politische Eben angeht, so ist es mehr als verständlich, dass die Strugatzkis die tatsächliche dramatische Entwicklung nicht voraussehen konnten, sondern von einer weit zahmeren gesellschaftlichen Veränderung ausgehen. Dabei steht im Vordergrund, dass das politische Establishment auch weiterhin Störungen der bürgerlichen Ordnung mit massiven Maßnahmen entgegentreten wird. Zugleich befürchten sie das Aufkommen latent vorhandener faschistischer Einstellungen. Der Gegenentwurf Nossows ist eine empathische Menschlichkeit, deren christliche Inspiration angedeutet wird, die sich aber jeder konkreten ideologischen Einbindung verweigert. Der Roman liefert so einen sowohl gesellschaftlich als auch literarisch höchst anspruchsvollen Kommentar zum tagespolitischen Geschehen. Es ist kein Wunder, dass die Brüder trotz den sehr verhaltenen Reaktionen von Kritik und Leserschaft auf diesen Roman sehr stolz waren.
Der Band wird ergänzt von zwei Erzählungen, die unter dem Pseudonym S. Jaroslawzew veröffentlicht wurden, das für eine relativ lange Zeit nicht gelüftet wurde. In »Aus dem Leben des Nikita Woronzow« (1984) unterhalten sich ein Moskauer Staatsanwalt und ein befreundeter Schriftsteller über einen merkwürdigen Todesfall: Ein älterer Mann, der eine Gruppe jugendlicher Rowdys zurecht weist, wird von einem der Jugendlichen niedergeschlagen und bleibt tot auf der Straße liegen. Bei der Autopsie stellt sich allerdings heraus, dass er Sekunden vor dem Schlag an einem Herzschlag gestorben ist und der Junge nur einen toten Mann geschlagen hat. Im Nachlass des Mannes findet sich ein Schulheft, in dem sein Todesdatum auf die Minute genau vorausgesagt wird. Weitere Befragungen Bekannter des Mannes durch den Staatsanwalt ergeben, dass der Tote wohl sein Leben immer und immer wieder durchleben muss: Nach jedem Tod findet er sich wieder als Jugendlicher nach einer schweren Erkrankung und durchläuft sein Leben erneut, wobei er sich an alle anderen Durchgänge erinnern kann. Die Erzählung ist eine harmlose Variation auf Schauergeschichten, wie man sie allenthalben finden kann.
Die längere Erzählung »Ein Teufel unter den Menschen« (entstanden 1991, jedoch erst 1993, zwei Jahre nach dem Tod Arkadi Strugatzkis veröffentlicht) verbindet eine nicht verwendete Idee für eine Nebenfigur in »Die Last des Bösen« mit der Katastrophe von Tschernobyl, die dabei allerdings nur eine nebensächliche Rolle spielt. Erzähler ist der Arzt Alexej Andrejewitsch Kornakow, der die Geschichte seines Schulfreundes Kim Sergejewitsch Woloschin aufschreibt: Kim, der im Zweiten Weltkrieg zur Waise wird, wächst in ärmlichen Verhältnissen in Taschlinsk auf und macht nach der Schule eine Ausbildung zum Mechaniker. Als sich die Tochter eines Moskauer Journalistik-Professors in ihn verliebt, macht er kurzfristig eine Karriere als Journalist in Moskau, fällt dann aber in Ungnade und durchläuft eine Reihe von Gulags. Nach seiner Entlassung kehrt er zusammen mit seiner Frau nach Taschlinsk zurück, wo sie aber bald verstirbt. Als sich der Unfall in Tschernobyl ereignet, meldet er sich freiwillig als Hilfskraft, allerdings in der Absicht, von den dortigen Verhältnissen anschließend als Journalist berichten zu können.
Aus Tschernobyl zurückgekehrt, erkrankt er an den Folgen der radioaktiven Strahlung, doch stirbt er nicht. Er entwickelt stattdessen die unwillkürliche Fähigkeit, Lebewesen, die seinen Zorn erregen, auf telepathischem Weg zu töten. Nachdem er selbst diese Fähigkeit verstanden hat, gelingt es ihm, sie zu beherrschen und gezielt einzusetzen, was in der kleinen Stadt verständlicherweise zu einiger Aufregung führt. Am Ende verschwindet Woloschin spurlos aus Taschlinsk; in drei kurzen Epilogen versuchen die Strugatzkis, dieser etwas ziellosen Geschichte eine Wendung in eine Satire der Macht zu geben.
Alles in allem ein recht uneinheitlicher Sammelband, dessen Texte literarisch durchaus nicht alle auf gleicher Höhe sind. Inhaltlich und formal herausragend ist ohne Frage der Roman »Die Last des Bösen«, der besonders allen Liebhabern von Bulgakows »Der Meister und Margarita« als dunkles Gegenstück ans Herz gelegt sei.
Arkadi und Boris Strugatzki: Gesammelte Werke 3. Deutsch von Hans Földeak (Die Schnecke am Hang), Thomas Reschke (Die zweite Invasion der Marsmenschen), Kurt Baudisch (Die Last des Bösen), Edda Werfel (Aus dem Leben des Nikita Woronzow) und Erik Simon (Ein Teufel unter den Menschen). Nach den ungekürzten und unzensierten Originalversionen ergänzt von Erik Simon. Kindle-Edition, 2012. 897 Seiten (Buchausgabe). 9,99 €.
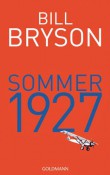 Nachdem nun schon eine Zeitlang Jahreszahlen-Bücher beliebt zu sein scheinen, legt der erfolgreiche Sachbuchautor Bill Bryson mit „Sommer 1927“ ein erstes Jahreszeiten-Buch vor, wenn er auch dabei etwas mogelt und seinen Sommer auf fünf Monate streckt. Ich erwarte nun binnen Jahresfrist einen Tausendseiter von Peter Ackroyd, etwa über den 23. April 1616, also circa 500 Seiten für jeden der beiden Tage.
Nachdem nun schon eine Zeitlang Jahreszahlen-Bücher beliebt zu sein scheinen, legt der erfolgreiche Sachbuchautor Bill Bryson mit „Sommer 1927“ ein erstes Jahreszeiten-Buch vor, wenn er auch dabei etwas mogelt und seinen Sommer auf fünf Monate streckt. Ich erwarte nun binnen Jahresfrist einen Tausendseiter von Peter Ackroyd, etwa über den 23. April 1616, also circa 500 Seiten für jeden der beiden Tage.