 Das neunte und – wie der Titel und das Ende des Buches andeuten – letzte Buch, in dem der Schriftsteller Nathan Zuckerman als Protagonist fungiert. Zuletzt hatte Zuckerman in Der menschliche Makel die Geschichte Coleman Silks erzählt, eines vorgeblich jüdischen, in Wahrheit aber schwarzen Professor der Altphilologie, der wegen einer unbedachten Äußerung, die als rassistisch ausgelegt wird, aus seiner Fakultät gemobbt wird. Zu dieser Zeit lebte Zuckerman zurückgezogen in Massachusetts.
Das neunte und – wie der Titel und das Ende des Buches andeuten – letzte Buch, in dem der Schriftsteller Nathan Zuckerman als Protagonist fungiert. Zuletzt hatte Zuckerman in Der menschliche Makel die Geschichte Coleman Silks erzählt, eines vorgeblich jüdischen, in Wahrheit aber schwarzen Professor der Altphilologie, der wegen einer unbedachten Äußerung, die als rassistisch ausgelegt wird, aus seiner Fakultät gemobbt wird. Zu dieser Zeit lebte Zuckerman zurückgezogen in Massachusetts.
Zu Anfang von Exit Ghost finden wir Nathan Zuckerman Ende Oktober 2004 in New York. Er hofft auf einen medizinischen Eingriff, der seine Inkontinenz beheben soll, die sich nach einer Prostata-Operation eingestellt hat. Neben der Inkontinenz, die ihm hauptsächlich lästig und peinlich ist, ist Impotenz eine weitere Folge der Operation, die Zuckerman Selbstbewusstsein und -bild arg zusetzt. Zuckerman ist nun 71 Jahre alt und war mit 60 in die Provinz geflohen, nachdem er eine Reihe von Morddrohungen erhalten hatte. Er hat sich in den elf Jahren weitgehend des gesellschaftlichen Umgangs entwöhnt und findet sich und New York nach dieser Zeit sehr verändert wieder. Trotz einigem inneren Widerstand, entschließt er sich, für eine Weile in New York zu bleiben, um den Erfolg der Behandlung abzuwarten und dies eventuell wiederholen zu lassen. Es wird schließlich nicht mehr als eine Woche werden.
Binnen kurzem ist Zuckerman in alte und neue Geschichten verstrickt: Er begegnet zufällig Amy Bellette wieder, trifft das junge Ehepaar Jamie und Billy, mit denen er für die Zeit, die er in New York verbringen will, die Wohnung zu tauschen plant, und schließlich nimmt ein Freund Jamies, Richard Kliman, Kontakt zu ihm auf, der eine Biografie über E. I. Lonoff schreiben will. Lonoff stand zusammen mit Amy Bellette im Zentrum des ersten Zuckerman-Romans Der Ghostwriter, in dem Zuckerman als junger Autor den von ihm verehrten Erzähler Lonoff besucht.
Zuckerman verliebt sich auf den ersten Blick in die attraktive Jamie, nicht ohne sich schmerzlich seines Alters und seines körperlichen Unvermögens bewusst zu sein. Während er sich mit dieser Verliebtheit herumquält, wehrt er sich zugleich gegen die Vereinnahmung durch Kliman, der ein ehemaliger Kommilitone und Ex-Freund Jamies ist und den Zuckerman verdächtigt, ein Verhältnis mit Jamie zu haben. Kliman ist in jeglicher Hinsicht Zuckermans Konkurrent: Er ist ein junger und agiler sexueller Rivale, er ist ein aufstrebender junger Autor, er hat seine Karriere und sein Leben noch vor sich und erinnert Zuckerman mit all seiner Energie und seinem Enthusiasmus zu sehr an sich selbst in jungen Jahren, als dass er ihm nicht zugleich ständig die Mängel seiner Altersexistenz vor Augen führen würde.
Kliman will Zuckerman als Quelle und Autorität für seine Lonoff- Biografie einspannen. Klimans These ist, dass der einzige und unvollendet gebliebene Roman Lonoffs auf einer autobiografischen Konstellation beruht und Lonoff eine inzestuöse Beziehung zu seiner Halbschwester gehabt habe. Während Kliman durch die Veröffentli- chung ein Revival des vergessenen Lonoffs herbeizuführen hofft, befürchtet Zuckerman, dass eine solche Biografie Lonoff und sein Werk auf den vorgeblichen Skandal dieses Inzests reduzieren und damit für immer beschädigen würde. Zuckerman selbst entwickelt spontan eine alternative, literarische Deutung des Inzest-Motivs, indem er die These aufstellt, Lonoff habe sich durch biografische Spekulationen über Hawthorne zu diesem Thema anregen lassen.
Aus dieser relativ einfachen Struktur gewinnt Roth überraschend reiches Material: Da das Flirten tête-à-tête mit Jamie nicht gelingen will, entwickelt Zuckerman in seinem Hotelzimmer imaginäre Dialoge, die schließlich auf das Ermöglichen des Unmöglichen hinauslaufen: Die fiktive Jamie erklärt sich bereit, sich mit dem fiktiven Zuckerman in seinem Hotelzimmer zu treffen, der daraufhin fluchtartig das Hotel, New York und wahrscheinlich auch gleich die Welt verlässt:
Er löst sich auf. Sie ist unterwegs, und er verschwindet. Er ist für immer fort.
Gespiegelt wird diese imaginäre Beziehung in Zuckermans Gesprächen mit Amy Bellette, die in Der Ghostwriter als Studentin eine Beziehung mit alternden E. I. Lonoff begonnen hatte und Zuckerman nun von Lonoffs letzten Jahren, seinem unvollendeten Roman und seinem Sterben erzählt. In diesen und den Gesprächen zwischen Zuckerman und Kliman entwickelt Roth das zweite große Thema des Romans: Den Umgang der Öffentlichkeit mit Schriftstellern. Zuckerman wehrt sich gegen die Biografie Klimans auch deshalb so sehr, weil er befürchtet, dass auch sein Leben und Werk postum auf eine Reihe von Skandalen reduziert werden wird. Er setzt die Integrität des Werks, das für einen »unbefangenen Leser« geschrieben sei, der Integrität der Informanten eines Literaturbetriebs gegenüber, der Schriftsteller nicht anhand ihrer künstlerischen Leistungen, sondern ihrer moralischen Verfehlungen gewichtet.
Exit Ghost zeigt wie schon zuvor Der menschliche Makel einen erzählerisch deutlich entspannteren Philip Roth, als man ihn aus vielen früheren Romanen kennt. Motivisch rundet der Roman die Zuckerman- Reihe mit der Wiederaufnahme der Figuren Lonoffs und Amy Bellettes schön ab, und auch die Figur Zuckermans selbst findet mit diesem letzten Liebesabenteuer einen gelungenen Abschluss. Er zieht sich nun endgültig in die Provinz zurück und überlässt die Welt den Jungen. Mag sein, wir werden später einmal von seinem Tod und seiner Beerdigung lesen, mag auch sein, er ist für immer aus unserem Blickfeld verschwunden. Roth zumindest wird Zuckerman wohl auch nach diesem Buch nicht vollständig aus den Augen verlieren.
Philip Roth: Exit Ghost. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. München: Hanser, 2008. Pappband, 297 Seiten. 19,90 €.
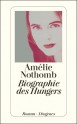 Amélie Nothomb schreibt ganz wundervolle, autobiographisch unterfütterte Erzählungen. Ich habe sie vor vielen Jahren mit »Liebessabotage« entdeckt, das sich inhaltlich zu »Biographie des Hungers« wie ein kleiner, nicht konzentrischer Inkreis verhält. »Biographie des Hungers« erzählt etwa fünfzehn Jahre aus dem Leben der Tochter eines belgischen Diplomaten, die es aufgrund der regelmäßig alle drei Jahre erfolgenden väterlichen Versetzungen von Japan über China, den USA und Bangladesch nach Burma und schließlich Laos verschlägt; »Liebessabotage« war die Geschichte der ersten Liebe des jungen Mädchens im Pekinger Diplomatenviertel. Auch Nothombs Bücher »Mit Staunen und Zittern« und »Der japanische Verlobte« (von dem ich das allerdings nur vermute, da ich es bislang nicht gelesen habe) gehören zu diesen autobiographischen Zirkel. Ansonsten schreibt Nothomb auch noch Krimis, von denen zumindest einer ein ziemlich grobes Plagiat eines Hörspiels von Friedrich Dürrenmatt (lustigerweise im selben Verlag!) darstellt. Belesen ist die junge Frau also auch noch!
Amélie Nothomb schreibt ganz wundervolle, autobiographisch unterfütterte Erzählungen. Ich habe sie vor vielen Jahren mit »Liebessabotage« entdeckt, das sich inhaltlich zu »Biographie des Hungers« wie ein kleiner, nicht konzentrischer Inkreis verhält. »Biographie des Hungers« erzählt etwa fünfzehn Jahre aus dem Leben der Tochter eines belgischen Diplomaten, die es aufgrund der regelmäßig alle drei Jahre erfolgenden väterlichen Versetzungen von Japan über China, den USA und Bangladesch nach Burma und schließlich Laos verschlägt; »Liebessabotage« war die Geschichte der ersten Liebe des jungen Mädchens im Pekinger Diplomatenviertel. Auch Nothombs Bücher »Mit Staunen und Zittern« und »Der japanische Verlobte« (von dem ich das allerdings nur vermute, da ich es bislang nicht gelesen habe) gehören zu diesen autobiographischen Zirkel. Ansonsten schreibt Nothomb auch noch Krimis, von denen zumindest einer ein ziemlich grobes Plagiat eines Hörspiels von Friedrich Dürrenmatt (lustigerweise im selben Verlag!) darstellt. Belesen ist die junge Frau also auch noch!






