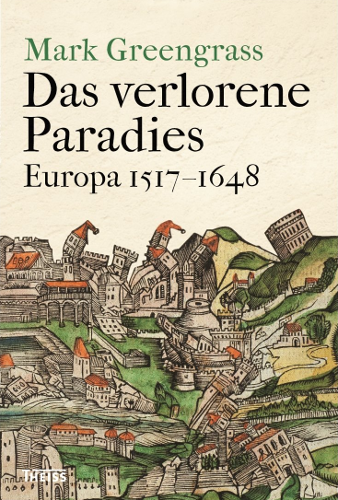Diese Geschichte Europas der frühen Neuzeit (1517–1648) gehört in die Reihe der Penguin Geschichte Europas, aus der hier schon der Band von Ian Kershaw zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besprochen wurde. Es scheint mir interessant, dass man bei Random House offenbar nicht davon überzeugt ist, dass die gesamte Reihe für die eigene Verlagsgruppe attraktiv ist, so dass wir einzelne Bände wohl noch in anderen Verlagen erwarten dürfen. Die Reihe lässt sich aus zwei Bänden natürlich nicht beurteilen, aber der allgemeine Eindruck ist durchaus positiv.
Der Originaltitel des Bandes ist etwas deutlicher als der der Übersetzung: “Christendom Destroyed” macht eines der zentralen Konzepte des Autors sofort deutlich, während der literarischere deutsche Titel suggeriert, beim späten Mittelalter habe es sich um eine Art von Paradies gehandelt, wovon in keiner Weise die Rede sein kann und im Buch auch nicht ist.
Der Autor liefert eine sehr detailorientierte Geschichte der Zeit, die bei sehr konkreten Lebensumständen (Wohnverhältnisse, Siedlungsformen, Lebenserwartung, Familienplanung, Ehe, Erbrecht, Primogenitur, Krieg und Krankheiten, Hungersnöte, Klima, Sonnenflecken, Vulkanausbrüche, Essensgewohnheiten und unklare Todesursachen – alles in dieser Reihenfolge) beginnt und sich langsam zu dem vorarbeitet, was man gemeinhin als große Geschichte von einem Geschichtsüberblick erwartet. Wie schon angedeutet, legt der Autor ein bedeutendes Gewicht auf das religiöse Schisma der Reformation, das er einerseits mitverantwortlich macht für einen wesentlichen Wandel im Verhältnis zwischen Untertanen und herrschender Klasse. Andererseits sieht er ein, dass nicht alles, was in der frühen Neuzeit nach einem religiösen Konflikt aussieht, tatsächlich religiöse Ursachen hat oder religiöse Ziele verfolgt.
Es lassen sich dem Buch eine Vielzahl interessanter Details entnehmen, wenn auch die Darstellung hier und da seltsame blinde Flecken aufweist: Kein einziger Satz zur Entstehung der King James Bible, obwohl andere Bibelübersetzungen ausführlich besprochen werden, eine einzige flüchtige Erwähnung der Mayflower und was der Kleinigkeiten mehr sind.
Als ganz und gar missraten muss aber die deutsche Übersetzung angesehen werden, die das Buch gänzlich unnötig aufbläht und den eher lakonischen Stil des Autors durch eine besserwisserische Geschwätzigkeit ersetzt:
| aus | wird |
|---|---|
| “The Ottomans also turned themselves into a naval power.” | „Die Osmanen betrieben auch Flottenbau, um Seemacht zu werden.“ |
| “Protestant reformers undermined pilgrimage to the Holy Places.” | „Die Reformatoren hielten Pilgerfahrten zu den heiligen Stätten ohnehin für unwichtig.“ |
| “By 1650, over 180 tons of gold had been exported from the Indies, and 16,000 tons of silver from the New World.” | „Bis 1650 waren mehr als 180 Tonnen Gold aus Ostindien und 16.000 Tonnen Silber aus der Neuen Welt nach Europa gelangt.“ |
Gerade dieser letzte Zusatz aus der Phantasie des Übersetzers ist besonders ärgerlich, da wenige Seiten zuvor ausdrücklich thematisiert wurde, dass ein bedeutender Anteil des Peruanischen Silbers nach China exportiert wurde.
Zum Ausgleich dafür lässt der Übersetzer an anderen Stellen willkürlich Wörter und auch schon einmal ganze Sätze weg, ändert die Reihenfolge der Sätze, die er doch noch die Freundlichkeit besitzt zu übersetzen, und nimmt sich auch sonst all die Freiheiten heraus, die seine Tätigkeit früher einmal zu einem der phantasievollsten im holzverarbeitenden Gewerbe machten. Gleichgültig, wo man die Übersetzung aufschlägt, bietet sich einem dasselbe Bild. Kurz gesagt: Die Übersetzung macht das Buch für einen ernsthaft interessierten Leser vollständig unbrauchbar. Mit ist unklar, warum eine Organisation wie die Wissenschaftliche Buchgesellschaft eine solche Katastrophe zum Druck befördert.
In Details durchaus interessant, im Ganzen wenig überraschend, auf Deutsch ungenießbar.
Mark Greengrass: Das verlorene Paradies. Europa 1517–1648. Aus dem Englischen von Michael Haupt. Darmstadt: wbg Theiss, 2018. Pappband, 781 Seiten. 39,95 €.