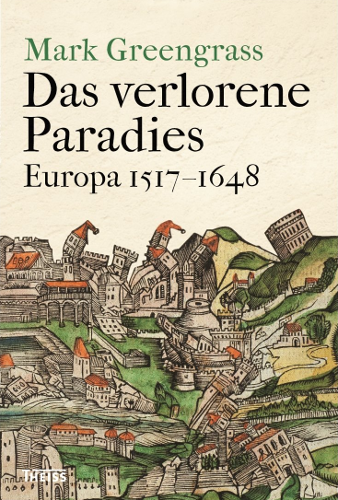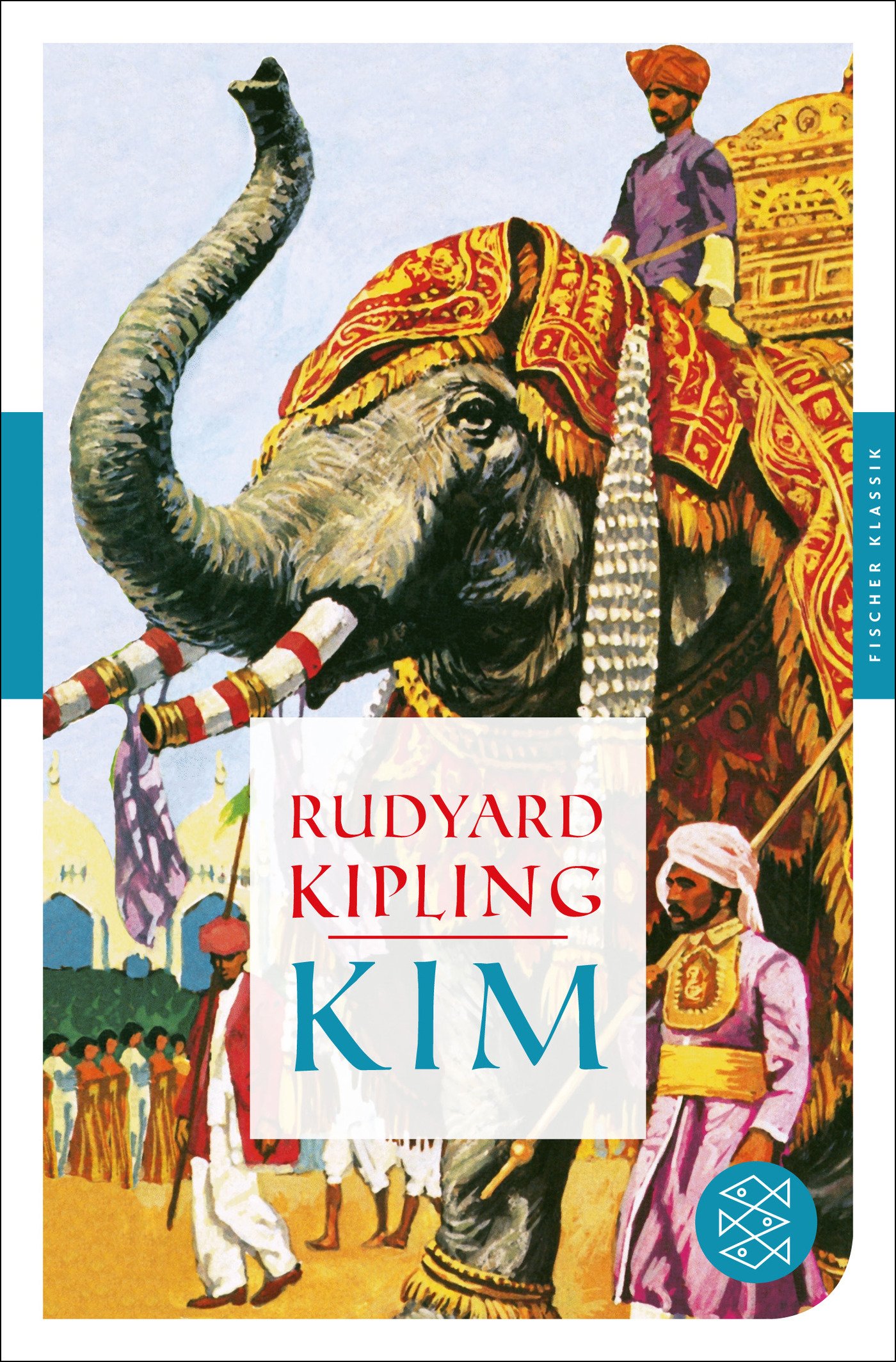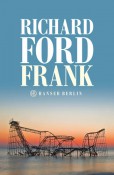Komische Leut. Gut dass ich keiner von denen bin.
Rowohlt setzt seine Reihe von Neuübersetzungen von Romanen William Faulkners – „Licht im August“ (2008), „Als ich im Sterben lag“ (2012) – mit dem 1929 erschienenen „Schall und Wahn“ fort. Der Titel des amerikanischen Originals „The Sound and the Fury“ ist eine offensichtliche Anspielung auf eine Passage aus Shakespeares „Macbeth“:
Life’s but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Nun wäre angesichts dieses Hintergrundes der Titel wahrscheinlich genauer mit „Der Lärm und die Raserei“ oder auch, wie Übersetzer Frank Heibert in seinem Nachwort vorschlägt, „Das Tönen und Wüten“ übersetzt. Allerdings, schließt Heibert seine Reflexion über mögliche Titelvarianten, habe bei
der Titelentscheidung […] nicht der Übersetzer das letzte Wort.
Auf Deutsch heißt dieser Roman «Schall und Wahn».
Der Roman ist aufgeteilt in vier große Abschnitte, von denen drei an den drei Tagen von Karfreitag bis Ostersonntag des Jahres 1928 im fiktiven Mississippi-Städtchen Jefferson spielen. Der zweite Teil ist auf den 2. Juni 1910 datiert und ist in Harvard angesiedelt. Jedes der Kapitel hat einen eigenen Erzähler, wobei die Erzählhaltungen von Abschnitt zu Abschnitt immer traditioneller werden. Der erste Abschnitt, der wohl am besten dem Programm des oben angeführten Shakespeare-Zitats folgt, wird vom geistig behinderten Benjy, dem jüngsten der drei Söhne der Familie Compson erzählt. Benjy ist 1928 dreiunddreißig Jahre alt und bedarf ständiger Aufsicht und Hilfe. Er ist nach einem Übergriff auf ein kleines Mädchen kastriert worden und hätte anschließend nach dem Willen seines Bruders Jason in eine geschlossene Anstalt gesteckt werden sollen. Doch aus Rücksicht auf die Mutter lebt er weiterhin im elterlichen Haus, unter ständiger Aufsicht eines schwarzen Bediensteten, zumeist des erst 14-jährigen Lusters.
Benjy ist naturgemäß ein denkbar ungeeigneter Erzähler: Er kann kaum zwei Gedanken folgerichtig hintereinander setzen, seine Erinnerungen und Eindrücke nicht in eine zuverlässige zeitliche Abfolge bringen, keine seiner Erfahrungen tatsächlich begreifen oder sich in ein Verhältnis zu ihr setzen etc. Er ist tief geprägt von den Erlebnissen seiner Kindheit, die in seinem Gedanken- und Erfahrungsstrom immer wieder auftauchen. Besonders die Liebe zu seiner Schwester Candy ist eine der Konstanten in dem Chaos in Benjys Kopf. Erst die zweite Hälfte des Romans wird vieles von dem, was Benjy erzählt, verständlich werden lassen.
Der zweite Abschnitt wird von Quentin Compson erzählt, der im Jahr 1910 in Harvard studiert. Der Leser kann vermuten, dass es sich bei dem erzählten Tag um denjenigen handelt, an dessen Ende sich Quentin ertränken wird. Quentin verbringt den Tag mit einer anscheinend ziellosen Fahrt durch Harvard und dessen ländliches Umfeld. In einer kleinen Stadt läuft ihm längere Zeit ein kleines italienisches Mädchen nach, weshalb er unter dem Verdacht verhaftet wird, er habe das Mädchen entführen wollen. Nachdem sich dieser Verdacht vor dem Friedensrichter, vor den Quentin gestellt wird, als unbegründet erweist, nimmt Quentin mit einigen Kommilitonen an einem Picknick teil, bei dem er allerdings eine Schlägerei beginnt. Er kehrt allein nach Harvard zurück und ordnet seine Habseligkeiten als Vorbereitung für seinen Selbstmord. Die Erzählung bricht ab, unmittelbar bevor Quentin sein Zimmer wahrscheinlich zum letzten Mal verlässt.
Quentins Ich-Erzählung ist natürlich deutlich klarer strukturiert als die Benjys, doch wird auch hier dem Leser einiges an Aufmerksamkeit und interpretierendem Lesen abverlangt. Quentins Denken ist getränkt von einem tiefem Schuldgefühl wegen seiner Liebe zu seiner Schwester Candace, die offenbar vor kurzer Zeit geheiratet hat. Wir werden später erfahren, dass Candy diese Ehe eingeht, um ihrer unehelich, nicht von ihrem Ehemann gezeugten Tochter eine Familie zu geben. Quentin verachtet Candys Ehemann und ist eifersüchtig auf ihn, macht sich zugleich aber schwere Vorwürfe wegen dieser Gefühle, die er selbst als inzestuös empfindet. Dieser innere Konflikt ist zumindest einer der Gründe für Quentins Entschluss, sich selbst zu töten.
Der dritte Abschnitt wird von Jason, dem dritten Sohn der Compsons erzählt. Auch Jason lebt immer noch im elterlichen Haus, und er ist es, der durch seine Tätigkeit als Verkäufer in einem Ladengeschäft die Familie finanziell über Wasser hält. Im Haushalt der Compson lebt außer der Mutter Caroline, Benjy und Jason auch Candys Tochter Quentin (!), die von ihrer Mutter nach der Scheidung ihrer ersten Ehe zur Familie in Jefferson gebracht wurde. Quentin ist 17 Jahre alt und rebelliert gegen ihren sie und die übrige Familie tyrannisierenden Onkel Jason. Jason ist nicht nur ständig schlecht gelaunt und geneigt, jedermann nach Möglichkeit zu quälen, er unterschlägt auch systematisch die Unterhaltszahlungen, die Candy für ihre Tochter schickt. Der verbitterte und geldgierige Mann spekuliert mit diesem Geld an der Baumwoll-Börse, die aber im wesentlichen auch nur seinen Hass auf die Welt, die Juden und die Schwarzen schürt. Jasons Ich-Erzählung folgt am ehesten traditionellen Vorbildern, wie sie die Erzähler des 19. Jahrhundert geliefert haben.
Der vierte Abschnitt schließlich hat einen auktorialen Erzähler, der im Großteil seiner Erzählung dem Tagesablauf von Dilsey, der schwarzen Haushälterin der Compsons und Mutter Lusters, folgt. Dilsey hat außer Luster noch eine Tochter, Frony, die aber nicht im Haus lebt. Sie besorgt nicht nur den Haushalt, sondern hat auch die Kinder der Compsons erzogen, da weder die hypochondrische Mutter Caroline noch der stets betrunkene Vater Jason (sen.) dazu in der Lage waren. Sie ist das ausgleichende Element im Haus der Compson und sorgt immer wieder dafür, dass die Streitereien der weißen Familie nicht in Gewalt und Chaos enden. Allerdings muss Jason (jun.) an dem im letzten Abschnitt erzählten Ostersonntag 1928 feststellen, dass seine Nichte, die ihn zwei Tage zuvor flehentlich gebeten hatte, ihr das Geld auszuzahlen, das ihre Mutter ihr gerade geschickt hatte, und von ihm mit 10 Dollars abgespeist wurde, in sein Zimmer eingebrochen ist, seine Geldschatulle aufgebrochen und mit 7000 Dollars das Weite gesucht hat. Ein Großteil dieses Geldes ist der von Jason unterschlagene Unterhalt, so dass sich Quentin wenigstens zum Teil nur das Geld wiederholt, dass Jason ihr vorenthalten hat. Jason versucht noch, Quentin und den Schausteller, mit dem sie aus Jefferson geflohen ist, einzuholen, muss aber schließlich einsehen, dass der Versuch zwecklos ist. Mit einem letzten Wutanfall Jasons gegen Luster endet der Roman.
„Schall und Wahn“ ist 1928 entstanden und lässt überdeutlich den Einfluss von Joyces „Ulysses“ auf Faulkner erkennen: Der Wechsel der Erzählform und der Erzähler von Abschnitt zu Abschnitt, das experimentelle Zuspitzen der Subjektivität des Erzählens besonders im ersten Abschnitt, das Erzählen eher eines Zustands als einer Handlung, die Reduktion des Erzählten auf kurze Zeiträume lassen sich alle problemlos auf das Vorbild des „Ulysses“ zurückführen. Heutige Leser, die in der Rezeption dieser Art von Texten geübter sind als Faulkners zeitgenössisches Publikum (es gibt allerdings auch heute noch Ausnahmen), können durchaus den Eindruck haben, dass auch eine deutlich kürzere Fassung des Textes denselben Eindruck vermitteln würde. Doch sollte man nicht vergessen, dass diese Formen Ende der 20er Jahre noch weitgehend neu und wenig eingeübt waren und sowohl auf der Seite der Schriftsteller als auch auf der der Leser noch eine bedeutende Unsicherheit über die Wirkung und die Tragfähigkeit dieser Formen bestand.
Die Übersetzung Frank Heiberts ist sorgfältig und präzise und vermeidet es, den Text zu verflachen oder der sogenannten Lesbarkeit zu opfern. Auch typographisch geht diese Neuausgabe sehr sorgsam mit dem Original um und reproduziert Faulkners typographische Manierismen – etwa längere Folgen von Leerzeichen, um etwas ungesagt Bleibendes zu markieren, oder das Einfügen einer kleinen Graphik eines Auges an einer Stelle, wo eine Werbetafel mit einem entsprechenden Symbol beschrieben wird – zuverlässig.
Ein Klassiker der Moderne, der erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der US-amerikanischen Literatur gehabt hat und einen der Grundsteine zu Faulkners Ruhm bildet. Es ist zu hoffen, dass Rowohlt seine Reihe von Neuübersetzungen Faulkners noch lange fortsetzen wird.
William Faulkner: Schall und Wahn. Übersetzt von Frank Heibert. Reinbek: Rowohlt, 2014. Pappband, Lesebändchen, 381 Seiten.
24,95 €.