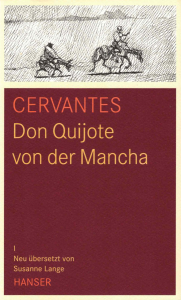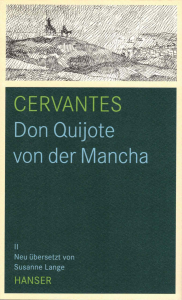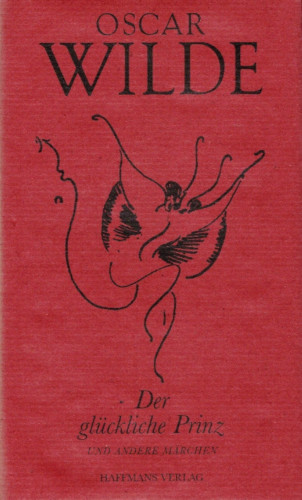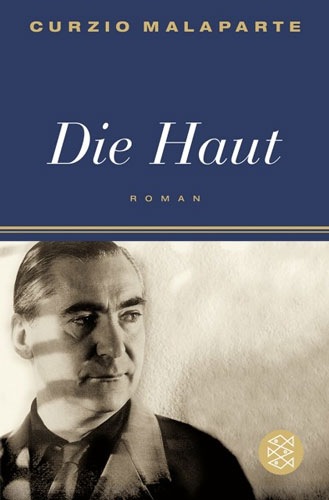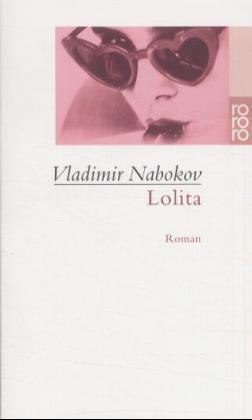Noch bin ich, wiewohl nur teilweise, Borges.
Es gibt wohl keinen ernsthaften Leser, der nicht irgendwann in seinem Leben auf Die Bibliothek von Babel stößt oder gestoßen wird. Allein daraus könnte man die These ableiten, dass Jorge Luis Borges einer der bekanntesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts sein muss, wenigstens unter denen, auf die es ankommt.
Die Bibliothek von Babel beschreibt ein anscheinend unbegrenztes sphärisches Universum, das im Wesentlichen nur aus sechseckigen Räumen, Verbindungsgängen und Treppen besteht. In jedem der Räume bestehen vier der Wände aus jeweils fünf Bücherregalen mit immer 32 Büchern, von denen jedes 410 Seiten hat; „jede Seite hat vierzig Zeilen; jede Zeile etwas achtzig Zeichen von schwarzer Farbe“. Die Bücher sind außen beschriftet, aber es kann in der Regel vom Titel des Bandes, so er überhaupt einen Sinn hat, nicht auf den Inhalt des Buches geschlossen werden. Diese Bibliothek wird von Bibliothekaren bewohnt, deren Hauptaufgabe darin besteht, den ihnen erreichbaren Teil der Bibliothek nach sinnvollen Zeichenkombinationen in den Büchern zu durchsuchen, denn ihr Inhalt besteht aus zufälligen Aneinanderreihungen von 25 alphabetischen Symbolen (22 Buchstaben, Punkt und Komma sowie das Leerzeichen). Wovon diese Bibliothekare leben, wie sie sich ernähren, bleibt unerwähnt.
Es haben sich mit der Zeit unter den Bibliothekaren einige Annahmen über die Bibliothek durchgesetzt; dazu gehört die These, dass die Bibliothek alle möglichen Kombinationen der 25 Symbole enthält; allerdings hat es in früheren Zeiten Versuche gegeben, sich gegen die Hoffnungslosigkeit, die die Bibliothek in den Bibliothekaren erzeugt, dadurch zu erwehren, dass man systematisch Bücher vernichtet hat; doch hat dies kaum Auswirkungen auf den Bestand der Bibliothek, denn zu jedem vernichteten Buch gibt es zahllose Kopien, die von dem vernichteten nur um ein oder zwei Symbole abweichen. Naturgemäß enthalten die meisten Bände unlesbare Zeichenfolgen, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Zeichenketten in einer vergangenen oder zukünftigen Sprache sinnvolle Texte ergeben. Doch kaum ein Bibliothekar hat in seinem Leben mehr als eine Handvoll lesbarer Einzelstellen zu sehen bekommen.
Eines [der Bücher], das mein Vater in einem Sechseck des Umgangs 1594 erblickte, bestand aus den Buchstaben M C V, in perverser Wiederholung von der ersten bis zur letzten Zeile. Ein anderes (das in dieser Zone oft konsultiert wird) ist ein reines Buchstabenlabyrinth, aber auf der vorletzten Seite steht: O Zeit deine Pyramiden. Man ersieht hieraus: Auf eine vernünftige Zeile oder korrekte Notiz entfallen Meilen sinnloser Kakophonien, sprachlichen Plunders, zusammenhanglosen Zeugs.
S. 161
Eine andere Sicht auf die Bibliothek versteht aber, dass irgendwo in ihr auch alle Meisterwerke der Literatur aller Zeiten verborgen sein müssen und das wiederum unzählige Male. Irgendwo gibt es den unwiderlegbaren Beweis, dass Shakespeare mit Queen Elizabeth identisch war, in einem anderen, dass es sich bei seinen Werke um eine geschickte Fälschung Goethes handelt. Ebenso findet man die schlüssigen Beweise für jede bekannte und unbekannte Verschwörungstheorie ebenso wie deren Widerlegung, ja es muss Bücher geben, in denen Beweise und Gegenbeweise sich in den Sätzen Wort für Wort abwechseln. Und es gibt ein Buch, in dem die Wirklichkeit der Welt enthüllt wird, also einen Katalog der Kataloge der Bibliothek, durch den jedes Buch direkt erreichbar wird. Leider gibt es auch endlos viele Fälschungen dieses Katalogs. Und gleichgültig wie viele Fälschungen es gibt, niemand wird sie je in dem Ozean des Unlesbaren finden.
Je länger man über dieses im Grunde recht einfach entworfene Labyrinth nachdenkt, desto tiefer und desaströser wird es: Wenn man beginnt zu begreifen, dass unsere wirklichen Bücher nur eine verschwindende Teilmenge der Bibliothek von Babel sind und nichts sie davor schützt, gänzlich unerheblich zu sein, weil sich in ihr nicht nur viel größere Meisterwerke mit Notwendigkeit finden, sondern weil es auch ein Buch dort gibt, dass unsere gesamte Kultur unrettbar der Banalität übergibt. Manche Gedankenspiele sind geeignet, einen zur Verzweiflung zu bringen.
Nun ist Die Bibliothek von Babel nur eine von zahlreichen Erzählungen in diesem Buch. Es enthält drei Erzählbände von Borges: Universalgeschichte der Niedertracht (1934), Fiktionen (1944) und Das Aleph (1949). Während die Universalgeschichte der Niedertracht hauptsächlich Biographien von Betrügern, Seeräubern, Mördern und anderen Verbrechern enthält (Borges hat auch später noch eine große Neigung dazu gehabt, obskure Biographien, Fakten und Fiktionen zu sammeln), finden sich auch Paraphrasen von Erzählungen aus anderen Quellen. Fiktionen bringt zahlreiche phantastische Erzählungen, die zumeist einen einzigen zentralen Gedanken oder ein einziges zentrale Motiv in die Konsequenzen ausspinnen; darunter findet sich auch die oben vorgestellte Bibliothek von Babel. Das Aleph kann als eine Fortsetzung und Mischung der Tendenzen der beiden Vorgängerbände angesehen werden.
Borges, der immer nur in kleinen Formen (Erzählung, Anekdote, Lemma, Gedicht) exzelliert hat, muss als einer der ganz großen Meister der Literatur des 20. Jahrhunderts angesehen werden. Die Fülle seines oft entlegenen Wissens, seiner originellen Einfälle und seiner ausgesuchten Sprache machen jedes seiner Bücher zu einem gänzlich eigenen Lese-Abenteuer. Jeder und jedem, der ihn noch nicht gelesen hat, sei geraten, es mit zumindest einem der beiden Erzählbände aus der Hanser-Werkausgabe (insgesamt 12 Bände) zu versuchen; alle Bände der Ausgabe sind zu Taschenbuch-Preisen als eBooks verfügbar.
Jorge Luis Borges: Der Erzählungen erster Teil. Aus dem Spanischen übersetzt von Karl August Horst, Wolfgang Luchting und Gisbert Haefs. Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Band 5. München: Hanser, 42019. Kindle Edition. 459 Seiten. 11,99 €.