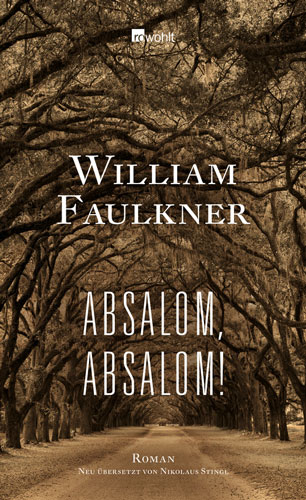«Mein Gott, was ist der Süden herrlich, wie? Besser als im Theater, wie? Besser als Ben Hur, wie? Kein Wunder, dass ihr da ab und zu mal wegmüsst.»
Es ist eine sehr schöne Entscheidung, unmittelbar auf die Neuübersetzung von „Schall und Wahn“ die von „Absalom, Absalom!“ folgen zu lassen, auch wenn in der Chronologie der Werke Faulkners sieben Jahre und vier Romane zwischen diesen beiden Büchern liegen. Der Grund ist, dass in „Absalom, Absalom!“ Quentin Compson einer der Protagonisten und Erzähler ist, dessen wahrscheinlich letzten Lebenstag im Harvard des Jahres 1910 wir im zweiten Abschnitt von „Schall und Wahn“ mitverfolgt haben. Auf diese Weise bekommt der Leser einen Sinn dafür, wie die meisten Texte Faulkners miteinander in Verbindung stehen und zusammen eine einzige Welt entstehen lassen, deren Vorbild allerdings, als Faulkner seine Romane niederschreibt, als bereits endgültig untergegangen und verloren angesehen werden musste.
„Absalom, Absalom!“ besteht wesentlich aus zwei großen Erzählzusammenhängen, die durch Quentin Compson als Augenzeugen, Erzähler und Wiedererzähler miteinander verbunden sind. Die ersten Kapitel schildern einen Tag im September 1909, unmittelbar bevor Quentin zum Studium nach Harvard aufbricht. Er wird von der alten Miss Rosa Coldfield aufgefordert, ihn zu besuchen, um ihn zu überreden, mit ihr einen nächtlichen Ausflug zum Haus ihrer seit langem verstorbenen Schwester Ellen Sutpen (geb. Coldfield) zu machen. Halb von Miss Rosa, halb von seinem Vater bekommt Quentin an diesem Tag ein Gutteil der Tragödie der Familie Sutpen erzählt: Wie ihr Begründer Thomas Sutpen im Jahr 1833 in Begleitung einer Gruppe von Sklaven und eines französischen Architekten in Jefferson auftaucht, sich Indianerland außerhalb von Jefferson verschafft (keiner weiß genau, wie das vor sich gegangen ist), dort das größte Haus der Gegend errichtet und beginnt, auf seiner Plantage Sutpens Hundred Baumwolle anzubauen, sich dann mit der Tochter eines kleinen Kaufmanns in Jefferson verlobt, wahrscheinlich durch eine fragwürdige Spekulation mit dem Geld seines Schwiegervaters zu Reichtum kommt, die Verlobte heiratet und mit ihr zwei Kinder zeugt, Henry und Judith Sutpen, die in der Isolation des Herrenhauses von Sutpens Hundred groß werden.
Das Unglück beginnt über die Familie hereinzubrechen, als Henry die damals neue Universität Oxford besucht und dort Freundschaft mit Charles Bon schließt, einem ein wenig älteren Mann, zu dem er nahezu sofort eine vertraute Freundschaft beginnt. Schon bald steht für ihn fest, dass Charles der einzige Mann ist, denn er sich für seine Schwester wünschen würde, und so bringt er ihn bei nächster Gelegenheit mit zu sich nach Haus. Charles verhält sich bei diesem Besuch mehr als korrekt, aber Judiths Mutter Ellen ist sofort von dem Gedanken überwältigt, hier den idealen Schwiegersohn vor sich zu haben, und sie posaunt die Verlobung zwischen Judith und Charles überall heraus, bevor zwischen den jungen Leuten auch nur ein Wort über eine solche Verbindung gesprochen worden ist.
Zum Eklat kommt es am folgenden Weihnachtsfest: Thomas Sutpen hat eine Aussprache mit seinem Sohn Henry, der daraufhin zusammen mit Charles vorgeblich für immer das Haus seines Vaters verlässt. Der Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs 1861 hält die sich anbahnende Familienkatastrophe noch für vier Jahre in der Schwebe, doch Ellen Sutpen ist vom Scheitern ihrer Ehepläne für die Tochter so erschüttert, dass sie sich in ihr Zimmer zurückzieht und über zwei Jahre hin langsam stirbt. Als Henry und Charles, die zusammen beim selben Südstaaten-Regiment gedient haben, nach dem Ende des Krieges gemeinsam wieder auf Sutpens Hundred eintreffen, erschießt Henry Charles unmittelbar nach der Ankunft und flieht anschließend, um nicht für den Mord zur Verantwortung gezogen werden zu können.
Quentin wird von seinem Vater in dem Glauben bestärkt, Thomas Sutpen hätte seinem Sohn Henry an jenem Weihnachtsabend des Jahres 1860 offenbart, dass Charles in New Orleans bereits mit einer Farbigen verheiratet sei, mit der er auch einen Sohn habe, und dass deshalb eine Heirat mit Judith nicht in Frage komme. Quentin hält es allerdings für unwahrscheinlich, dass die Beziehung eines weißen Mannes zu einer schwarzen Frau, selbst wenn es sich tatsächlich um eine Ehe gehandelt haben sollte, einen ausreichenden Grund für das Verhalten Henrys darstellen würde. So bleibt das Geschehen vorerst unzureichend geklärt; auch über die nächtliche Fahrt mit Miss Rosa hinaus zu Sutpens Hundred erfährt der Leser erst am Ende des Buches näheres.
Der zweite große Erzählzusammenhang beginnt einige Monate später, im Januar 1910 in Harvard. (In diesem Zusammenhang ist auf einen sehr unglücklichen Druckfehler hinzuweisen: Am Anfang von Kapitel 6 ist der Brief, den Quentin von seinem Vater erhält und der ihn über den Tod von Miss Rosa informiert, auf den 10. Januar 1919, statt richtig 1910 datiert; das könnte bei Lesern, die versuchen, die innere Chronologie der Abläufe zu konstruieren doch zu einiger Verwirrung führen, insbesondere auch bei denen, die aus „Schall und Wahn“ erinnern, dass Quentin Compson sich im Juni 1910 das Leben nimmt.) Quentin hat seinem Mitbewohner Shrevlin McCannon, einem kanadischen Studenten, die Geschichte der Sutpens, soweit er sie kennt, erzählt.
Aus dem Brief des Vaters erfahren Quentin, Shrevlin und der Leser nun eine weitere Schicht der Tragödie der Familie Sutpen: Thomas Sutpen hatte dem Großvater Quentins erzählt, dass er bereits verheiratet war, bevor er zum ersten Mal in Jefferson auftauchte. Als Sohn aus ärmlichsten Verhältnissen hatte er auf Haiti sein Glück gesucht, dort einem Plantagenbesitzer bei einem Sklavenaufstand beigestanden und anschließend dessen Tochter geheiratet. Mit ihr hat er einen Sohn gezeugt, eben jenen Charles Bon, den sein Sohn Henry auf der Universität kennenlernen sollte. Doch hat er seine erste Frau verstoßen, die Ehe wurde geschieden und Thomas Sutpen, der auf das Erbe und die Mitgift seiner ersten Frau verzichtet, baute sich in Jefferson ein neues Leben auf. Die Heirat zwischen Judith und Charles verbietet sich also, da es sich um Halbgeschwister handelt.
Aber auch diese neue Wendung lässt Fragen offen: Wieso hat Henry Charles nach Ende des Krieges überhaupt nach Sutpens Hundred zurückgebracht, um ihn dann dort zu erschießen, bevor er Judith wiedersehen konnte? Wieso hat Charles Judith zuvor noch einen Brief geschrieben, indem er ihre Heirat als eine nun beschlossene Sache ankündigte? War es tatsächlich Zufall, dass sich Charles und Henry in Oxford getroffen haben? Um diese und andere offene Fragen zu beantworten, konstruieren nun Quentin und Shrevlin zusammen eine weitere Ebene der Familiengeschichte, die auf eine Pointe hinausläuft, die hier nicht verraten werden soll.
„Absalom, Absalom!“ (der Titel geht auf die biblische Geschichte um Abschalom, einen Sohn König Davids, zurück, der seinen Halbbruder Amnon umbringen lässt, nachdem der Abschaloms Schwester Tamar vergewaltigt hatte (2. Samuel 13); „Absalom, Absalom!“ ist der Klageruf König Davids, als er vom Tod seines aufsässigen und widerspenstigen Sohns erfährt (2. Samuel 19), ist ein bewusst an den großen Tragödien der Antike und Shakespeares orientierter Roman, der den Untergang der Familie Sutpen und den der Südstaaten miteinander parallelisiert. Das Buch stellt besonders im ersten Drittel einige Ansprüche an seine Leser, da sich die Zusammenhänge unter den Figuren, die Position der jeweiligen Erzähler etc. erst peu à peu offenbaren. Hinzukommen die sehr anspruchsvolle grammatikalische Struktur und die Länge vieler Sätze, die einen Einstieg in den Roman zusätzlich schwierig machen; ein wenig Geduld ist auf Seiten der Leser also schon erforderlich.
Man muss dem Übersetzer Nikolaus Stingl das Kompliment machen, dass er besonders das erste, sprachlich und strukturell sehr anspruchsvolle Drittel des Romans meisterlich übersetzt hat. Andererseits erlaubt sich die Übersetzung hier und da einige Freiheiten bei der Übertragung, mit denen wenigstens ich nicht ganz glücklich geworden bin; auch wird der bei Faulkner sorgfältig nachgeahmte starke Dialekt vieler Schwarzer wie so oft in einer recht sanften und zurückhaltenden Weise im Deutschen wiedergegeben. Und ob ich mich getraut hätte, in einem Roman, dessen Titel bereits auf das zentrale strukturelle Motiv der Wiederholung verweist, nicht jede wortwörtliche Wiederholung auch in der Zielsprache entsprechend nachzubauen, bezweifle ich.
Insgesamt muss man aber festhalten, dass diese Übersetzung einmal mehr einen entscheidenden Fortschritt für die Wahrnehmung Faulkners im deutschen Sprachraum darstellt, so sie denn gelesen werden sollte. Dies liegt auch daran, dass die alte Übersetzung von Hermann Stresau aus dem Jahr 1938 auf den vom amerikanischen Verlag der Erstausgabe bearbeiteten Text zurückgeht und nicht auf die Rekonstruktion von Faulkners Original, die erst seit 1986 im Druck vorliegt. Dass mit dieser Neuausgabe den deutschen Lesern zum ersten Mal der korrigierte Text von „Absalom, Absalom!“ zugänglich gemacht wird, findet übrigens nirgendwo im Buch Erwähnung. In diesem Fall hätte ein, wenn auch noch so kurzes Nachwort dem Buch gut getan. Entschädigt werden die Leser dafür mit einer übersetzten Version der von Faulkner handgezeichneten Karte des Yoknapatawpha County, einer Chronologie der Ereignisse und einem genealogisch geordneten Personenverzeichnis (in dem sich leider gleich der zweite Druckfehler bei einer Jahreszahl findet).
Wie auch bei den Bänden zuvor ist festzuhalten: Diese Reihe der Neuübersetzungen der Romane Faulkners ist eine wirkliche Gelegenheit für deutschsprachige Leser, einen der großen amerikanischen Erzähler des 20. Jahrhunderts (wieder) zu entdecken, und es sind uns noch viele weitere Bände zu wünschen!
William Faulkner: Absalom, Absalom! Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Reinbek: Rowohlt, 2015. Pappband, Lesebändchen, 478 Seiten. 24,95 €.
 Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die erste Hälfte der 1890er Jahre für Henry James so etwas wie eine Wendezeit dargestellt hat: Der Tod seiner Schwester Alice 1892, der Selbstmord seiner Freundin Constance Fenimore Woolson 1894 und nicht zuletzt sein Scheitern als Bühnenautor mit der Premiere von „Guy Domville“ Anfang 1895 bilden die Eckpunkte eine Krise, die zu seiner Neuerfindung als Romanautor führen. Der kleine Roman “The Spoils of Poynton” erschien 1897 und ist nach “The Other House” der zweite Roman, der Ergebnis dieser Neubesinnung war. Der Roman dürfte in Deutschland zu den unbekannteren von James gehören; Manesse legt ihn in seiner Reihe von Neuübersetzungen in einer Übertragung von Nikolaus Stingl erneut vor.
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die erste Hälfte der 1890er Jahre für Henry James so etwas wie eine Wendezeit dargestellt hat: Der Tod seiner Schwester Alice 1892, der Selbstmord seiner Freundin Constance Fenimore Woolson 1894 und nicht zuletzt sein Scheitern als Bühnenautor mit der Premiere von „Guy Domville“ Anfang 1895 bilden die Eckpunkte eine Krise, die zu seiner Neuerfindung als Romanautor führen. Der kleine Roman “The Spoils of Poynton” erschien 1897 und ist nach “The Other House” der zweite Roman, der Ergebnis dieser Neubesinnung war. Der Roman dürfte in Deutschland zu den unbekannteren von James gehören; Manesse legt ihn in seiner Reihe von Neuübersetzungen in einer Übertragung von Nikolaus Stingl erneut vor.