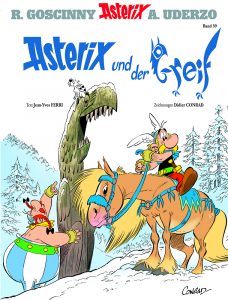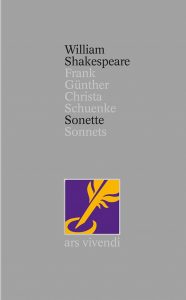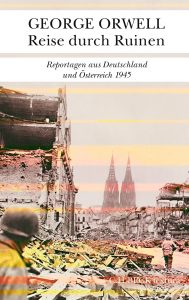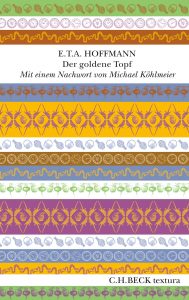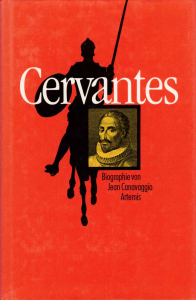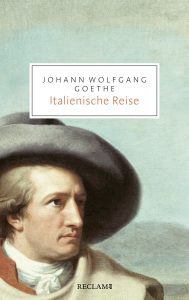Miguel de Cervantes hat für einen Schriftsteller – wenigstens nach unseren bürgerlichen Vorstellungen – ein recht abenteuerliches Leben geführt. Er wurde geboren in dem Jahr, als der Konquistador Hernán Cortés starb, also noch unter der Herrschaft Karls I., als eines von sieben Kindern eines Wundarztes, der seine Familie mehr schlecht als recht über die Runden brachte. Er machte schon in seiner Kindheit zusammen mit seiner Familie eine unruhige Wanderzeit durch, die sein Leben für sehr lange Zeit prägen sollte. Trotz der Armut seiner Familie erhält Miguel eine solide Schulbildung, man spekuliert, ob in einer jesuitischen Schule in Córdoba; ein nachfolgendes Studium der Theologie, das ihm einige Biographen zuschreiben, ist nicht nachweisbar. Wahrscheinlich träumt er in diesen Jahren schon von einer Karriere als Schriftsteller.
Bevor er überhaupt Zeit gehabt hätte, sich an einer Universität einzuschreiben, flieht er nach Italien, wahrscheinlich um sich einer Verhaftung aufgrund eines Duells zu entziehen, arbeitet dort kurzzeitig als Kammerdiener für den späteren Kardinal Giulio Acquaviva und tritt dann ins spanische Heer ein, wird also Teil der spanischen Besatzungsmacht in Italien. Er nimmt zusammen mit seinem jüngeren Bruder Rodrigo als Soldat an der Seeschlacht von Lepanto teil, wird dort von drei Kugeln verletzt, von denen eine seine linke Hand durchschlägt und unbrauchbar macht.
Da die Kriegstätigkeit der Spanier danach in eine etwas ruhigere Phase eintritt, entschließt er sich, zusammen mit Rodrigo nach Spanien zurückzukehren, doch kurz vor der Ankunft wird das Schiff von Piraten aufgebracht und alle Passagiere als Sklaven bzw. Geiseln nach Algier verschleppt. Da Miguel Empfehlungsschreiben hoher Militärs bei sich hat, vermutet man in ihm und seinem Bruder lohnende Geisel, so dass beide gefangengesetzt, aber nicht als Sklaven verkauft werden. Miguel wird fünf Jahre in Algier bleiben, bis es endlich gelingt, ihn freizukaufen und nach Spanien zurückzubringen. In diesen fünf Jahren unternimmt er vier erfolglose Fluchtversuche; am Ende steht er kurz davor, als Galeerensklave eingesetzt zu werden, als buchstäblich in letzter Minute sein Freikauf gelingt. Nach zehn Jahren Abwesenheit kehrt Miguel im Dezember 1580 zu seiner Familie zurück.
In der Folgezeit arbeitet er zum einen an seinem ersten Roman Galatea – einem Schäferroman, wie sie damals überaus beliebt waren –, dessen erster Teil 1585 erscheint (der zweite Teil wurde wohl nie geschrieben). Zum anderen versucht er gleichzeitig als Veteran und ehemalige Geisel vom Hof eine Sinekure zu erhalten, doch ist seine Familie dafür offenbar nicht einflussreich genug. Nicht, dass man ihm bei seinem Schicksal nicht entgegenkommen möchte, aber nur, indem man ihn mit konkreten Missionen beauftragt, die zwar bezahlt werden, aber das Wann ist eher ungewiss. So schlägt sich Cervantes ab 1587 jahrelang als Kommissar zur Requirierung von Öl und Getreide für die spanische Flotte durchs Leben. Das bedeutet nicht nur umständliche Verhandlungen mit unwilligen Bauern und Magistraten, die die unzuverlässige Zahlweise des königlichen Schatzamtes kennen und ihre Ernte lieber auf dem freien Markt anbieten möchten, Cervantes hat sich auch selbst ständig mit der Finanzbehörde herumzuschlagen, ist böswilligen Verleumdungen ausgesetzt und gerät einmal sogar wegen eine falschen Beschuldigung kurzzeitig ins Gefängnis.
Erst Mitte 1594 gibt er dieses Geschäft auf, um Steuereintreiber zu werden. Seine Besoldung kann er in diesem Fall direkt von den eingetriebenen Steuern in Abzug bringen, was ihm aber nichts nützt, da er die gesamten eingezogenen Gelder bei einem Kaufmann hinterlegt, der das zum Anlass nimmt, einen betrügerischen Bankrott zu veranstalten und sich mit dem Bargeld aus dem Staub zu machen. Zwar gelingt es Cervantes, die Steuergelder aus der Konkursmasse zu retten, sein eigenes Geld aber ist unrettbar verloren. Auch diese Affäre geht nicht ohne einen erneuten Gefängnisaufenthalt ab.
Ab 1598 wieder frei, beginnt Cervantes mit der Arbeit am Don Quijote, an dessen erstem Teil er über sieben Jahre hinweg arbeiten wird. Als der Roman Anfang 1605 in Madrid erscheint, macht er seinen Autor nahezu sofort zu einem der bekanntesten Schriftsteller, und das innerhalb weniger Monate nicht nur in Spanien sondern in ganz Europa und Südamerika (bereits im Februar 1605 wird ein erstes Kontingent des Buches nach Peru exportiert). Von dieser Zeit an scheint Cervantes in der Hauptsache als Autor gelebt zu haben.
Neben 16 Theaterstücken erscheinen in den elf Jahren bis zu seinem Tod – in denen Cervantes übrigens ein weiteres Mal für kurze Zeit ins Gefängnis geworfen wird – noch die Novellas Exemplares (ein weiterer europaweiter Erfolg), ein poetologisches Versepos Die Reise zum Parnass und schließlich im November 1615 der 2. Teil des Don Quijote, nachdem bereits im Jahr zuvor ein pseudonymer 2. Teil erschienen war, der sich nicht nur an den Erfolg des Buches anhängen wollte, sondern dessen Vorwort auch eine üble Beschimpfung des Original-Autors enthielt. Cervantes geht sowohl in der Vorrede als auch im Text seines eigenen 2. Teils auf diese Fälschung und besonders auf die Verleumdungen ein und zahlt es dem anonymen Fälscher mit besserer Münze heim. Am 22. April 1616 – so jedenfalls sein Biograph Canavaggio – stirbt Cervantes in Madrid. Postum erscheint 1617 sein letzter Roman Die Irrfahrten von Persiles und Sigismunda.
All dies schildert in erstaunlicher Detailfülle die musterhafte akademische Biographie Canavaggios, der als einer der bester Kenner Cervantes’ gelten muss. Sein Buch ist – soweit ich das sehe – immer noch die präziseste Beschreibung dieses Lebens, obwohl es bereits aus dem Jahr 1986 stammt. Canavaggio liefert nicht nur die bekannten Tatsachen, sondern auch die zahlreichen biographischen Spekulationen und Legenden seiner Kollegen, jeweils mit einer exakten und verlässlichen Einordnung. Zudem werden der historische Hintergrund und die sehr dynamische ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung Spaniens während der Lebenszeit Cervantes’ kurz und eingängig vermittelt. Dabei ist das Buch durchweg gut lesbar und klar strukturiert. Bei all diesen Vorteilen ist es selbstverständlich, dass es nicht mehr im Druck ist und nur noch antiquarisch erworben werden kann.
Jean Canavaggio: Cervantes. Aus dem Franzöischen von Enrico Heinemann und Ursel Schäfer. Zürich u. München: Artemis, 1989. Leinen, 387 Seiten. Nicht mehr lieferbar.