Diesmal mit einem besonderen Gruß an Helmut Markwort.
An »die Leser« denke ich nicht. Unter ihnen mögen vortreffliche und gebildete Leute sein: man macht schauerliche Erfahrungen mit ihnen.
Karl Kraus
Lektüren eines Nachtwächters
Diesmal mit einem besonderen Gruß an Helmut Markwort.
An »die Leser« denke ich nicht. Unter ihnen mögen vortreffliche und gebildete Leute sein: man macht schauerliche Erfahrungen mit ihnen.
Karl Kraus
 What a book! Ian McEwan war mir bislang nur dem Namen und einigen Titeln nach geläufig, und ich will gleich vorweg betonen, dass mich die Dichte und Intensität dieses Buches überwältigt haben! »Abbitte« ist ein gewaltiges Buch, ein Buch der Reflexion, der Introspektion, der erlebten Rede. Die wenigen Figuren, die im Fokus stehen, sind von einer Einprägsamkeit und Schlüssigkeit, wie man sie nur selten findet. Die sparsame Handlung ist der Figurenpsychologie deutlich nachgeordnet, obwohl es gerade die ausgefeilte Anfangskonstellation ist, die die differenzierte psychologische Darstellung fundiert und überhaupt erst ermöglicht.
What a book! Ian McEwan war mir bislang nur dem Namen und einigen Titeln nach geläufig, und ich will gleich vorweg betonen, dass mich die Dichte und Intensität dieses Buches überwältigt haben! »Abbitte« ist ein gewaltiges Buch, ein Buch der Reflexion, der Introspektion, der erlebten Rede. Die wenigen Figuren, die im Fokus stehen, sind von einer Einprägsamkeit und Schlüssigkeit, wie man sie nur selten findet. Die sparsame Handlung ist der Figurenpsychologie deutlich nachgeordnet, obwohl es gerade die ausgefeilte Anfangskonstellation ist, die die differenzierte psychologische Darstellung fundiert und überhaupt erst ermöglicht.
Der Roman ist in drei Teile und einen Epilog gegliedert: Der erste Teil erzählt von einem einzigen Sommertag des Jahres 1935 auf dem Schloss der Familie Tallis. Anwesend sind außer der Hausherrin Emily Tallis ihre beiden Töchter Cecilia und Briony, 23 und 13 Jahre alt, Robbie Turner, der vom Hausherrn geförderte Sohn einer Bediensteten, sowie die Nichte Lola und zwei Neffen der Hausherrin. Im Laufe des Tages kommt noch Cecilias und Brionys Bruder Leon hinzu, der als Gast einen jungen, erfolgreichen Unternehmer, Paul Marshall, mitbringt. Der Hausherr befindet sich in London, wo ihn seine beruflichen Pflichten in einem Ministerium und eine Geliebte festhalten.
Die eigentliche Handlung des ersten Teils, der etwa die Hälfte des Romans umfasst, zusammenzufassen, fällt schwer, da er überaus reich an Perspektivwechseln und Mißverständnissen ist. Er ist in 13 Abschnitte gegliedert, die jeweils aus einer wechselnden personalen Perspektive erzählt sind. Wesentlich ist, dass sich an diesem Tag aus der Kinder- und Jugendfreundschaft zwischen Cecilia und Robbie eine leidenschaftliche Liebe entwickelt, was aufgrund einer Reihe von Zufällen, Mißverständnissen und Fehlleistungen in Briony den Eindruck wachruft, bei Robbie Turner handele es sich um einen »Psychopathen«, ohne dass sie eine genaue Vorstellung davon hat, was das bedeuten soll. Dieses Vorurteil, dessen Entstehung skrupulös nachgezeichnet wird, führt sie dazu, Robbie wenige Stunden später der Vergewaltigung ihrer Kusine Lola zu bezichtigen, obwohl sie sich schon zu diesem Zeitpunkt darüber im Klaren ist, dass sie den Täter im Dunkel der Nacht nicht wirklich erkannt hat.
Teil zwei spielt etwa fünf Jahre später: Robbie Turner ist nach dreieinhalb Jahren im Gefängnis in die Armee entlassen worden und befindet sich zusammen mit zwei Unteroffizieren auf der Flucht vor den deutschen Truppen Richtung Dünkirchen. Er ist verletzt, trägt einen Schrapnellsplitter in sich herum. Wir erfahren, dass sich Cecilia von ihrer Familie getrennt hat, in der Zeit, in der Robbie im Gefängnis war, Krankenschwester geworden ist und auf Robbies Rückkehr nach England wartet. Auch ihre Schwester Briony, die eigentlich Schriftstellerin hatte werden wollen, ist inzwischen in der Ausbildung zur Krankenschwester, und wir lesen in einem Brief Cecilias an Robbie, dass sich Briony inzwischen bewusst ist, was ihre Aussage angerichtet hat und sie sich auch sicher ist, wer der tatsächliche Vergewaltiger Lolas war. Der Abschnitt enthält eine intensive Schilderung der Flucht Robbies unter wiederholten Angriffen der deutschen Luftwaffe. Robbie und seine Begleiter erreichen zwar Dünkirchen, aber der Bericht wird zunehmend von den Fieberphantasien Robbies überlagert und bricht ab, bevor wir erfahren, ob Robbie lebend ausgeschifft wurde.
Teil drei berichtet über annähernd denselben Zeitraum wie Teil zwei, diesmal aus Brionys Sicht: Sie ist als Lehrschwester in einem Londoner Krankenhaus beschäftigt und muss die erste Welle verletzter Soldaten, die aus Frankreich herüberkommen, versorgen. Es sind diese Erfahrungen, die Briony endgültig erwachsen werden lassen und sie dazu bringen, sich der Verantwortung für ihre Lüge zu stellen. Am nächsten freien Tag besucht sie die Hochzeit ihrer Kusine Lola mit Paul Marshall und sucht anschließend ihre Schwester auf, die sie seit fünf Jahren nicht mehr gesprochen hat. Dort findet sie auch Robbie vor, der ihr aufträgt, ihre Eltern von ihrer Lüge in Kenntnis zu setzen, sie auch vor einem Notar zu bezeugen und ihm einen Brief zu schreiben, in dem sie ausführlich die Umstände schildert, die zu ihrer Lüge geführt haben. Nicht versöhnt, aber doch einander wieder angenähert, trennen sich Cecilia, Robbie und Briony auf dem Londoner U-Bahnhof Balham. Der Abschnitt schließt mit der Unterschrift:
BT
London 1999
Die weiteren Überraschungen, die der Epilog noch bereit hält, sollen hier nicht verraten werden.
Sowohl die intensiven Beschreibungen der Kriegsschrecken als auch die Figurenpsychologie zeichnen dieses Buch aus. Ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor so klare und zugleich detaillierte und stimmig entwickelte psychologische Portraits gleich mehrerer Figuren gelesen zu haben. Ohne Frage eines der letzten Meisterwerke des 20. Jahrhunderts!
Ian McEwan: Abbitte. Aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Zürich: Diogenes, 2002. Lizenzausgabe für die SPIEGEL-Edition: Hamburg, 2006. Pappband, 507 Seiten. 9,90 €.
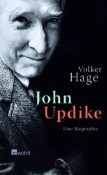 Updike gehört zu jenen nordamerikanischen Autoren, die über die Jahre auch eine treue deutsche Leserschaft erworben haben. Seit dem Weltbestseller »Ehepaare« (»Couples«, 1968, dt. 1969) ist das Erscheinen eines Romanes von Updike auch in Deutschland ein wichtiges literarisches Ereignis. Updike ist mit einer bewundernswerten Produktivität und Kontinuität gesegnet und hat weit mehr als das von ihm zu Anfang seiner Karriere angestrebte Soll von einem Buch pro Jahr vorgelegt. Etwa alle zwei Jahre erscheint ein umfangreicher Roman und man ist schon sehr beschäftigt, wenn man auch nur als Leser mit Updikes Produktion Schritt halten will.
Updike gehört zu jenen nordamerikanischen Autoren, die über die Jahre auch eine treue deutsche Leserschaft erworben haben. Seit dem Weltbestseller »Ehepaare« (»Couples«, 1968, dt. 1969) ist das Erscheinen eines Romanes von Updike auch in Deutschland ein wichtiges literarisches Ereignis. Updike ist mit einer bewundernswerten Produktivität und Kontinuität gesegnet und hat weit mehr als das von ihm zu Anfang seiner Karriere angestrebte Soll von einem Buch pro Jahr vorgelegt. Etwa alle zwei Jahre erscheint ein umfangreicher Roman und man ist schon sehr beschäftigt, wenn man auch nur als Leser mit Updikes Produktion Schritt halten will.
Volker Hage hat seit 1983 sechs umfangreiche Interviews mit John Updike geführt und kann wohl als einer der deutschen Kenner des Werks bezeichnet werden. Mit diesem Band legt er die erste deutsche Biographie Updikes überhaupt vor, dessen Romane komplett, dessen Erzählungen weitgehend und dessen Essays und Gedichte wenigstens in Auswahl auf Deutsch vorliegen. Da das äußere Leben Updikes nicht so sehr abwechslungsreich verlaufen ist, ist das schmale Bändchen zugleich eine Einführung in das Werk, die die Romane (inklusive des 2006 erschienenen Buchs »Terrorist«) und die wichtigsten Erzählungen in den Mittelpunkt stellt.
Hage geht mit Updike insgesamt sehr freundlich um, selbst an den Stellen, an denen er seine Bücher offensichtlich nicht besonders goutiert: So fällt etwa die Besprechung von »Terrorist« ungewöhnlich distanziert aus, zugleich lobt Hage an dem Buch aber, was er nur loben kann. Eine solche Herangehensweise ist für eine so kurze und zugleich konkurrenzlose Biographie sicherlich angemessen.
Allerdings handelt es sich bei dem Büchlein in anderer Hinsicht um eine Mogelpackung: Umfang, Layout und Aufbau des Bandes machen ihn zu einem typischen Vertreter der »rororo Monographien«. Nun scheint man bei Rowohlt schließlich doch bemerkt zu haben, dass man sonst über keine Biographie des Hausautors Updike verfügt, und so hat man sich entschlossen, den Band durch einen festen Pappeinband und einen Schutzumschlag aufzuwerten. Diese »Zusatzausstattung« lässt man sich vom Käufer mit einem satten Aufschlag honorieren: Mit 16,90 € kostet das Buch beinahe das Doppelte eines Bandes der Monographien-Reihe. Die Verantwortlichen des Rowohlt-Verlages mögen sich einmal das Preis-Leistungs-Verhältnis der Reihe »dtv portrait« anschauen, die zwar nur mit einem Softcover, dafür aber mit Fadenheftung ausgestattet ist – und das zum selben Preis wie die »rororo Monographien«.
Das Buch kann uneingeschränkt zur Einführung empfohlen werden, macht aber zugleich das Fehlen einer umfangreichen und kritischen Updike-Biographie spürbar.
Volker Hage: John Updike. Eine Biographie. Reinbek: Rowohlt, 2007. Pappband, 159 Seiten. 16,90 €.
»Ein guter Jahrgang« von Peter Mayle ist ein seichter, routiniert geschriebener Unterhaltungsroman über den Londoner Börsenmakler Max Skinner, der, gerade als er seinen Job hingeworfen hat, erfährt, dass sein Onkel Henry verstorben ist und ihm ein Weingut in der Provence vermacht hat. Da er sowieso nichts Besseres zu tun hat, fährt er nach St. Pons im Luberon, um sich anzuschauen, ob sich das Gut gewinnbringend verkaufen lässt. Die weitere Handlung ist ebenso beliebig wie unerheblich: Ein wenig Verbrechen, ein bißchen Liebesgeschichte, eine uneheliche Tochter Henrys usw. usf. Ein Buch zum Zeitvertreib, das auch nicht viel länger als einen Sommertag hält.

Entstanden ist die Idee zu diesem Buch aus einem Gespräch zwischen Ridley Scott und Peter Mayle (beide in der Provence ansässige Engländer, Nachbarn und Freunde) auf der Silversterfeier Mayles im Jahr 2002 über die Erfahrungen, die ein Engländer in Frankreich so machen kann. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass Scott nur wenige Monate nach Erscheinen des Romans in der Provence frei nach der Buchvorlage einen Film gedreht hat: »Ein gutes Jahr«. Der Film ist hochkarätig besetzt (Russell Crowe, Albert Finney, Didier Bourdon), ansonsten aber ebenso seicht und routiniert wie das Buch. Das Drehbuch hat erheblich in die Romanvorlage eingegriffen, insbesondere die Frauengestalten sind weit weniger eindimensional und blass als bei Mayle. Ein ganz netter Film, der einmal mehr zeigt, dass Ridley Scotts Filme vom Licht her konzipiert sind und nicht von der Handlung.
Peter Mayle: Ein guter Jahrgang. Aus dem Englischen von Ursula Bischoff. München: Blessing, 2004. Pappband, 288 Seiten. 18,– €.
Ein gutes Jahr. Ridley Scott, USA, 2006. DVD (Region 2), 20th Century Fox. Länge: ca. 113 Minuten. Sprachen: Deutsch und Englisch. Extras: Kommentar (inkl. Making-of) von Regisseur und Drehbuch-Autor. FSK: o. Altersbeschr. Preis: ca. 18,– €.
Quinten ging mit seiner Blockflöte zum Weiher, in die Umarmung der Rhododendren. Unbenutzt lag das Instrument den ganzen Nachmittag in seinem Schoß; als es dämmerte, blieb er vor seiner Hütte sitzen. Es war ein bedeckter Frühlingstag, es ging kein Wind, und durch das ölig glänzende Wasser zog ab und zu das Spiegelbild eines Vogels.
Harry Mulisch
Die Entdeckung des Himmels
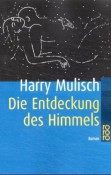 Angesichts des bevorstehenden 80. Geburtstags von Harry Mulisch habe ich mich entschlossen, endlich einen seiner Romane zu lesen: »Die Entdeckung des Himmels« hat es immerhin auf Platz 25 der ZDF-Liste der Lieblingsbücher der Deutschen geschafft, noch vor »Die Entdeckung der Langsamkeit« und »Die unerträgliche Seichtigkeit des Leims«. Aber wer weiß schon, ob das ein ausreichendes Qualitätskriterium ist.
Angesichts des bevorstehenden 80. Geburtstags von Harry Mulisch habe ich mich entschlossen, endlich einen seiner Romane zu lesen: »Die Entdeckung des Himmels« hat es immerhin auf Platz 25 der ZDF-Liste der Lieblingsbücher der Deutschen geschafft, noch vor »Die Entdeckung der Langsamkeit« und »Die unerträgliche Seichtigkeit des Leims«. Aber wer weiß schon, ob das ein ausreichendes Qualitätskriterium ist.
»Die Entdeckung des Himmels« spielt auf zwei Ebenen: Zum einen im jüdisch-christlichen und eventuell auch moslemischen Himmel, wo sich zwei offenbar geistige Potenzen über ein geheimnisvolles Projekt unterhalten, »das Retournieren des Testimoniums« [S. 416]. Der überwiegende Teil des Textes handelt aber in ganz irdischen Verhältnissen: Erzählt wird die Geschichte von drei bzw. vier Personen: Onno Quist, Sohn eines ehemaligen Ministerpräsidenten der Niederlande und während der meisten Zeit Berufspolitiker, Max Delius, Sohn eines ehemaligen Kriegsverbrechers und einer Jüdin, von Beruf Astronom, sowie Ada Brons, Tochter eines Antiquars und Cello-Spielerin. Hinzukommt ihr mutmaßlich durch direktes himmliches Eingreifen zu dritt gezeugter Sohn Quinten (wegen des ⅔-Frequenzverhältnisses der Quinte so benannt), der sich als Erfüller eines himmlischen Auftrags erweisen wird.
Bevor es aber auf den letzten etwa 200 von gut 800 Seiten dazu kommt, müssen erst einmal die Eltern aufeinandergehetzt werden, unter Verwirrungen nach Kuba reisen, um dort das Kind zu zeugen, in einem Unwetter einen Unfall erleiden, bei dem Ada von der mutmaßlichen Mutter zu einer komatösen Gebärerin reduziert wird, Onno Politiker und anschließend Einsiedler, Max von einem Meteoriten erschlagen werden und Quinten umständlichst aufwachsen und sich schließlich auf die Suche nach seinem untergetauchten Vater machen, den er dann auch zufällig in Rom trifft.
Danach dreht der Roman vollständig durch: Quinten identifiziert in Rom die Papstkapelle Sancta Sanctorum im Lateran aufgrund wüster Spekulationen als Lagerort der echten mosaischen Steintafeln mit den zehn Geboten. Quinten und Onno finden und rauben diese Tafeln in einer nächtlichen Aktion und bringen sie nach Jerusalem, wo sich Quinten in einem von innen verschlossenen Zimmer und die Tafel in einem verschlossenen Safe in Nichts auflösen – natürlich kehren sie in die himmlischen Gefilde zurück, von wo aus das Ganze mit englischer List inszeniert wurde.
Sehen wir von dem hanebüchenen Ende des Romans einmal ab und befreien wir ihn damit zugleich von dem himmlischen Drahtzieher, so ist das Buch in Teilen ein ganz angängiger und interessanter Roman. Der Autor hat zwar eine schwere Neigung zum Geschwätz und dazu, seine Klippschulbildung seinen Figuren als raunendes Geheimnis in den Mund zu legen, aber abgesehen davon ist der Text recht ordentlich geraten. Wenn er auf 400 Seiten zusammengekürzt worden und dem Autor ein vernüftiges Ende eingefallen wäre, hätte das ein wirklich gutes Buch sein können. Aber so müssen wir damit leben, dass uns ständig Nachhilfe erteilt wird, dass Quinten – und eben leider auch zugleich dem Leser – die Struktur des Katholizismus erklärt wird: »Die Päpste betrachten sich als Nachfolger Petri.« [S. 700] Achwas? – Wir bekommen Unterricht in amerikanischer Literaturgeschichte:
»Warum hast du ihn [den Raben] Edgar genannt?«
»Nach Edgar Allan Poe natürlich. Der hat ein berühmtes Gedichte über einen Raben geschrieben. The Raven.« [S. 696]
What you not say! – Und auch die Musikgeschichte kommt zu ihrem Recht:
Max war noch geblieben. Seine Kenntnisse über Beethovens Große Fuge in B-Dur, Opus 133, von einem bulgarischen Quartett aufgeführt, hatten auf eine kubanische Medizinstudentin großen Eindruck gemacht, eine große Frau mit langen, schlanken Fingern, die sie hoch auf seinen Oberschenkel legte, als er ihr erzählte, daß das Stück aus dem Schlußteil von Opus 130 entstanden sei. [S. 195 f.]
Mit solch intimen Kenntnissen der Streichquartett-Literatur ist natürlich das Verführen großer Frauen – gemeint sind »lange«, nicht »große« – eine Kleinigkeit. Tja, man müsste Klavierspielen können! Von der dreimaligen Wiederholung des Wortes »groß« in diesem einen Absatz wollen wir dabei einmal gnädig absehen, denn wir kennen das Original nicht.
Ich will nicht den Eindruck erwecken, das Buch sei durchweg so provinziell, aber es ist es eben über weite Strecken. Einigen Passagen liegt eine sorgfältige und umfassende Recherche des Autors zugrunde, aber eine viel zu große Menge des Textes erschöpft sich in hohlem Geschwätz besonders der beiden Hauptfiguren Max und Onno. Dem stehen auf der anderen Seite eine durchaus einfühlende und originelle Beschreibung etwa der späten 60er-Jahre oder die beinahe durchweg interessanten Nebenfiguren wie etwa Theo Kern oder Verloren van Themaat gegenüber. Wenn nur der Autor nicht so geschwätzig wäre … Aber das erwähnte ich wohl schon?
Harry Mulisch: Die Entdeckung des Himmels. Aus dem Niederländischen von Martina den Hertog-Vogt. Rowohlt Taschenbuch 13476. 871 Seiten. 9,90 €.

P. S.: Nur um keine Unklarheit aufkommen zu lassen: Spekulationen über die Moral des Romans, also die Bedeutung der Tatsache, dass der Himmel den mosaischen Dekalog wieder zurücknimmt, sind hier absichtlich unterblieben. Dem mögen sich Berufenere widmen!
Mancher mag es ja schön finden; aber ich konnte die widerliche Majestät der Alpenlinie nur mit Achselzucken betrachten : zu viel Stiftern ! Auch die feinen Funken, die ab und zu in den blaugrünen Wänden aufleuchteten, versöhnten mich nicht : gebt mir Flachland, mit weiten Horizonten (hier steckt man ja wie in einer Tüte !); Kiefernwälder, süß und eintönig, Wacholder und Erica; und an der Seite muß der weiche staubige Sommerweg hinlaufen, damit man weiß, daß man in Norddeutschland ist.
Arno Schmidt
Verschobene Kontinente
Was ich über dieses falsche Buch sagen könne, fragte mich mein Inspektor, oben, auf der Terrasse, Ecke Marschallstraße, er gebe sich einmal dazu her, mein Diktat aufzunehmen in seinen Text.
Ob ich etwas über das Falsche sagen sollte, wollte ich wissen und gab zu bedenken: Aus einer falschen Welt heraus als Autor eines falschen Buches sich auf eine Interpretation des Falschen einzulassen, würde bedeuten: hier zusammenfassen zu müssen, wie in diesem falschen Buch aus allen Gegensätzen und vor allem dem des Richtigen und des Falschen herauszugelangen sei, was allenfalls richtig herauskommen könnte, damit aber gar nichts bedeuten würde.
Bedeuten sollte es also etwas? wurde ich gefragt.
Es sollte nichts bedeuten.
Er lachte.
Er solle ruhig lachen, über mein Bemühen um das Unmögliche, meinte ich. Ich rede, sagte ich und deshalb: um aus der Rede herauszugelangen.Paul Wühr
Das falsche Buch
Seit März dieses Jahres schreibe ich in Kooperation mit der Solinger Stadtbibliothek eine wöchentliche Kolumne für die Solinger Morgenpost. Da zum einen die Länge dieser Kolumne begrenzt ist, zum anderen die Zielgruppe eine andere ist, zum dritten auch Überschneidungen mit diesem Blog vorkommen, habe ich diese Texte im Normalfall hier nicht eingestellt (eine Ausnahme ist etwa der Beitrag über Candida Höfers Bildband »Bibliotheken« gewesen, der in beiden Medien nahezu gleich besprochen wurde).
Nun habe ich mich aber entschlossen, ein kleines Archiv der Kolumne anzulegen, da sich die älteren Beiträge sonst doch rasch verlieren. Ich habe dafür auf der Subdomain kolumne.fraenzel.de ein eigenes Blog eröffnet. Auch in Zukunft werden inhaltliche Überschneidungen der beiden Blogs vorkommen; doppelte Einträge – wie im Fall Höfer – werden aber vermieden werden. Vielleicht mag ja die eine oder der andere auch dieses Blog abonnieren. Weitere Reklame in dieser Sache wird nicht gemacht.
Beschäftigte Leser sind selten gute Leser. Bald gefällt ihnen alles, bald nichts; bald verstehn sie uns halb, bald gar nicht, bald (was das schlimmste ist) unrecht. Wer mit Vergnügen, mit Nutzen lesen will, muß gerade sonst nichts anders zu tun noch zu denken haben.
Christoph Martin Wieland