»I tell you, ma’am,« said Mr. Witherden, »what I think as an honest man, which, as the poet observes, is the noblest work of God. I agree with the poet in every particular, ma’am. The mountainous Alps on the one hand, or a humming-bird on the other, is nothing, in point of workmanship, to an honest man – or woman – or woman.«
Charles Dickens
The Old Curiosity Shop
Martin Rowson’s Tristram Shandy
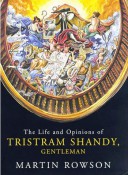 Angeregt durch die »Verfilmung« von Sternes »The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman« habe ich wieder mal Martin Rowsons Tristram-Shandy-Comic aus dem Jahr 1996 aus dem Bücherschrank gezogen. Rowsons schwarz-weißer Comic ist eine höchst originelle und eigenständige Aneignung des Romans, die weit über den Status einer reinen Illustration oder bildlichen Umsetzung hinausgeht. Dabei fängt das Buch noch einigermaßen konventionell an, indem Rowson Tristram Shandy als Erzähler seines Lebens auftreten lässt, der – eine Leserin und einen Leser im Schlepptau – durch den Anfang des Romans führt, den er wortwörtlich im Munde führt. Dementsprechend ist die erste Episode dem Weg des Homunkulus zu seiner neunmonatigen Ruhestätte gewidmet.
Angeregt durch die »Verfilmung« von Sternes »The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman« habe ich wieder mal Martin Rowsons Tristram-Shandy-Comic aus dem Jahr 1996 aus dem Bücherschrank gezogen. Rowsons schwarz-weißer Comic ist eine höchst originelle und eigenständige Aneignung des Romans, die weit über den Status einer reinen Illustration oder bildlichen Umsetzung hinausgeht. Dabei fängt das Buch noch einigermaßen konventionell an, indem Rowson Tristram Shandy als Erzähler seines Lebens auftreten lässt, der – eine Leserin und einen Leser im Schlepptau – durch den Anfang des Romans führt, den er wortwörtlich im Munde führt. Dementsprechend ist die erste Episode dem Weg des Homunkulus zu seiner neunmonatigen Ruhestätte gewidmet.
Aber sehr bald tritt auch Rowson selbst in seinem Werk auf, immer begleitet von seinem treuen Hund Pete, der das ganze Unternehmen aber zum großen Teil schlicht für lästigen Humbug hält. Dem Zeichner verschärft sich bald das bekannte Problem Shandys, der ja sein Leben und seine Ansichten derart ausschweifend erzählt, dass er mit dem Erzählen dem Leben immer mehr hinterherhinkt, da Rowsons Fassung zum Teil so detailliert ist, dass er nach 126 (von insgesamt 182) Seiten erst am Ende von Buch III angelangt ist und schließlich nur 20 Seiten für die Bücher V bis IX übrig hat, so dass – zu seiner eigenen Überraschung – die Bücher VI und VIII komplett ausfallen müssen, damit es sein Buch gerade noch so schafft, das Ende von Buch IX des »Tristram Shandy« unterzubringen.
Rowsons bildliche Einfälle können nur als kongenial bezeichnet werden: Nicht nur zitiert er ständig zeitgenössische Illustratoren und Illustrationen, die Geschichte des Hafen Slawkenbergius aus Buch IV etwa wird in eine Reihe von Großbildern umgesetzt, die vom frühen Holzschnitt über einen Dürer-Stich, eine Hogarth-Doppelseite bis hin zu Aubrey Beardsley und George Grosz reicht. Und bei den bildlichen Einfällen bleibt es nicht: So gerät z. B. eine Fahrt in dem Segelwagen des Stevinus (Buch II) unter anderem auch in ein Kino, in dem eine kurze Szene aus »Oliver Stone’s ›Tritram Shandy‹« mit der Tagline »From a Place Called Namur to Hell and Back« zu sehen ist, mit Robert De Niro als Walter Shandy, Tom Cruise als Onkel Toby und Meryl Streep in der Rolle des Korporals Trim. Leider können wir nur raten, in welcher Rolle Danny DeVito zu sehen ist.
Rowsons »Tristram Shandy« ist sicherlich nur etwas für echte Liebhaber und Kenner des Buches; die aber werden es nicht mehr missen wollen, nachdem sie es einmal in die Hand genommen haben. Darf in keinem Bücherschrank eines echten Shandyisten fehlen!
Martin Rowson: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Woodstock: The Overlook Press, 1997. Leinenrücken, fadengeheftet, 182 unpaginierte Seiten. Preis ca. 20,– $.
Es existiert auch eine broschierte Ausgabe! Die bei amazon.de angebotenen Exemplare sind leider gänzlich überteuert (> 50,– €).
Allen Lesern ins Stammbuch (2)
Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel heraus sehen. Wir haben keine Worte mit dem Dummen von Weisheit zu sprechen. Der ist schon weise der den Weisen versteht.
Georg Christoph Lichtenberg
Sudelbücher (E 215)
Zum Tod von Hans Wollschläger
Und in dem slozze was ein tavel bereitet die was us dem birckenholz Finlants und was getragen von vier zwercmaennern ienes lants doch sie warn verzawbert also daz sie niht kunten sich rueren noch regen. Und es lagen uf diser tavel gar furhtbære swerter und messer die da gemacht werden in ein groz hœl von bœzer geister hant und werden gemacht us wize flamen und bevestiget in dem gehürne von bueffelen unde hirschen so aldort leben in wunderbær vuelle. Und waren schuezzelen da und geschirre und waren gemacht durch den zawber Mahounds us mers sant und us luft von eim hecsemeister mit sin odem welchen er in sie eineschnobt daz sie werden als wie groze blazen. Und es lag spise uf dere tavel so lecker lieplich unde rich als niht iemant sihs kœnt herrelicher noch lieplicher erdenken. Und es war da ein vaz von silber swelchs kont geoffent werden uf listriche art und lagen dar inne seltsæne visch sonder hawbt und dis zeugschaft ist war obe schon ungleubic leut wol mœhten bestriten daz es ein mœgelich dinc biz daz sie es saehen. Und dise visch liegen in eim œlichten wazzer so us dem lant Portugal gebraht und ist so vil vet dar inne daz es gelichet dem saft von geslahen œlvruht. Und insgeliche wunderhaftic ze schawen in deme sloz was wie sie durh zawberschaft da ein gemischede berihten uz manecvalt vruhtbaere weizzen von Chaldaea swelchs mit dem bistant von gewizze bœze geister so sie dar eine bannen uf swellet gar wunderbærliche als wie ze eim mehtic berc. Und sie machen die slangen da gelernic daz sie sih ufhin winden an lange stocholz uz dem ert grunt und uz dise slangen schuopen brawen sie ein gebrawe als wie met.
James Joyce
Ulysses
deutsch von Hans Wollschläger
Ilija Trojanow: Der Weltensammler
 Sir Richard Francis Burton (1821–1890) war einer der bedeutenden Forschungsreisenden, Abenteurer und Orientalisten des 19. Jahrhunderts. Ilija Trojanow hat drei Episoden aus dem Leben Burtons herausgegriffen und einen Roman aus ihnen gemacht: Burtons ersten Aufenthalt in Indien ab 1842, seine damals zwar nicht einmalige, aber nichtsdestotrotz wagemutige und sensationelle Pilgerreise nach Mekka 1853 sowie die Expedition 1857/58 zum Tanganjika- und Victoriasee (den Burton allerdings nicht erreichte, sondern den sein Partner John Hanning Speke allein »entdeckte«). In zwei Rahmen-Kapiteln beschäftigt er sich mit dem Tod Burtons.
Sir Richard Francis Burton (1821–1890) war einer der bedeutenden Forschungsreisenden, Abenteurer und Orientalisten des 19. Jahrhunderts. Ilija Trojanow hat drei Episoden aus dem Leben Burtons herausgegriffen und einen Roman aus ihnen gemacht: Burtons ersten Aufenthalt in Indien ab 1842, seine damals zwar nicht einmalige, aber nichtsdestotrotz wagemutige und sensationelle Pilgerreise nach Mekka 1853 sowie die Expedition 1857/58 zum Tanganjika- und Victoriasee (den Burton allerdings nicht erreichte, sondern den sein Partner John Hanning Speke allein »entdeckte«). In zwei Rahmen-Kapiteln beschäftigt er sich mit dem Tod Burtons.
Trojanow geht es dabei nicht darum, eine Biographie Burtons zu verfassen, sondern er benutzt die äußeren Lebensdaten Burtons, um einen Roman über die Themen der kulturellen Differenz und der interkulturellen und -religiösen Toleranz zu verfassen. Alle drei Episoden werden aus doppelter Perspektive erzählt: Zum einen personal angebunden an das Erleben des Portagonisten Burton, zum anderen gespiegelt im Blick eines oder mehrere Einheimischer. Im Fall der Mekka-Reise ist dies eingekleidet in die Fiktion einer offiziellen Untersuchung der Frage, ob Burton diese Reise als englischer Spion unternommen habe, in den beiden anderen erzählen vertraute Untergebene Burtons ihre Sicht der Ereignisse.
Diese doppelte Perspektive ist die eigentliche Pointe des Buches: Burtons zwanghaften Versuchen, sich in andere Kulturen einzuleben, sie bis zum Identitätsverlust nachzuahmen, weil er sich in seiner eigenen Kultur nicht zurecht findet, wird der Blick jener entgegengestellt, die ihren Alltag in der »anderen Welt« leben.
Du kannst dich verkleiden, soviel du willst, du wirst nie erfahren, wie es ist, einer von uns zu sein. Du kannst jederzeit deine Verkleidung ablegen, dir steht immer dieser letzte Ausweg offen. Wir aber sind in unserer Haut gefangen. Fasten ist nicht dasselbe wie Hungern.
Im Endeffekt verstärkt Burton seine Isolation »von aller Welt«, je mehr Welten er sich zu eigen macht:
Wer in England wird ihm ins Dämmerreich folgen können, wer wird verstehen, daß die Antworten verschleierter sind als die Fragen?
Nachdem man das einmal verstanden hat, wird der Roman etwas zäh. Ich habe den dritten Teil eher unwillig gelesen, denn er bringt nichts mehr in einem wesentlichen Sinne Neues. Die Figur Spekes mag für den einen oder anderen Leser als Gegenfolie zu Burton und Lehrstück europäischer Arroganz interessant sein – ich allerdings kenne meinen Hemingway und brauche keine weiteren Romane mehr, um mir Europäer in Afrika vorstellen zu können.
Etwas schade ist es, dass Burton als Intellektueller und Schriftsteller nur am Rande zur Sprache kommt. Immerhin zeichnete er im 19. Jahrhundert durch seine Reisebücher und etwa auch mit seiner Übersetzung der »Märchen aus den 1001 Nächten« verantwortlich für einen wesentlichen Teil der Vermittlung der indischen und arabischen Kultur in die westliche Welt. Aber es mag sein, dass sich darüber nicht so gut in einem Roman schreiben lässt.
Der Roman hat 2006 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik gewonnen und war im selben Jahr in der Short-List für den Deutschen Buchpreis.
Ilija Trojanow: Der Weltensammler. Hanser, 2006. Pappband, 477 Seiten. 24,90 €.
A Cock and Bull Story
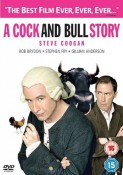 In der Liste der berühmten, unverfilmbaren Bücher nimmt »The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman« einen der Spitzenplätze ein. Seine Unverfilmbarkeit ist wesentlich seiner literarischen Qualität geschuldet, also nicht dem Stoff, sondern seiner Verarbeitung, Sternes Kunst der Abschweifung, des diskontinuierlichen Erzählens, der Zitate, Einsprengsel und Fußnoten und nicht zuletzt der Tatsache, dass das Buch immer auch seine eigene Niederschrift reflektiert, während es seine Geschichte nicht wirklich voranbringt. Als eine Art Surrogat könnte man Martin Rowsons Comic-Version ansehen, aber das hieße natürlich dies kongeniale Werk in seiner ihm eigenen Einzigartigkeit zu unterschätzen.
In der Liste der berühmten, unverfilmbaren Bücher nimmt »The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman« einen der Spitzenplätze ein. Seine Unverfilmbarkeit ist wesentlich seiner literarischen Qualität geschuldet, also nicht dem Stoff, sondern seiner Verarbeitung, Sternes Kunst der Abschweifung, des diskontinuierlichen Erzählens, der Zitate, Einsprengsel und Fußnoten und nicht zuletzt der Tatsache, dass das Buch immer auch seine eigene Niederschrift reflektiert, während es seine Geschichte nicht wirklich voranbringt. Als eine Art Surrogat könnte man Martin Rowsons Comic-Version ansehen, aber das hieße natürlich dies kongeniale Werk in seiner ihm eigenen Einzigartigkeit zu unterschätzen.
Von daher war es eine große Überraschung, als im August 2005 eine Website eine Verfilmung durch Michael Winterbottom ankündigte. Winterbottom hatte im selben Jahr mit dem Film »9 Songs« auch in Deutschland einen wohlkalkulierten Skandal ausgelöst, da dem Film nachgesagt wurde, er sei anstößig – ein Attribut, das Filme im Zeitalter der Pornovision kaum mehr erlangen können. Von daher war Winterbottom vorerst alles zuzutrauen, auch einen Film aus einer unverfilmbaren Vorlage herzustellen.
Der Film ist überraschend genug geraten; ob er letztendlich gelungen ist, wage ich nicht zu beurteilen. Die ersten 25 Minuten sieht er aus wie eine postmodern verspielte Aneignung des Buches: Wie in der Vorlage tritt Tristram Shandy (Steve Coogan) als Erzähler seines eigenen Lebens auf, der sich direkt an die Zuschauer wendet. Es wird die erratische Erzählweise des Buches nachgestellt, wobei das Rückgrat die Zeit vom Einsetzen der Wehen bei Tristrams Mutter (Keeley Hawes) bis zu seiner eigentlich Geburt bildet. Aneinandergereiht werden alle möglichen Episoden aus allen Teilen des Buches: Das Heruntersausen des Schiebefensters genauso wie der Abschluss der Ehevertrages der Eltern Tristrams, Onkel Tobys (Rob Brydon) Verletzung genauso wie die unglückliche Taufe des gerade geborenen Helden auf einen falschen Namen usw. usf. Wahrscheinlich ist dieser Teil des Films für einen Zuschauer, der das Buch wenig oder gar nicht kennt, eher sehr verwirrend; für Kenner der Vorlage ist es ein Genuss zuzuschauen. Die paar witzigen Anspielungen auf das 19. oder das 20. Jahrhundert, die Tristram hier und da einbringt, stören den Gang der Darstellung in keiner Weise.
Nach etwa 25 Minuten verändert der Film dann radikal seinen Charakter: Die Kamera schwenkt auf den fiktiven Regisseur (Jeremy Northam), der die Aufnahmen des Tages beendet. Von da an ist es ein Film über eine Filmcrew, die an einer Verfilmung des »Tristram Shandy« arbeitet, der bewusst in der Tradition von Fellinis »8½« (Nino Rotas Musik wird verwendet) oder Truffauts »La nuit américain« steht. Die Mitglieder des Teams besprechen die Schwierigkeiten der Produktion, die beiden Hauptdarsteller Steve Coogan und Ron Brydon tragen ständig freundschaftliche Reibereien untereinander aus, Steve Coogans Lebensgefährtin (Kelly Macdonald) kommt mit dem gemeinsamen Baby zu Besuch auf den Set und was der Erzählstränge mehr sind. Zwischendurch kehrt der Film immer wieder für kurze Momente in das 18. Jahrhundert Sternes zurück, um zum Beispiel einen Gedanken oder einen Traum zu illustrieren.
Natürlich bietet sich ein solcher Sprung von einer Literaturverfilmung zu einem Film über eine Literaturverfilmung gerade beim »Tristram Shandy« an, denn kaum ein anderes Buch reflektiert zugleich mit dem Erzählen immer erneut das Erzählen selbst und liefert zugleich Roman und Autorenpoetik. Auf der anderen Seite ist ein Film über das Verfilmen von »Tristram Shandy«, so gut er auch immer sei, keine Verfilmung des »Tristram Shandy«, was wahrscheinlich nichts anderes als das Zugeständnis ist, dass sich das Buch eben grundsätzlich nicht verfilmen lässt. Für einen Kenner des Buches ist das alles recht und gut, aber ich kann mir kaum vorstellen, wie der Film auf jemanden wirkt, der das Buch nicht oder nur oberflächlich kennt. Wahrscheinlich steigt ein solcher Zuschauer schon in den ersten 25 Minuten aus und kommt gar nicht erst bis zu der Stelle, wo der Film ein »Film über Film« wird. Mit hat er gut gefallen, er ist originell, intelligent und gut erzählt, aber – wie schon gesagt – trotzdem scheint es mir zweifelhaft, ob der Film alles in allem gelungen ist. Eine Verfilmung des »Tristram Shandy« ist er jedenfalls nicht.
Den Status von Laurence Sternes »Tristram Shandy« in Deutschland – trotz der Neuübersetzung durch Michael Walter – kann man gut daran ablesen, dass der Film bis dato in Deutschland weder im Kino angelaufen ist, noch eine deutsch synchronisierte DVD vorliegt.
A Cock and Bull Story. UK, 2005. Lionsgate. Import-DVD (Region 2). Länge ca. 91 Minuten. Sprache: Englisch. Extras: Interview mit Steve Coogan; Deleted Scenes; Extended Scenes; Behind the Scene Footage; Kommentar von Steve Coogan und Bob Brydon; Premieren Footage; Trailer. Ca. 20,– €.
Der achte Teil der Septologie?
Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir das Phänomen zum ersten Mal begegnet ist: Da hatte auf der Rückseite des dritten Teils von Frank Herberts »Dune« ’was gestanden vom Abschluss der Trilogie, und wenig später fiel mir in einer Buchhandlung der vierte Teil in die Hand, auf dessen Rücken zu lesen war: »Der lang erwartete vierte Teil« – der Triologie Tetralogie Quadrilogie?
Heute meldet nun die SZ in der Rubrik »Panorama« (wohlgemerkt, nicht unter »Literatur«), dass auch Joanne K. Rowling plant, ihr Septett ihre Sepsis Septologie um einen weiteren Band zu ergänzen, weil sie noch soviel Material von den anderen sieben übrig hat. Das heiß ich mir, aus einer Nadel einen Wagen voll spalten!
Bibliotheken, Bibliotheken, Bibliotheken
 Candida Höfers Bildband »Bibliotheken« geizt mit Worten: Zwar bildet ein Essay von Umberto Eco das Vorwort, indem Eco über die die absolute, die schlechte und die gute Bibliothek philosophiert. Er stammt aus dem Jahr 1981 – an einer Stelle befürchtet Eco die Verdrängung des Buches durch »Lesegeräte und Mikrofiches«, was dem ganzen Text einen Hauch von Nostalgie gibt.
Candida Höfers Bildband »Bibliotheken« geizt mit Worten: Zwar bildet ein Essay von Umberto Eco das Vorwort, indem Eco über die die absolute, die schlechte und die gute Bibliothek philosophiert. Er stammt aus dem Jahr 1981 – an einer Stelle befürchtet Eco die Verdrängung des Buches durch »Lesegeräte und Mikrofiches«, was dem ganzen Text einen Hauch von Nostalgie gibt.
Bis auf den kurzen Anhang, der immerhin ein Ortsregister liefert, enthält der Band aber sonst ausschließlich Photographien von Bibliotheken in Europa und Amerika. Gezeigt werden alle Bereiche: Lesesäle, Magazine, Kataloge (Karten und Computer), Verwaltungsbüros, leere Regale und hoch aufgetürmte Bücherwände, üppige barocke Bibliotheksarchitekturen, modern karge Zweckräume oder fast bedrückend wirkende Kellerverliese, Klassiker (etwa die Bibliothek des Trinity College in Dublin) und schlafende Schönheiten (etwa eine leergeräumte Kirche in San Augustin, Mexiko, von der wir nicht erfahren, ob sie einst als Bibliothek gedient hat oder ob sie erst noch eine werden soll).
Ganz selten sind Leser, also Nutzer der Bibliotheken auf den Bildern zu finden, was in erster Linie technische Gründe haben wird, da Höfer wegen der Schärfentiefe überwiegend bei kleiner Blende mit langen Belichtungszeiten arbeitet – da verwischt auch das Abbild eines ruhigen Bibliotheksbenutzers. Diese Menschenleere erzeugt einen besonderen Effekt, zumindest für den bibliomanen Betrachter: Die Bilder öffnen sich ihm als Spielwiese der Phantasie – allein zu sein mit dieser überwältigenden Fülle von Bänden, sich wengstens für den Moment einbilden zu dürfen, dies sei die eigene Bibliothek, ganz angepasst an die eigenen Interessen und Neigungen, gefüllt mit den ausgesuchtesten Ausgaben.
Ein Band, um in den Lesepausen darin herumzuspazieren.
Candida Höfer: Bibliotheken. München: Schirmer/Mosel, 2005. Leinen, fadengeheftet, Kunstdruckpapier (24,5×30 cm), 272 Seiten mit 137 Farbtafeln. 78,– €.
Von der Höhe der Alpen (6)
Wer hätte nicht schon von Gebirgen geträumt, so hoch, daß es erst die rechten Gebirge wären, hinter denen die Alpen zu Zwergen schrumpfen; wer nicht von Portalen, so mächtig, daß eine Menschheit von Riesen sie durchschreiten könnte.
Theodor W. Adorno
Im Flug erhascht
Torquato Quatscho
 Ich gehe nicht mehr oft ins Theater. So mehr als zwei oder drei Mal im Jahr sind es nicht. Zumeist gehe ich in Stücke, die ich gut kenne, von Autoren, die ich gut kenne. Deshalb gehe ich wahrscheinlich so selten ins Theater.
Ich gehe nicht mehr oft ins Theater. So mehr als zwei oder drei Mal im Jahr sind es nicht. Zumeist gehe ich in Stücke, die ich gut kenne, von Autoren, die ich gut kenne. Deshalb gehe ich wahrscheinlich so selten ins Theater.
Heute war ich in »Torquato Tasso« in Recklinghausen; ich mag nicht sagen, in Goethes »Torquato Tasso«, denn dass die Schaupieler Text von Goethe sprachen, erschien mehr als Zufall. Eine ¾ Stunde bin ich geblieben, dann war es genug – ich wusste ja, wie das Stück ausgeht.
Goethe hat zwischen 1780 und 1789 langsam und gründlich einen ruhigen und diffizilen Text geschrieben, ihn sorgfältig immer wieder erwogen, sich am Ende große Mühe gemacht mit drei noch zu schreibenden Szenen, die nicht und nicht geraten wollten. Das Stück hat ihm am Herzen gelegen. Er selbst hat nicht geglaubt, dass es für die Bühne sei – und er verstand etwas von der Bühne, wenigstens der seiner Zeit, denn er war lange Zeit Intendant. Als ihn die Weimarer Schauspieler schließlich damit überrumpelten, dass sie die Rollen einfach schon gelernt hatten, hat er doch noch eingewilligt, aber eine Streichfassung erstellt, die dann schließlich gespielt werden durfte. Dass es gut sei, das Stück zu spielen, hat er dennoch nicht geglaubt. Und dabei kannte er nicht ’mal das moderne Regietheater.
Da sind zum Beispiel Torquato und Antonio: Bei Goethe sind sie zwei Planeten, die um die Sonne Herzog Alfons II. d’Este kreisen. Sie bewegen sich auf derselben Umlaufbahn in derselben Geschwindigkeit – nur eben auf entgegengesetzten Seiten, und so ist es am Ende auch gar kein Wunder, dass es gerade Antonio ist, der von Torquato nicht lassen will. Torquato, immer angespannt, jeder eigenen und fremden Emotion nachlauschend, spontan und zum Überschwang neigend, ist ein Klischee der Goethezeit: ein Genie. Antonio ist ganz der klassische Hofmann – ein weiteres Klischee, das für die meisten Leser der Goethezeit ausreichte, um ihn zur negativen Gegenfigur zu machen –, immer kontrolliert und misstrauisch, immer rational abwägend und vorsichtig bis zum Zynismus, den Menschen dort eher abgeneigt, wo Torquato sich ihnen zuneigt.
Auch in der Inszenierung von Frank Hoffmann ist der Figur Antonios ein Klischee eingeschrieben. Natürlich nicht mehr das Klischee des Hofmanns – denn wer unter den heutigen Zuschauern hätte noch das Buch von Baldassare Castiglione gelesen –, sondern das der Niete im Nadelstreifen. Auch damit gerät er in einen perfekten Gegensatz zu dem wilden Affen, der aus Torquato gemacht worden ist. Und so stehen die beiden einander testosteronschwanger gegenüber und schreien einander und dann zur Abwechslung auch einmal den Herzog an, dumme Männer, nichts weiter. Hier und da setzt sich in all der Aufgeregtheit doch einmal ein einzelner Satz Goethes durch und man erstaunt für einen Moment über den Glanz, der erscheint – aber gleich muss wieder um den Teich gerannt, ein Brett umgeworfen, geschrieen und gequiekt werden.
Natürlich macht Frank Hoffmann nichts anderes als das, was Goethe auch getan hat: Er eignet sich eine Kunstfigur an und transponiert sie in die eigene Zeit – witzigerweise stimmen sogar die übersprungenen Zeitspannen ungefähr überein. Nur eines versäumt Hoffmann: Sich zehn Jahre Zeit zu nehmen, um einen eigenen »Tasso« zu schreiben. Stattdessen nimmt er den Text Goethes und legt die eigene Zeit und Kultur darüber. Dass er dabei ein filigranes sprachliches Gebilde von einem Panzer überrollen lässt, scheint er billigend in Kauf zu nehmen – schließlich muss auch er leben, und er hat keinen Herzog Karl August, der ihm wie nebenbei das eine oder andere Haus schenkt oder ihn zwei Jahre auf Urlaub nach Italien fahren lässt.
Das Schlimmste an all dem ist – so fürchte ich –, dass die Inszenierung Recht und ich mit meinem Kopfschütteln Unrecht behalte. Das Stück war schon damals nichts fürs Theater; heute ist es da schon ganz egal, was am Ende auf die Bühne kommt. Hauptsache, es ist was los im Haus. Auf die paar intellektuellen Spinner, die die Unterschiede bemerken, kommt es nun wirklich nicht an. Scheiß auf Goethe: Das Volk will sich amüsieren, die Schauspieler was zum Fressen haben! Und das auf hohem Niveau! Also Theaterzettel raus und los: Goethe »Torquato Tasso«; Regie: Frank Hoffmann …