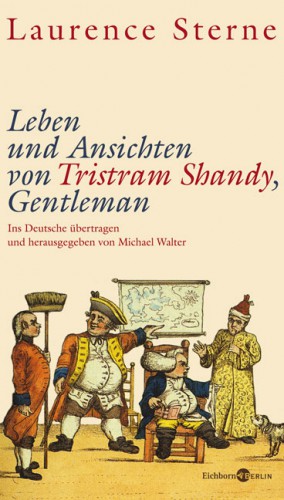Anlässlich der stark beworbenen Neuausgabe der Übersetzung von Michael Walter beim Eichborn Verlag möchte ich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, auf eines der witzigsten Bücher der Weltliteratur hinzuweisen: Laurence Sternes »Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman«. Es gibt nicht viele Bücher, die man in seinem Leben immer und immer wieder lesen kann, ohne dass sie ihren Reiz und Witz irgendwann einmal verlieren; der »Tristram Shandy« gehört sicherlich dazu.
Denn ungewöhnlich ist das Buch in beinahe jeder Hisicht. Aber langsam! Fangen wir mit dem an, was sich ohne zu große Verwirrung zu stiften, sagen lässt: »Tristram Shandy« ist zwischen 1759 und 1767 in neun Bänden in London erschienen. Sein Autor, Laurence Sterne (1713–1768), entstammte einer englischen Offiziersfamilie, war in Irland geboren worden, und zu dem Zeitpunkt, als er seinen Roman schrieb, seit 20 Jahren Geistlicher. Die ersten beiden Bände des »Tristram Shandy« machten den Autor über Nacht berühmt und zu einem gefeierten und gesuchten Gast der Londoner Salons. Auch in Paris, das er Ende 1762 auf dem Weg nach Südfrankreich besuchte, wurde er triumphal empfangen und gefeiert. Er war einer der Literaturstars seiner Zeit. Neben dem »Tristram Shandy« existiert noch eine Sammlung von Predigten und im Todesjahr 1768 erschien »A Sentimental Journey through France and Italy« in zwei Bänden. Damit ist Sternes Werk auch schon so gut wie ausgeschöpft.
Der Ich-Erzähler und Held des »Tristram Shandy« ist wahrscheinlich einer der ungewöhnlichsten, sicherlich aber der unordentlichste Erzähler der Weltliteratur. Von jedem Gedanken, jedem Einfall lässt er sich ablenken, immer fällt ihm noch etwas ein, das er noch kurz erzählen muss, bevor er mit seiner Geschichte weiterkommen kann, wobei er in der Abschweifung gleich die nächste Abschweifung beginnt und so weiter und so fort. Den Anfang seiner Lebensgeschichte macht er mit einem Bericht, beinahe schon einer Klage über seine eigene Zeugung:
Wenn doch mein Vater oder meine Mutter oder eigentlich beide – denn beide waren gleichmäßig dazu verpflichtet – hübsch bedacht hätten, was sie vornahmen, als sie mich zeugten! Hätten sie geziemend erwogen, wieviel von dem abhinge, was sie damals taten – daß es also nicht nur die Erzeugung eines vernünftigen Wesens galt, sondern daß möglicherweise die glückliche Bildung und ausgiebige Wärme des Körpers, daß vielleicht des Menschen Geist und seine ganze Gemütsbeschaffenheit, ja sogar – denn was wußten sie vom Gegenteile? – das Wohl und Geschick seines ganzen Hauses durch ihren damals vorherrschenden Seelen- und Körperzustand bestimmt werden konnte; – wenn sie, wie gesagt, das alles getreulich erwogen und überdacht hätten und dementsprechendvorgegangenwären, sowürde ich nach meiner Uberzeugung eine ganz andere Figur in der Welt gemacht haben als die, in welcher mich fortan der Leser dieses Buches erblicken wird.
(Übers. v. Rudolf Kassner)
Und nachdem er im Folgenden die Umstände seiner Zeugung mit einiger Sorgfalt »ab ovo« – um wie Tristram Shandy selbst mit Horaz zu sprechen – dargelegt hat, braucht der Erzähler immerhin bis ins dritte Buch hinein, um überhaupt bis zu seiner Geburt und zugleich Nottaufe vorzudringen. Im Weiteren erfahren wir, warum nach Auffassung der Kirche Kinder nicht mit ihren Müttern verwandt sind, was für eine geheimnisvolle Bewandnis es mit Nasen und Namen hat, wie und – im doppelten Sinne – wo Tristrams Onkel Toby in Flandern bei der Belagerung von Namur verletzt wurde und was diese Verletzung für Folgen zeitigte, wir kommen an der berühmten schwarzen und der noch berühmteren bunten Seite des Buches vorüber – jene ein Symbol der Trauer, diese ein Symbol der Buntscheckigkeit des Buches und des Lebens –, vermissen ein ganz und gar aus dem Buch herausgerissenes Kapitel, werden vom Erzähler zum Kapitelanfang zurückgeschickt, weil wir beim Lesen nicht gut genug aufgepasst haben, und was der Leseabenteuer mehr sind. »Tristram Shandy« ist eine solch übersprudelnde Quelle von Einfällen, Pointen, nichtsnutzigen Verweisen, falschen und richtigen Zitaten, philosophischen Weis- und Dummheiten, dass es eine reine Freude ist. In diesem Buch kann man versinken, die Welt vergesssen und sie wiederfinden. In jeglicher Hinsicht ein Zauberbuch.
Das Buch war im 18. Jahrhundert ein solch grandioser Erfolg, dass es nicht nur rasch in alle wichtigen europäischen Sprachen übersetzt wurde, sondern dass es eine ganze Reihe von Nachahmern gefunden hat: Die Sterneiana sind auch in Deutschland eine wichtige Literaturtradition, die sich bis ins zwanzigste Jahrhundert fortgesetzt hat; aber davon müssen wir ein andermal erzählen.
Die nun bei Eichborn wieder aufgelegte Übersetzung Michael Walters ist die späteste und modernste Übersetzung des Textes. Die erste deutsche Übersetzung stammt von dem bedeutenden Verleger und Übersetzer Johann Christoph Bode und erschien 1774. Später ist das Werk noch des öfteren übersetzt worden; die Eindeutschungen von Seubert (1880) und Kassner (1937) dürften auch heute noch bedeutsame Alternativen darstellen. Dass sich schließlich Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts einer der besten deutschen Übersetzer – Michael Walter – daran gemacht hat, den »Tristram Shandy« neu ins Deutsche zu übertragen, hatte seine erste Ursache in einem Aufsatz Arno Schmidts. Der hatte in »Alas, poor Yorick!« (1963) nicht nur eine der damals noch im Druck befindlichen Überarbeitungen der Bodeschen Übersetzung auf gut irokesisch massakriert, sondern verstärkt auch auf den seiner Meinung nach weitgehend ignorierten sexuellen Grundbass des Buches hingewiesen.
Michael Walter machte es sich nun zur Aufgabe, eine Übersetzung zu liefern, die gerade diesen Basso continuo sexueller Anspielungen und Wortspiele deutschen Lesern sichtbar machen sollte. Dabei ist ihm dieser Klang zum Teil recht deutlich geraten, hier und da sicher auch deutlicher als im Original. Aber wenigstens eines kann der deutsche Leser der Walterschen Übersetzung nur mit Mühe: Ignorieren, dass es sich bei »Tristram Shandy« auch um ein Buch des sexuellen Witzes handelt.
Ohne jede Frage ist die Waltersche Eindeutschung grandios und virtuos geraten. Aber vielleicht ist es doch besser, das Buch zuerst einmal – mehrmals lesen wird man es ohnehin, wenn man es denn einmal mit Genuss gelesen hat – in der Übersetzung von Rudolf Kassner zu lesen (Diogenes Taschenbuch 20950). Auch Kassner hat die sexuelle Ebene des Textes durchaus wahrgenommen und mitübersetzt, ist aber deutlich dezenter als Walter. Und so mag es der einen oder dem anderen eher gelingen, auch auf die anderen Töne zu hören, die bei Walter manchmal drohen im allzureichen Glockenklang unterzugehen. Aber ganz gleich, welchen Zugang man auch wählt, für »Tristram Shandy« gilt der alte Satz Lichtenbergs: »Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.«
Laurence Sterne: Das Leben und die Ansichten Tristram Shandys. Aus dem Englischen von Rudolf Kassner. Zürich: Diogenes, 1982. (detebe-Klassiker 20950). Broschiert, 810 Seiten. 14,90 €.
Laurence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Ins Deutsche übertr. u. hrsg. v. Michael Walter. Neuausgabe Frankfurt: Eichborn, 2006. 852 Seiten. 39,90 €.
 Seit mehr als 50 Jahren liefert Reclam, Stuttgart, jedes Jahr seinen kleinen Literaturkalender, der auf etwas mehr als 100 Seiten die literarischen Geburts- und Gedenktage des kommenden Jahres versammelt und zu einer Auswahl der wichtigsten Jubiläen kurze Autorenporträts und Textausschnitte liefert: Eine Einstimmung auf das kommende Lesejahr und eine angenehme Anregung zu der einen oder anderen (Wieder-)Lektüre. Und ein literarisches Jubiläums-Rätsel gibt es obendrein.
Seit mehr als 50 Jahren liefert Reclam, Stuttgart, jedes Jahr seinen kleinen Literaturkalender, der auf etwas mehr als 100 Seiten die literarischen Geburts- und Gedenktage des kommenden Jahres versammelt und zu einer Auswahl der wichtigsten Jubiläen kurze Autorenporträts und Textausschnitte liefert: Eine Einstimmung auf das kommende Lesejahr und eine angenehme Anregung zu der einen oder anderen (Wieder-)Lektüre. Und ein literarisches Jubiläums-Rätsel gibt es obendrein.