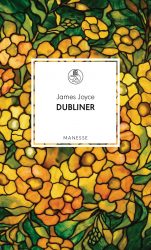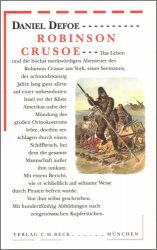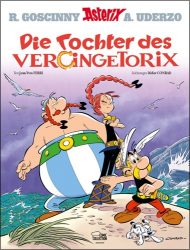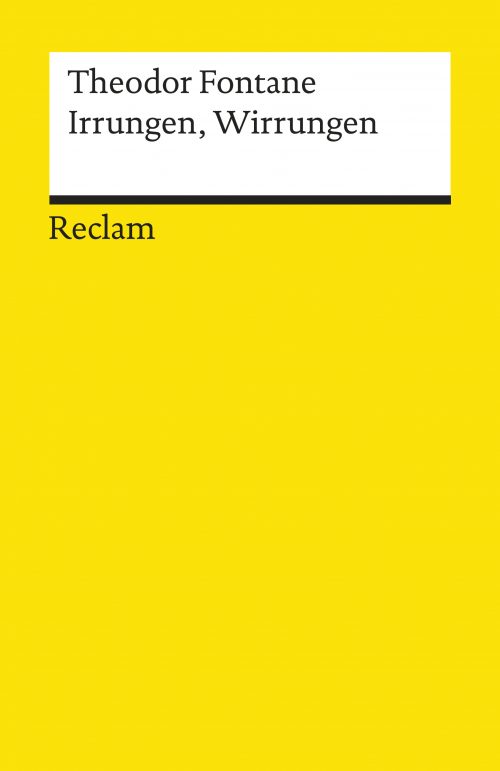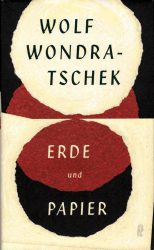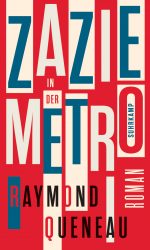Gut, so was steht in Romanen! Das, lieber Fürst, sind alte Märchen, heute ist die Welt viel klüger geworden, und nun ist das alles Unsinn!
Der zweite der letzten fünf großen Romanen Dostojewskijs erschien 1869 nach einem Zeitungsvorabdruck als Buch. Dostojewskij lebte während der gesamten Niederschrift mit seiner Frau Anna im Ausland, hauptsächlich in der Schweiz und in Italien. Der Idiot war eines der Projekte, mit denen Dostojewskij einen Teil seiner Schulden in Russland abzahlen und seine Rückkehr ermöglichen konnte.
Erzählt wird die Geschichte des Fürsten Myschkin, ein etwa 25 Jahre junger Mann, der nach über vier Jahren Behandlung in einem Schweizer Sanatorium nach Russland zurückkehrt. Er ist Epilektiker und war vor seiner Behandlung aufgrund der Krankheit kaum lebens- oder kommunikationsfähig. Im Zug nach Petersburg lernt er Pafjon Rogoschin kennen, dessen Vater gerade gestorben ist und der aus der Provinz nach Sankt Petersburg fährt, um sein Erbe anzutreten und um eine Frau zu werben, in die er verliebt ist. In Sankt Petersburg angekommen, begibt sich Myschkin zur Wohnung des Generals Jepantschin, mit dessen Frau Lisaweta er weitläufig verwand ist. Hier wird er von der Familie überraschend freundlich aufgenommen und lernt auch die drei unverheirateten Töchter des Ehepaars kennen, von denen die jüngste, Aglaja, eine wichtige Rolle im weiteren Roman spielen wird.
Noch am selben Abend lernt er auch die Frau kennen, um die Rogoschin wirbt: Nastassja Filippowna Baraschkowa stammt aus einfachen Verhältnissen, wurde aber aufgrund ihrer überragenden Schönheit von ihrem Gutsbesitzer ausgewählt und zur Kurtisane erzogen und ausgehalten. Aus diesem Zwangsverhältnis hat sich Nastassja befreit und verdreht nun als selbstständige Frau in Sankt Petersburg den Männern die Köpfe. Auch Myschkin verfällt ihrer Schönheit bereits beim Betrachten eines Porträts, um so mehr als er ihr persönlich begegnet. Bei dieser ersten Begegnung bei Nastassjas Geburtstagsfeier erweist sich Myschkin auch eindeutig als äußerst merkwürdige Natur, denn er macht Nastassja, kaum hat er sie kennengelernt sogleich einen Heiratsantrag, offenbar in der Absicht, sie vor einer Beziehung mit Rogoschin zu retten.
Nach der Zuspitzung gleich dieses ersten Tages verschwinden zuerst Rogoschin und Nastassja nach Moskau; Myschkin folgt ihnen unmittelbar. Der zweite von vier Teilen des Romans beginnt etwa sechs Monate nach diesen Ereignissen als Myschkin nach Sankt Petersburg zurückkehrt und sehr bald erfährt, dass sich Nastassja in Pawlowsk – der Sommerresidenz des Zaren – aufhält. Er reist ihr nach, mietet sich bei einer der Nebenfiguren des Romans ein und kommt hier auch wieder in Kontakt mit der Familie Jepantschin. In den Kreisen, in denen Myschkin verkehrt, weiß man, dass er in der Zwischenzeit wenigstens eine Weile lang mit Nastassja im selben Haushalt zusammengelebt hat, sie ihm am Ende aber weggelaufen sei. Einerseits erklärt Myschkin sein Interesse an Nastassja als vom Mitleid mit dieser Frau getragen, die er mehrfach als wahnsinnig bezeichnet, andererseits scheint Myschkin sich nun für Aglaja Iwanowna Jepantschin zu interessieren, der er während seines Aufenthalts in Moskau auch einen merkwürdig vertraulichen Brief geschrieben zu haben scheint. Aglaja ist wiederum einerseits offensichtlich von Myschkin und seinem Außenseitertum fasziniert, andererseits scheint er ihr aufgrund seiner gesellschaftlichen Ungeschicklichkeit und seiner großen Naivität als Ehemann vollkommen ungeeignet. Ein bedeutender Teil der Erzählung beschäftigt sich nun mit der langsamen Zubereitung Myschkins als Ehekandidaten für Aglaja, eine Hoffnung, die bei dem ersten großen Empfang, bei dem Myschkin in den Freundes-, Bekannten- und Gönnerkreis der Jepantschins eingeführt werden soll, musterhaft scheitert, als sich Myschkin nicht nur anlässlich einer religiösen Frage in Rage redet, sondern die Feier auch noch dadurch beendet, dass er einen epileptischen Anfall erleidet.
Als sei dies nicht genug, kommt es zu einem weiteren Skandal, als Myschkin Aglaja auf deren Wunsch hin zu Nastassja begleitet, die Aglaja mehrfach geschrieben hat, angeblich um deren Hochzeit mit Myschkin zu befördern. Es kommt zu einer exzessiven Eifersuchtsszene zwischen den beiden Frauen, und anstatt Aglaja bei deren wütendem Abgang zu folgen, bleibt Myschkin bei der nervlich zerrütteten Nastassja. Nun scheint seine Hochzeit mit ihr eine beschlossene Sache zu sein. Aber auch dieser Plan scheitert und der Roman endet in einer größtmöglichen Katastrophe. Myschkin wird durch die letzten Ereignisse des Romans so erschüttert, dass er in den katatonischen Zustand zurückkehrt, in dem er fünf Jahre zuvor in die Schweiz gebracht worden war. Er wird in dasselbe Hospital gebracht, doch diesmal erklärt der Schweizer Doktor ihn für unheilbar.
Der Idiot ist unzweifelhaft ein sehr ungewöhnlicher Roman: Auf der einen Seite arbeitet er als ein Liebes- und Eheanbahnungsroman eines der trivialen Muster der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts ab, auf der anderen führt er aber ein diesem Muster offensichtlich zuwiderlaufendes Gedankenexperiment durch, das in dem Versuch besteht, einen weitgehend unsozialisierten Menschen – Myschkin wird mehrfach als Kind bezeichnet und hat seine einzigen sozialen Kontakte in der Schweiz mit Kindern gehabt – auf die russische Gesellschaft mit all ihren Ritualen, Rangstufungen und Intrigen loszulassen. Myschkin ist ein weiteres Exemplar des Naturmenschen in der Literatur des 19. Jahrhunderts, in diesem Fall nicht durch seine Herkunft, sondern durch seinen Lebensweg und seine Krankheit von der Sozialisation abgeschnitten. Ihm ist jede Boshaftigkeit fremd, jede Lust daran, anderen zu schaden, jegliche Leidenschaft, jegliche Gier, jegliche Selbstsucht. Seine Liebe erscheint stets uneigennützig und rein, wenn sie auch zu Aglaja und Nastassja sicherlich unterschiedlich motiviert ist. Myschkin ist der von der Gesellschaft noch nicht verdorbene Mensch. Sein Schicksal ist eine scharfe Kritik des Christen Dostojewskij an der Gesellschaft seiner Zeit, auch wenn Myschkin letztlich nicht an dieser Gesellschaft, sondern an einem Verbrechen scheitert, das offenbar aus Leidenschaft begangen wird. Myschkin zerbricht an der Realität des Menschen, nicht nur an der Konstruktion seines Zusammenlebens.
Auch diesmal hat sich für mich wieder die Übersetzung Swetlana Geiers bewährt: Der Idiot ist der einzige Roman Dostojewskijs, den ich in der Übersetzung Hermann Röhls komplett gelesen hatte, aber ohne mich mit ihm anfreunden zu können. Die differenzierte und oft lakonische Sprache Geiers hat auch diesen Roman für mich geöffnet.
Fjodor Dostojewskij: Der Idiot. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Lizenzausgabe. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. Pappband, Fadenheftung, 911 Seiten. Lieferbar als Fischer Taschenbuch für 15,– €.