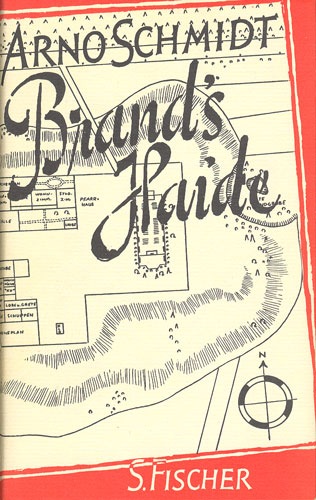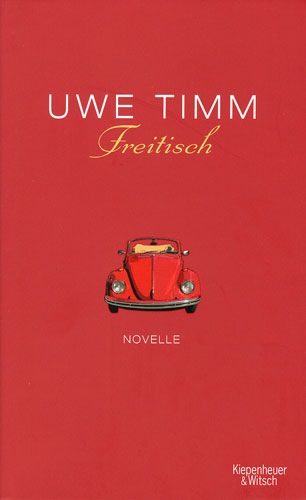›Das Unglück sei von diesem Haus so fern, wie der Morgenstern vom Abendstern‹, sollte der Zimmermann, beim ›Richtspruch‹, unserm Heim angewünscht haben; (»: ’fluchter Idijot!« hatte mein Großonkel, jedesmal wenn er’s erzählte, hinzugefügt).
Im Jahr 1956 schreibt Arno Schmidt den Essay »Das schönere Europa«, in dem in grober Übersicht die Anstrengungen der europäischen Nationen anläßlich des Venus-Transits vom 3. Juni 1769 geschildert werden.
Venus-Transite sind rare Ereignisse, wenn man an einen irdischen Standpunkt gebunden ist: Man kann sich leicht vorstellen, dass die beiden inneren Planeten – also jene, die innerhalb der Erdbahn unsere Sonne umkreisen – aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit die Erde regelmäßig innen überholen. Sie sind dabei allerdings nur äußerst selten zu beobachten, was daran liegt, dass die Planetenbahnen nicht alle genau in einer Ebene liegen, sondern leicht gegeneinander geneigt erscheinen. Und so stehen die Planeten Merkur und Venus nur sehr selten bei ihrem Vorbeigang zwischen Erde und Sonne so, dass sie von der Erde aus gesehen als dunkle Scheiben vor der Sonne erscheinen. Einen solchen sichtbaren Vorbeigang vor der Sonnenscheibe nennt der Astronom einen Transit. Dabei ist der der Venus der interessantere, da er länger dauert – Venus ist langsamer als Merkur – und die Venus deutlich größer als Merkur und zudem näher an der Erde ist, so dass ihre Beobachtung leichter fällt und die Ergebnisse präziser werden. Leider geschehen Venus-Transite nur etwa alle 105 bzw. 122 Jahre, dann aber gleich zwei Transite innerhalb von nur acht Jahren. Der vorletzte Venus-Transit war 1882 zu beobachten, der letzte im Jahr 2004 und der nächste wird morgen eintreten.
Die Frage, die sich im 18. Jahrhundert mit Hilfe der Venus-Transite lösen ließ, war die nach den Abständen im Sonnensystem. Das dritte Keplersche Gesetz, das eine Abhängigkeit zwischen den Quadraten der Umlaufzeiten der Planeten und den Kuben ihrer mittleren Entfernung zur Sonne behauptete, war empirisch nicht zu überprüfen, solange man die Entfernungen der Planeten zur Sonne nicht genau kannte.
Nun hatte – wie auch Schmidt richtig schreibt – der englische Astronom Edmond Halley den dringenden Vorschlag gemacht, die für 1761 und 1769 vorhergesagten Venus-Transite dazu zu nutzen, die Entfernung der Erde zur Sonne zu bestimmen, von der ausgehend sich alle anderen Distanzen im Sonnensystem dann bestimmen lassen würden.
Bereits beim Transit von 1761 hatten die großen europäischen Nationen, vornehmlich England und Frankreich, die in der Astronomie des 18. Jahrhunderts führenden Nationen, nicht unerhebliche Anstrengungen unternommen, das Ereignis zu beobachten. Es hatte bereits so etwas wie einen partiellen Waffenstillstand zum Schutz der wissenschaftlichen Expeditionen – die Großteils über See reisen mussten – gegeben. Die damals gewonnen Daten blieben aber weitgehend unzureichend und sollten nun vervollständigt werden. Schmidt betont z. B. zu Recht, dass es die erste Aufgabe der Expedition der Endeavour unter James Cook war, Astronomen der Royal Society nach Tahiti zu bringen, wo sie den Venus-Durchgang glücklich beobachten konnten.
Interessant an Schmidts Darstellung in »Das schönere Europa« ist hauptsächlich der politische Aufhänger, den Schmidt sich für dieses wesentlich astronomische Thema wählt: Die wissenschaftliche Leistung, die Schmidt in anekdotischer und detailverliebter Weise vermittelt, wird gerahmt durch die Feststellung, die führenden Nationen – mit Ausnahme Spaniens – hätten in diesem einen Fall einmal vorbildhaft zusammengearbeitet und einander unterstützt:
A.: Sechs Jahre vorher noch hatten sie nicht Fernrohre sondern Kanonen aufeinander gerichtet, diese Russen; Preußen; Engländer; Österreicher; Franzosen; und bald danach begannen sie wieder das alte blutige Spiel, unentwegt, bis heute.
B.: Aber einmal wenigstens war man doch, und auf’s Erhabenste, einig gewesen :
A. (mit Nachdruck): Siebzehnhundertneunundsechzig !
B. (desgleichen): Am dritten Juni ! [II/1, 274]
Einmal abgesehen von dem sprachlogischen Einwand, dass am 3. Juni 1769 besagte Russen, Preußen, Engländer, Österreicher und Franzosen ihre Fernrohre nicht aufeinander, sondern auf die Sonne gerichtet hatten, erscheint diese Rahmung des astronomischen Materials sehr gesucht. 1769 herrschte seit sechs Jahren Frieden zwischen den genannten Nationen – und dieser Friede hatte nichts mit dem Venus-Transit zu tun –, und die Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse fremder, auch feindlicher Nationen war im 18. Jahrhundert nichts so Besonderes. Viel eher erwähnenswert war etwa, dass die Expeditionen von 1761 – mitten im Siebenjährigen Krieg – unter gegenseitiger Tolerierung der Engländer und Franzosen durchgeführt wurden. Auch schon 1761 war die Publikation und der Austausch der – leider ungenügenden – Daten eine Selbstverständlichkeit. Und so viel kooperativer war die Zusammenarbeit der Forscher 1769 dann auch wieder nicht, wie auch Schmidts deutlich vermittelt:
B.: Jedenfalls entstand eine ganze Literatur um den großen Venusdurchgang von 1769. – Die Engländer fassten ihre Beobachtungen zusammen in vielen Nummern der ‹Philosophical Transactions›. Die Franzosen in den ‹Mémoires de l’Académie Française›; und in dem wichtigen Werk Lalande’s ‹Mémoire sur le Passage de Venus›. Die Schweden gaben ein eigenes Heft heraus. Ebenso die Amerikaner in ihren jungen ‹Memoirs of the American Academy›, und den ‹American Transactions›. Die kalifornischen Beobachtungen wurden zusammengefaßt von Cassini. Die zahlreichen russischen erschienen in einem eigenen Foliobande: ‹Collectio omnium observationum quae occasione transitus Veneris jussu Augustae per imperium Russicum institutae fuerunt. Petropoli 1770.›
A.: Die endgültigen Berechnungen ergaben für die gesuchte Entfernung Sonne=Erde Werte zwischen 145 und 155 Millionen Kilometer; jenachdem die Rechner das Hauptgewicht auf diese oder jene Beobachtung legten – eine knifflige und äußerst schwer zu entscheidende Frage. Während wir heute wissen, daß die Sonnenparallaxe 8,79 Sekunden beträgt, erhielt damals der schwedische Rechner Planmann – der, begreiflicherweise, den Akzent auf seine, und die übrigen nordischen Beobachtungen legte – 8,43 Sekunden. Der Engländer Lexell 8,60; wobei er hauptsächlich die Messungen von Tahiti zugrunde legte, die also das Ergebnis entscheidend verschlechterten. Euler in Petersburg erhielt 8,68; Hell 8,70. [II/1, 273 f.]
Es kann also mit einiger Berechtigung bezweifelt werden, ob die von Schmidt mit soviel Pathos in den Vordergrund gerückte politische Einigkeit Europas sich nun gerade an diesem Fall so einmalig und einzigartig eingestellt hat. Schmidt hat diesen Aufhänger wahrscheinlich aus einer verkaufstaktischen Erwägung heraus gewählt: Da er 1956 für das behandelte historische Ereignis nicht die Rechtfertigung eines runden Jubiläums hatte, versuchte er, es in den Rahmen der für die 50er Jahre zentralen politischen Diskussion um die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft einzustellen.
Leicht aktualisierter Auszug aus dem Vortrag:
Julianische Tage in Lilienthal
Astronomisches bei Arno Schmidt