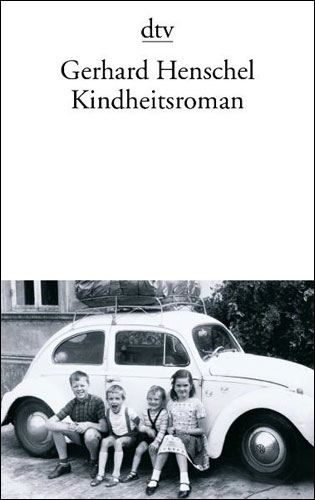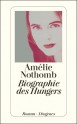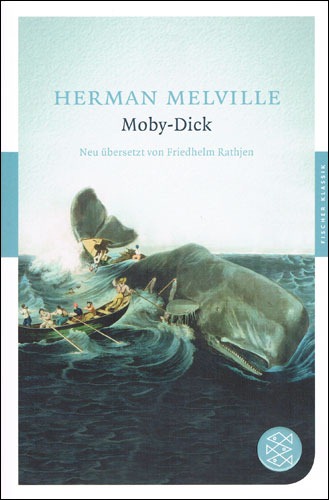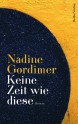 Eine besondere Lektüre durch meine Teilnahme an dem Leseprojekt Gordimer Lesen, die ich zusammen mit der Lektüre des Buches vorzeitig beendet habe. Zu den Gründen, die dazu geführt haben, habe ich dort ein Posting verfasst.
Eine besondere Lektüre durch meine Teilnahme an dem Leseprojekt Gordimer Lesen, die ich zusammen mit der Lektüre des Buches vorzeitig beendet habe. Zu den Gründen, die dazu geführt haben, habe ich dort ein Posting verfasst.
Der Roman spielt hauptsächlich in den Jahren nach der Aufhebung der Apartheid und dem Wahlsieg des ANC in Südafrika. Im Zentrum scheint ein junges Ehepaar zu stehen, das aufgrund der Tatsache, dass er ein weißer Jude und sie eine schwarze Methodistin ist, vor der Revolution eine geheime Ehe geführt haben. Sie haben am Kampf gegen das Apartheids-Regime teilgenommen und beginnen nun eine bürgerliche Existenz zu führen: Er wird Universitäts-Dozent, sie arbeitet für die Staatsanwaltschaft.
Doch ist das Ehepaar nicht das eigentliche Thema des Buchs: Der Fokus der Erzählung liegt auf den gesellschaftlichen und sozialen Realitäten im nun endlich freiheitlichen Südafrika, die – wen überrascht es? – von den Idealvorstellungen der ehemaligen Revolutionäre erheblich abweichen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden auch weiterhin von unterschiedlichen rassistischen Vorurteilen überschattet, einige der ehemaligen Freiheitskämpfer entpuppen sich als korrupte, selbstsüchtige und machtbesessene Machos, Armut und ungleiche Bildungschancen existieren immer noch und die Flüchtlinge aus den Nachbarländern werden zum sozialen Bodensatz der neuen Gesellschaftsordnung. All dies wird mit einer unterschwelligen Mischung von Zorn und Enttäuschung geschildert, wobei die Schilderungen selbst oberflächlich und ohne analytischen Zugriff bleiben; jeder bessere Zeitungsartikel dürfte detaillierter, neutraler und solider über die Sachverhalte informieren. Auch den Antrieb des Erzählens selbst reflektiert die Autorin nicht. Sie dringt zwar bis zu der Frage vor, warum die Revolutionäre denn erwartet und geglaubt hätten, dass gerade in Südafrika das Goldenen Zeitalter ausbrechen werde, statt dass sich eine der ganz gewöhnlichen Spielarten des modernen Elends einstelle, aber sie bleibt von der Frage fixiert und dringt auch hier zu keinem analytischen oder selbstkritischen Gedanken durch. Und die politische Naivität der Autorin schlägt direkt auf die Figuren durch.
Da es Gordimer wesentlich um die Darstellung der südafrikanischen Gesellschaft und nicht um die Fabel geht, bleiben die Figuren flach, die Handlung springt erratisch, folgt erst diesem und dann jenem Einfall. Es werden Nebenfiguren eingeführt, die augenblicklich und folgenlos wieder verschwinden. Es wird keinerlei Form oder Struktur erkennbar. Der Großteil der Gedanken der Figuren, wenn sie denn überhaupt welche zugeschrieben bekommen, sind trivial, die Auswahl der verwendeten Motive ist voraussehbar und langweilig. Einzig die Sprache, die Gordimer verwendet, ist sperrig (die bedauernswerte Übersetzerin tut übrigens ihr Bestes, das im Deutschen nachzubilden) und verhindert, dass sich die Leser wie in einem Trivialroman einrichten. Aber das allein genügt selbstverständlich nicht, um ein gelungenes Buch auszumachen.
Nadine Gordimer: Keine Zeit wie diese. Aus dem Englischen von Barbara Schaden. Berlin: Berlin Verlag, 2012. Pappband, Lesebändchen, 506 Seiten. 22,99 €.