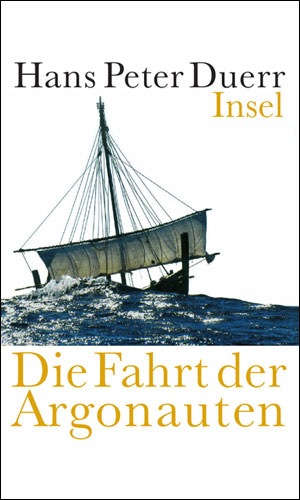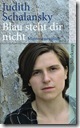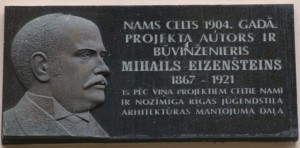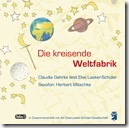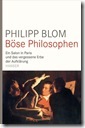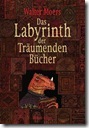… und sie seien genötigt worden, ohne jede Ordnung Unmengen von Wein zu trinken.
Bei der sogenannten Symposienliteratur handelt es sich um das antike Pendant zur Talkshow: Der Autor lässt mehr oder weniger berühmte Zeitgenossen zusammenkommen, die sich bei Gelegenheit eines abendlichen Festes mehr oder weniger intelligent über philosophische, politische oder auch einfach nur tagesaktuelle Themen unterhalten. Dabei tut es in der Antike wenig zur Sache, ob diese Gespräche tatsächlich so stattgefunden haben, so wie es heute wenig zur Sache tut, ob die Politiker das tatsächlich glauben, was sie von sich geben, oder ob irgend etwas von dem Gesagten richtig ist.
Urmuster aller Symposienliteratur sind – wenigstens aus unserer Sicht – zwei Texte: Das Platonische »Gastmahl« und das sich offensichtlich auf diesen Text beziehende Buch Xenophons mit demselben Titel. Allerdings sind diese beiden Vorlagen von höchst unterschiedlichem literarischen Gewicht, was man besonders deutlich spürt, wenn man beide unmittelbar nacheinander liest. In beiden tritt als zentrale Figur der Philosoph Sokrates auf, der aber von beiden Autoren, die beide das lebende Vorbild persönlich gekannt haben, sehr unterschiedlich geschildert wird; doch dazu später noch ein paar Sätze.
 Platons »Symposion« nimmt den Sieg des Philosophen und Schriftstellers Agathon, eines der Schüler des Sokrates, mit seiner ersten Tragödie bei einem der Feste zu Ehren des Dionysos (wahrscheinlich im Jahr 416 v. u. Z.) zum Anlass für ein abendliches Gelage. Es ist der Tag nach dem Sieg; bereits am Vorabend haben der Dichter und einige seiner Freunde ein ausschweifendes Fest gefeiert, von dem die nun im Hause des Agathon zusammenkommenden Freunde noch gezeichnet sind. Man beschließt deshalb gleich zu Anfang des Festes, heute Mäßigkeit walten zu lassen und sich nicht wieder so zu besaufen wie am Vortag. Stattdessen will man lieber ein kultiviertes Gespräch pflegen, wozu der Sokrates-Schüler Phaidros das Thema vorgibt: den Gott Eros, dessen Kult unverständlicher Weise nicht seiner umfassenden Stellung im Kosmos entspreche.
Platons »Symposion« nimmt den Sieg des Philosophen und Schriftstellers Agathon, eines der Schüler des Sokrates, mit seiner ersten Tragödie bei einem der Feste zu Ehren des Dionysos (wahrscheinlich im Jahr 416 v. u. Z.) zum Anlass für ein abendliches Gelage. Es ist der Tag nach dem Sieg; bereits am Vorabend haben der Dichter und einige seiner Freunde ein ausschweifendes Fest gefeiert, von dem die nun im Hause des Agathon zusammenkommenden Freunde noch gezeichnet sind. Man beschließt deshalb gleich zu Anfang des Festes, heute Mäßigkeit walten zu lassen und sich nicht wieder so zu besaufen wie am Vortag. Stattdessen will man lieber ein kultiviertes Gespräch pflegen, wozu der Sokrates-Schüler Phaidros das Thema vorgibt: den Gott Eros, dessen Kult unverständlicher Weise nicht seiner umfassenden Stellung im Kosmos entspreche.
Am Fest nehmen vorerst außer dem Gastgeber und den schon erwähnten, Sokrates und Phaidros, drei weitere Gäste teil: der Adelige Pausanias, der Arzt Eryximachos und der Komödienautor Aristophanes. Es wird beschlossen, dass jeder der Anwesenden reihum eine Rede auf den Eros halten solle, wobei der Gott Dionysos selbst als Schiedsrichter angerufen wird, der am Ende entscheiden solle, wer die beste Rede gehalten habe.
Phaidros, der das Thema vorgeschlagen hat, beginnt: Er erklärt Eros für die älteste aller Gottheiten, der es zu verdanken ist, dass überhaupt Ordnung (κόσμος) aus dem ursprünglichen Chaos entstanden sei. Insofern sei Eros der Ursprung aller anderen Götter und ihm sollte als alles durchdringendes Prinzip gehuldigt werden. Phaidros’ sehr allgemein gehaltenen Ausführungen folgt die Rede des Pausanias, der zwischen zwei Formen des Eros unterscheiden möchte: Ebenso wie sich die himmlische Aphrodite (A. urania) von der gewöhnlichen Aphrodite (A. pandemos) unterscheide, so auch der sie jeweils begleitende Eros. Der himmlische Eros verkörpere im Gegensatz zum gewöhnlichen eine reine, sexuelle Befriedigung verachtende Liebe, wie sie vorzüglich im Verhältnis von Männern und Knaben zueinander vorkomme. Diese Ausführungen dienen im wesentlichen als propädeutische Hinführung zu den Gedanken des Arztes Eryximachos, der berufsbedingt grundsätzlich physiologisch argumentiert: Für ihn ist der wahre Eros eine Frage der Harmonie von einander widerstrebenden Prinzipien. In allem gelte es das rechte Maß zu finden, um, wie in der Musik, das Auseinanderstrebende in Einklang zu bringen.
Auch dies erweist sich letztlich nur als eine Hinführung zur Erzählung des Aristophanes: Der Komödiendichter erfindet ad hoc eine Mythologie der Sexualität, die sicherlich zu den meist rezipierten Stellen der antiken Literatur gehört: Der Mensch habe in prähistorischer Zeit in drei Geschlechtern existiert, einem weiblichen, einem männlichen und einem androgynen. Um die Menschen für ihren Übermut gegen die Göttern zu bestrafen und sie daran zu hindern, den Himmel zu stürmen, habe Zeus sie geteilt. Aus ihrer vierbeinigen, runden Form habe er sie zu zweibeinigen Wesen gemacht, die nun unter der Drohung einer nochmaligen Teilung in Furcht vor den Göttern existieren. Aus dieser Teilung resultiert die Leidenschaft des Eros, da alle Menschen nun auf der Suche nach ihrem fehlenden Gegenpart sind, mit dem sie sich wieder zu vereinigen suchen. Diejenigen deren Ursprung ein männlicher Vierbeiner gewesen sei, suchten ihre Ergänzung als Mann bei Männern, so wie die Frauen von rein weiblichem Ursprung die Liebe der Frauen suchten; die Androgynen neigen verständlicher Weise zum jeweils anderen Geschlecht. Hier werden nicht nur homo- und heterosexuelle Liebe als gleichwertig und aus gleichem Ursprung stammend begriffen, sondern dies ist auch die erste Stelle der Weltliteratur an der weibliche und männliche Homosexualität als wesenhaft identisch beschrieben werden. Diese schlichte Fabel ist von erstaunlicher Klarheit und öffnet sich leicht zahlreichen deutenden Zugriffen.
Den Abschluss des rhetorischen Vorspiels bildet eine Lobrede des Agathon auf den Eros als jüngsten, schönsten und glückseligsten Gott, der sogar als König der Götter bezeichnet wird. Besonders die Charakterisierung des Eros als Jüngstem unter den Göttern, die in direktem Widerspruch zu der anfänglichen Rede des Phaidros steht, macht klar, dass die Reden in ihrer Gesamtheit einen kompletten dialektischen Zyklus durchlaufen haben und als eine durchkomponierte Einheit aufgefasst werden sollen. Es folgt als nächster Schritt die Rede des Sokrates, der Eros nicht als Gott, sondern als Dämon (δαίμων) definiert. Wie sooft bei Platon macht Sokrates dezidierte inhaltliche Aussagen nicht mit seiner eigenen Stimme, sondern er zitiert, was andere gesagt haben. In diesem Fall handelt es sich um eine der wirkungsmächtigsten Frauenfiguren der Antike: die Priesterin Diotima, die angeblich den jungen Sokrates über die Mysterien des Eros belehrt habe.
Eros, so lehrt sie, ist ein Sohn von Mangel (Πενία) und Ausweg (Πόρος), von daher schon in seinem Ursprung als ein Mangelwesen bestimmt. Gerade weil es ihm an all dem mangelt, was ihm Agathon gerade als wesenhaft zugeschrieben hat, strebt er beständig danach, es zu erreichen: Er ist nicht schön, nicht vollkommen, nicht glückselig und besonders nicht unsterblich und daher auch nicht göttlich, sondern ein Zwischenwesen zwischen den sterblichen Menschen und unsterblichen Göttern. Aus dem Streben des Eros nach der Unsterblichkeit folgt auch das Bedürfnis der ihm verwandten Sterblichen nach Ruhm und ihr Verlangen, sich in ihren Kindern und Kindeskindern fortzuzeugen. Auch der platonische Aufstieg des Philosophen von der Schönheit der Körper über die Schönheit der Seelen und der Schönheit der Erkenntnis schließlich zur Erkenntnis der Idee der Schönheit selbst folgt direkt aus dem dem Eros verdankten Streben nach der Aufhebung des prinzipiellen Mangels der körperlichen, endlichen Existenz.
Sokrates wird in seinen Ausführungen unterbrochen durch die unerwartete Ankunft des volltrunkenen Alkibiades. Alkibiades tritt geschmückt mit allen Attributen des Gottes Dionysos auf, und er ist enthusiasmiert vom Wein. Seine Aufgabe ist es, die abschließende Rede des Symposions zu halten, in der durch ihn hindurch der Gott Dionysos selbst Sokrates als die ideale Verkörperung des Eros auszeichnet: Auch er ermangelt der Schönheit und Weisheit, strebt aber in jedem Moment seines Lebens nach ihnen. Er sucht Erkenntnis zu erlangen, verachtet die Genüsse und Anfechtungen der körperlichen Existenz, wie sein Verhalten in Liebesdingen und unter den harten Anforderungen des Krieges unter Beweis gestellt hat. Nach dieser Lobrede geht das Symposion in ein allgemeines Besäufnis über, in dem sich Sokrates einmal mehr als der einzige beweist, der dem Gott Dionysos nicht unterliegt. Als alle schon schwer betrunken mit Schlaf kämpfen oder ihm bereits erlegen sind, ist er noch immer munter:
Die Hauptsache sei jedoch gewesen, dass Sokrates sie genötigt habe zuzugeben, dass es die Aufgabe ein und desselben Mannes sei, sich auf die Dichtung von Komödien und Tragödien zu verstehen, und dass der professionelle Tragödiendichter auch Komödiendichter sei. Zu diesem Eingeständnis genötigt, seien sie – nicht richtig in der Lage zu folgen – eingenickt.
Diese letzte Bemerkung allein, die noch einmal das den ganzen Text bestimmende Spiel von Ernsthaftigkeit und ironischer Distanzierung, von Scherz und Philosophie, von hohler Rhetorik und tiefsinniger Allegorie zusammenfasst, ist eine der wundervollsten Stellen der antiken Literatur. Das ganze Stück ist von einer Ausgewogenheit der Komposition, von einer zugleich formalen Strenge und inhaltlichen Leichtigkeit, dass man lange suchen muss, um ihm etwas literarisch annähernd gleichrangiges an die Seite zu stellen.
 Einen gänzlich anderen Eindruck vermittelt dagegen das »Gastmahl« Xenophons. Seine in Teilen gewollt wirkende Kunst- und Anspruchslosigkeit ist seit der Antike immer wieder als Indiz für den Realismus des Stücks gedeutet worden. Noch eine der neueren, populären Editionen der sokratischen Schriften Xenophons (Eichborn, 1998) will die Frage, ob es sich dabei um ein getreues Abbild der athenischen Gesellschaft und besonders des Sokrates handelt, zumindest unentschieden lassen. Dabei wurde bereits in der Spätantike der Nachweis geführt, dass es sich beim »Gastmahl« Xenophons um eine ebensolche Fiktion handelt wie beim platonischen. Im Gegensatz zum platonischen Text fehlt jeder Versuch einer durchgängigen Komposition, ja, literarische Härten werden der realistischen Wirkung halber bewusst im Kauf genommen.
Einen gänzlich anderen Eindruck vermittelt dagegen das »Gastmahl« Xenophons. Seine in Teilen gewollt wirkende Kunst- und Anspruchslosigkeit ist seit der Antike immer wieder als Indiz für den Realismus des Stücks gedeutet worden. Noch eine der neueren, populären Editionen der sokratischen Schriften Xenophons (Eichborn, 1998) will die Frage, ob es sich dabei um ein getreues Abbild der athenischen Gesellschaft und besonders des Sokrates handelt, zumindest unentschieden lassen. Dabei wurde bereits in der Spätantike der Nachweis geführt, dass es sich beim »Gastmahl« Xenophons um eine ebensolche Fiktion handelt wie beim platonischen. Im Gegensatz zum platonischen Text fehlt jeder Versuch einer durchgängigen Komposition, ja, literarische Härten werden der realistischen Wirkung halber bewusst im Kauf genommen.
Das Gastmahl findet in diesem Fall im Hause des reichen Kallias statt, dessen Hauptlebensinhalt es war, das väterliche Erbe durchzubringen, was ihm wohl auch mehr oder weniger gelungen zu sein scheint. Kallias befindet sich mit dem jungen Autolykos, einem erfolgreichen Sportler, in den er verliebt ist, und dessen Vater auf dem Weg von einem Pferderennen nach Hause, als er unterwegs zufällig auf Sokrates und eine Gruppe seiner Begleiter trifft und sie zu einer Feier in seinem Hause einlädt. Sokrates ziert sich ein wenig, da Kallias sonst ausgiebig Umgang mit den Sophisten pflegt, will ihn aber letztlich nicht vor den Kopf stoßen und nimmt die Einladung daher an. Dort angekommen werden erst einmal Tanz und Flötenspiel der herbeigeholten Unterhaltungskünstler rezensiert, bevor man eine allgemeine Gesprächsrunde darüber eröffnet, auf welche seiner Fähigkeiten oder Eigenschaften jeder Gast besonders stolz ist. Dabei zeichnet sich Sokrates vor allen anderen durch seine auf den ersten Blick paradoxe Antwort aus, er sei auf seine Fähigkeiten als Kuppler besonders stolz. Die Erklärungen der einzelnen Gäste zu ihren Fähigkeiten werden von den anderen durch zahlreiche teils witzige, teils spöttische Anmerkungen kommentiert. Bei den Ausführungen des Sokrates versucht sich Xenophon dann in einer Parodie der platonischen Dialoge, indem er den Sokrates in der üblichen Manier Fragen stellen lässt, die die anderen Gäste stur immer erneut nur mit der einzigen Phrase πάνυ μὲν οὖν – einer im Deutschen nicht adäquat wiederzugebenden Häufung dreier bestätigender Wörter, ungefähr wie aber selbst doch freilich – beantworten.
Nach einem weiteren Zwischenspiel der kleinen Animationstruppe versucht Xenophon, sein »Symposion« in unmittelbare Konkurrenz zum platonischen zu stellen, indem er Sokrates eine ausführliche und gelehrte Rede zum Lobe des Gottes Eros halten lässt, die nicht nur inhaltlich, sondern auch ihrem Grundcharakter nach allem widerspricht, was wir aus den platonischen Frühschriften an Darstellungen des Sokrates kennen. Diese Rede führt zudem die gesamte Anlage der Erzählung als eine über ein geselliges Zusammensein derartig in eine Sackgasse, dass Xenophon sich nur mit einer höchst hölzernen Wendung aus ihr zu retten weiß:
Damit endete diese Gespräch. Autolykos – es war bereits Zeit für ihn – stand zu einem Spaziergang auf, und sein Vater Lyon wollte mit ihm hinausgehen, als er sich noch einmal umdrehte und sagte: »Bei der Hera, Sokrates, du scheinst mir ein Mensch von sittlichem Adel zu sein!«
Nichts in diesem »Gastmahl« kann auch nur für einen Moment ernsthaft mit dem konkurrieren, was das platonische Vorbild bietet. Sein Witz ist vergleichsweise platt, seine Figurengestaltung mehrheitlich eindimensional, wenn nicht gar einfältig, sein Moralisieren naiv und ohne jeden Esprit. Insgesamt bleibt der Eindruck, dass sich hier ein Schriftsteller deutlich überhebt, indem er versucht mit einem Autor in Konkurrenz zu treten, dem er weder literarisch noch inhaltlich das sprichwörtliche Wasser reichen kann. Über eine rein historische Ebene hinaus ist dieser Text schlicht eine Enttäuschung.

Vergleichsweise erfrischend ist Lukians Parodie auf die Symposienliteratur: Bei ihm kommen die vortrefflichsten Vertreter diverser philosophischer Schulen bei der Hochzeit der Kinder zweier Geldadliger zusammen. Diese führenden Köpfe der Stadt sind während des Festes in der Hauptsache damit beschäftigt, einander gegenseitig schlecht zu machen und sich nach Möglichkeit die besten Stücke auf der Tafel wegzuschnappen. Das ganze endet denn auch konsequent in einer großen Schlägerei, aus der fast alle Beteiligten mit erheblichen Blessuren hervorgehen: einem der Philosophen fehlen am Ende die Nase und ein Auge, die er in der Hand vom Schlachtfeld des Symposions trägt, was einen seiner philosophischen Kollegen nur zu einer höhnischen Bemerkung mehr veranlasst. Lukians Erzähler wenigstens zieht eine nützliche Lehre aus dem Geschehen:
Ich für meinen Teil habe mir diese Moral daraus gezogen: daß es für einen, der kein Freund von bösen Händeln ist, eine gefährliche Sache sei, sich mit Philosophen dieses Schlages zu Gast bitten zu lassen. [Übers. v. Christoph Martin Wieland]
Vielleicht sollte man doch dem ein oder anderen heutigen Talkshow-Gast die Lektüre wenigstens des lukianschen »Gastmahls« ans Herz legen …
Platon: Symposion. Griechisch/Deutsch. Übers. und hrsg. von Thomas Paulsen und Rudolf Rehn. RUB 18435. Stuttgart: Reclam, 2006. Broschur, 215 Seiten. 5,– €.
Xenophon: Das Gastmahl. Griechisch/Deutsch. Hrsg. u. übers. von Ekkehard Stärk. RUB 2056. Stuttgart: Reclam, 1986. Broschur, 127 Seiten. 4,– €.
Lukian: Symposion. Griechisch/Deutsch. Übers. und hrsg. von Julia Wildberger. RUB 18377. Stuttgart: Reclam, 2005. Broschur, 95 Seiten. 3,– €.
 Nach sicherlich mehr als 20 Jahren der erste Stephen King, der mich wieder interessiert hat. Wie der Titel und noch mehr das Cover des Buches klar machen, geht es um das Attentat auf John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas. Gemäß dem Nachwort des Autors ist das Roman-Projekt etwa 40 Jahre alt, erschien King Anfang der 70er Jahre aber als zu aufwändig. Inzwischen ist King Inhaber einer gut laufenden Literatur-Werkstatt, die ihm in solchen Fällen zuarbeiten kann. Wer allerdings damit rechnet, in diesem Buch irgendwelche Einsichten zum Kennedy-Attentat zu finden, die über jede beliebige populäre Darstellung der Ereignisse hinausgeht, ja sie auch nur einholt, wird sich enttäuscht sehen. Das Buch ist in jeder Hinsicht banal.
Nach sicherlich mehr als 20 Jahren der erste Stephen King, der mich wieder interessiert hat. Wie der Titel und noch mehr das Cover des Buches klar machen, geht es um das Attentat auf John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas. Gemäß dem Nachwort des Autors ist das Roman-Projekt etwa 40 Jahre alt, erschien King Anfang der 70er Jahre aber als zu aufwändig. Inzwischen ist King Inhaber einer gut laufenden Literatur-Werkstatt, die ihm in solchen Fällen zuarbeiten kann. Wer allerdings damit rechnet, in diesem Buch irgendwelche Einsichten zum Kennedy-Attentat zu finden, die über jede beliebige populäre Darstellung der Ereignisse hinausgeht, ja sie auch nur einholt, wird sich enttäuscht sehen. Das Buch ist in jeder Hinsicht banal.