Ich war etwa 8 Jahre alt, Du 13. In unserem Kinderzimmer saßen wir fünf Brüder eines Abends, ein jeder an seinem kleinen Tischchen bei einer Talgkerze, mit unseren Schularbeiten beschäftigt. Ich hatte für den Prüfungstag, für den morgenden Tag also, in ein Heft die Gedichte abzuschreiben, die wir im Laufe des Semesters auswendig gelernt hatten. Eben hatte ich den letzten Vers abgeschrieben, als ich so ungeschickt war, das Tintenfaß anstatt der Streusandbüchse zu ergreifen und es über das Heft auszuleeren. Ich heulte jämmerlich; ich war wohl wehleidig. Der Schaden war freilich kaum wieder gut zu machen, weil meine Schreibfertigkeit damals noch kaum ausreichte, 32 Seiten in einer Nacht zu leisten. Für den Spott brauchte ich nicht zu sorgen. Du aber kamst an mich heran, überblicktest das Unheil prüfend und sagtest dann: »Leg’ dich nur ruhig schlafen; ich werde dir die paar Seiten abschreiben.« Ich tröstete mich schnell, schlief wirklich bald ein, und des Morgens fand ich das dumme Heft in Deiner schönen Handschrift auf meinem Tischchen, neben der herabgebrannten Kerze.
Fritz Mauthner
Wörterbuch der Philosophie
Wolfgang Koeppen: Der Tod in Rom
Wen sollte meine Musik erfreuen? Sollte sie überhaupt erfreuen? Sie sollte beunruhigen. Sie würde keinen hier beunruhigen.
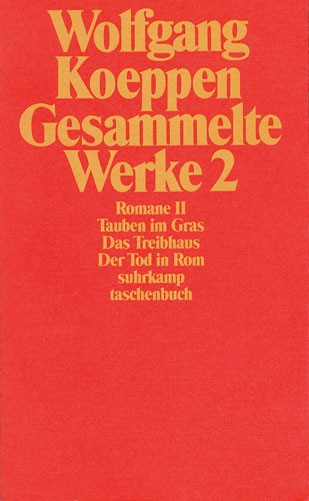
Furioser Abschluss der Trilogie des Scheiterns, 1954, also nur ein Jahr nach »Das Treibhaus« erschienen. Der Titel ist eine offensichtliche Anspielung auf die Erzählung »Der Tod in Venedig« von Thomas Mann. Bei Koeppen ist der Protagonist jedoch kein Schriftsteller, sondern »Tonsetzer«, der junge Komponist Siegfried Pfaffrath, der allerdings nur eine ausgezeichnete Position in einem Figurenensemble einnimmt. Mit »Der Tod in Rom« kehrt Koeppen erzähltechnisch zum ersten Teil der Trilogie zurück: Auch diesmal verfolgt er zahlreiche Figuren über den Verlauf von gut 48 Stunden, wobei zwei seiner Figuren allein durch die schiere Textmenge, die ihnen zugeordnet ist, ausgezeichnet werden: der schon erwähnte Siegfried Pfaffrath und sein Onkel Gottlieb Judejahn. Siegfried wird darüber hinaus auch noch dadurch herausgehoben, dass über ihn nicht nur personal erzählt wird, sondern er in zahlreichen Passagen auch als Ich-Erzähler auftritt.
Erzählt wird die Begegnung der Mitglieder einer deutschen Familie in Rom Anfang Mai 1954. Friedrich Wilhelm Pfaffrath, Oberbürgermeister einer deutschen Stadt, in der er bereits im Dritten Reich eine entsprechende hohe Verwaltungsposition inne hatte, ist mit seiner Frau, deren Schwester und seinem jüngsten Sohn Dietrich, einem Jura-Studenten, in Rom, um den mit seiner Schwägerin Eva verheirateten Gottlieb Judejahn zu treffen: Judejahn war SS-General und zumindest zeitweilig in dieser Funktion auch in Rom stationiert; zurzeit ist er Militätberater im Nahen Osten, eine Tätigkeit, die er als Fortsetzung seines Kampfes gegen die Juden versteht. Judejahn ist in Rom, um für seine Auftraggeber Waffen zu kaufen.
Pfaffraths älterer Sohn Siegfried ist zur gleichen Zeit in Rom, da anlässlich eines Musik-Kongresses eine seiner Kompositionen uraufgeführt werden soll. Dirigent ist der Siegfried väterlich zugetane Kürenberg, der vor dem Machtantritt der Nazis in der Stadt Pfaffraths tätig war und dessen Frau Ilse eine geflüchtete Jüdin aus eben dieser Stadt ist. Ilses Vater wurde von den Nazis wohl unter direkter Verantwortung Judejahns umgebracht, das Kaufhaus der Familie niedergebrannt. Kürenbergs sind nach England geflüchtet, wo Siegfried später als Insasse eines Gefangenenlagers mit Kürenberg Kontakt aufgenommen hat. Weder Siegfried noch die Kürenbergs ahnen zu Anfang des Romans etwas von den schicksalhaften Verwicklungen ihrer Familien.
Ebenfalls in Rom hält sich Adolf, der Sohn von Judejahn und Eva, auf: Wie Siegfried hat auch er in einer Ordensburg die Erziehungsmaschinerie der Nationalsozialisten durchlaufen, ist dann zu Kriegsende fortgelaufen und hat sich der katholischen Kirche zugewandt. Er ist noch in der Ausbildung zum Priester, was bei seinen beiden Elternteilen massive Verachtung auslöst. Aber auch Siegfried, der seine eigene Homosexualität als eine Folge der Erziehung in der Ordensburg begreift, lehnt den von Adolf gewählten Weg ab: Für ihn ist eine Sinngebung der menschlichen Existenz durch die christliche Religion nicht mehr glaubwürdig. Allerdings kann auch seine in der Hauptsache aus seiner Verzweiflung gespeiste Musik diese Funktion nicht erfüllen. Siegfried ist ganz im Sinne der zeitgenössischen Literatur als existenzialistische Figur entworfen.
Während Koeppens Darstellung des Großbürgertums der unmittelbaren Nachkriegszeit am Beispiel der Familie Pfaffrath eine gewisse resignative Gleichgültigkeit gegenüber der neuen Demokratie und eine sentimentale Trauer um die gute, alte Zeit Großdeutschlands zeigt, gerät ihm Judejahn zum Beispiel eines ungebrochen weiter der Ideologie des Nationalsozialismus anhängenden, unbelehrbaren Fanatikers. Judejahn bereut keine seiner Handlungen während des Dritten Reichs, betont sogar mehrfach, dass der Fehler darin bestanden habe, nicht genug Leute umgebracht zu haben, verwendet weiterhin ungebrochen die Phrasen des Nationanalsozialismus und hat nichts von seiner umfassenden Verachtung alles und aller Nichtdeutschen verloren. Judejahn ist nicht nur immer noch ein williger Handlager des Todes, er selbst ist der Tod in Rom, ohne Menschlichkeit und Mitleid, ohne jegliche Kultur, ungebildet, hasserfüllt und voller Ressentiment. In dieser Figur rechnet Koeppen nicht nur mit der unmenschlichen Ideologie des Dritten Reichs ab, er macht auch deutlich, dass sich Vertreter dieses Denkens immer noch auf freiem Fuß befinden und nur darauf warten, nach Deutschland zurückzukehren, um dort wieder die alten Verhältnisse herbeizuführen. Es wird schwer sein, eine solch intensive Darstellung der Unmenschlichkeit nationalsozialistischen Denkens in einer einzigen Figur in der deutschsprachigen Literatur noch einmal zu finden.
Mit diesem Roman hat leider auch das Romanwerk Koeppens seinen Abschluss gefunden. Es ist sehr bedauerlich, dass dieser Autor, der offensichtlich eine der großen erzählerischen Begabungen der Nachkriegsliteratur war, die Geschichte der Bundesrepublik nicht weiter begleitet hat. Es ist allerdings, nimmt man seine Einschätzung von der Wirkungslosigkeit der Kunst ernst, auch nur zu verständlich.
Wolfgang Koeppen: Der Tod in Rom. In: Gesammelte Werke 2. Romane II. st 1774. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1990. Broschur, S. 391–580 von insg. 581 Seiten.
Michel Onfray: Anti Freud
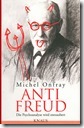 Ich habe mich sehr schwer getan, zu diesem Buch etwas zu schreiben, auch überlegt, ob ich es nicht einfach stillschweigend übergehen sollte, da es ein sehr schlechtes Buch ist und ich die Lektüre nach 150 Seiten eingestellt habe, weil kein neuer, geschweige denn ein origineller Gedanke mehr zu erwarten war. Ich selbst bin als Fachmann für Arno Schmidt auch ein halber, vielleicht auch nur ein drittel Fachmann für Freud geworden, weshalb mich die Auseinandersetzung mit ihm immer noch interessiert, während mir der Rest der psychoanalytischen Literatur inzwischen weitgehend gleichgültig ist.
Ich habe mich sehr schwer getan, zu diesem Buch etwas zu schreiben, auch überlegt, ob ich es nicht einfach stillschweigend übergehen sollte, da es ein sehr schlechtes Buch ist und ich die Lektüre nach 150 Seiten eingestellt habe, weil kein neuer, geschweige denn ein origineller Gedanke mehr zu erwarten war. Ich selbst bin als Fachmann für Arno Schmidt auch ein halber, vielleicht auch nur ein drittel Fachmann für Freud geworden, weshalb mich die Auseinandersetzung mit ihm immer noch interessiert, während mir der Rest der psychoanalytischen Literatur inzwischen weitgehend gleichgültig ist.
Um das Buch angemessen zu rezensieren, ist es leider notwendig, zuvor einige Sätze zu meiner eigenen Position in der Sache zu schreiben, damit man meine Kritik an Onfray nicht als ein Plädoyer für die Psychoanalyse missversteht. Die Psychoanalyse Sigmund Freuds ist eine der bedeutendsten Begründungen einer Weltanschauung (um nicht Religion zu schreiben) des 20. Jahrhunderts. Das in ihr implizit und explizit zum Ausdruck kommende Menschenbild hat einen nicht zu unterschätzenden weltweiten Einfluss auf die Kulturentwicklung gehabt, und niemand kann hoffen, die Entwicklung der westlichen Kultur in den letzten gut 100 Jahren zu verstehen, wenn er diesen Einfluss zu ignorieren versucht. In Freuds Denken fokussieren sich bedeutende geistige Strömungen des 19. Jahrhunderts: die Säkularisierung der Kultur, die Verbreitung atheistischen Denkens, der naive Glaube an die Erklärungsmächtigkeit rationaler Wissenschaft, das romantische Bewusstsein vom notwendig widersprüchlichen Charakter unseres Selbst und nicht zuletzt die Einsicht, dass es sich beim Bild vom Menschen als autarkem Herrn im eigenen Haus um eine weit verbreitete Selbsttäuschung handelt. Das Freudsche und in der Folge dann psychoanalytische Menschenbild im Allgemeinen hat das von Christentum und Humanismus geprägte der Neuzeit soweit gewandelt und aufgelöst, dass grundlegende Thesen der Psychoanalyse heute so weit zum selbstverständlichen und weitgehend popularisierten Grundbestand der westlichen Kultur gehören, dass sich selbst prinzipiell konkurrierende Glaubenssysteme (wie etwa das Christentum) dem anzupassen gezwungen sind.
Dies ist allerdings nicht der einzige Aspekt, unter dem die Psychoanalyse zu betrachten ist: Wie die meisten Weltanschauungen enthält auch die Psychoanalyse ein Heilsversprechen. In ihrem Fall ist dies erst sekundär ein gesellschaftliches oder soziales, primär ist es eines, das auf das Individuum zielt. Die Psychoanalyse versteht sich selbst in erster Linie als Therapie, und ihr wichtigstes Kriterium für die Richtigkeit des eigenen Menschen- und Weltbildes ist der therapeutische Erfolg. (Ob sich ein solcher nachweisen lässt oder nicht, ist eine so komplexe Frage, das sie hier nicht thematisiert werden kann.)
Dass es sich bei der Psychoanalyse nicht um eine Wissenschaft in dem Sinne handelt, wie sich dieser Begriff in den letzten beiden Jahrhunderten herausgemendelt hat, ist – auch entgegen den Ansprüchen einiger ihrer Adepten – offensichtlich und durch die Arbeiten von Wissenschaftstheoretikern wie Adolf Grünbaum hinreichend eindeutig nachgewiesen worden. Insbesondere die freie und freizügige Verwendung der logischen Negation, durch die in der psychoanalytischen Interpretation am Ende beinahe alles beinahe alles andere bedeuten kann, desavouiert die psychoanalytische Methode in den Augen empirischer Wissenschaftler. Im Gegensatz zu ihrem weit verbreiteten Selbstverständnis untersucht die Psychoanalyse nicht empirisch vorhandene Phänomene, sondern sie erzeugt wesentlich den Gegenstand ihrer Untersuchung im Vollzug dieser Untersuchung selbst. Sie ist daher – und bereits Sigmund Freud wusste dies sehr genau – eher eine historische als eine empirische Wissenschaft. Als Gegengewicht zu dieser sehr grundsätzlichen Kritik sollte man sich allerdings an die Einsicht des Aristoteles erinnern, dass von jeder Wissenschaft nur jener Grad von Genauigkeit erwartet werden sollte, den der behandelte Gegenstand tatsächlich hergibt (Nikomachische Ethik, 1094b).
Nach diesem ungewöhnlich langen Vorwort nun endlich zu Michel Onfrays Buch. Onfrays Kritik an Freud ist kein Versuch einer objektiven Einschätzung des wissenschaftlichen Anspruchs seiner Theorie oder ihrer Rolle in der Kultur des 20. Jahrhunderts. Vielmehr handelt es sich um eine Polemik, die versucht, Freuds Person zu verleumden und dadurch seine Theorie zu entwerten. Zu diesem Zweck wiederholt Onfray etwa alle fünf Seiten seine Behauptung, dass Freud seine Theorie zum einen hauptsächlich bei Nietzsche abgeschrieben habe, zum anderen aus seiner persönlichen psychischen Disposition abgeleitet und verallgemeinert habe. Diese Verallgemeinerung sei unzulässig, da Freud dadurch von ihm als universell ausgegebene psychische Gesetzmäßigkeiten von einem einzigen, noch dazu seinem eigenen Fall ableite.
Diese beiden Behauptungen werden von Onfray mit großer rhetorischen Beharrlichkeit immer erneut abgewandelt. Zwischen diesen Wiederholungen des ewig Selben beschuldigt Onfray in der Hauptsache Anna Freud, Ernest Jones und Peter Gay der systematischen Legendenbildung im Fall Freuds. Dies alles wird in einem Ton vorgebracht, als würden hier große Neuigkeiten verkündet, was wahrscheinlich nur diejenigen Leser Onfrays überzeugen wird, auf die das Buch zielt. Jeder dagegen, der sich auch nur oberflächlich mit der Literatur zu Freud beschäftigt hat, weiß, dass der Einfluss der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts und insbesondere Nietzsches auf Freud inzwischen breit dokumentiert und diskutiert wurde. Onfray rennt hier unter großem Gebrüll Türen ein, die bereits seit mehreren Jahrzehnten weit offen stehen.
Was die methodologische Kritik angeht, so bemerkt Onfray offenbar nicht (oder er will es nicht bemerken), dass seine Kritik gänzlich ins Leere geht: Zum einen hat Freud nie bestritten, dass er selbst und die Angehörigen seiner Familie bevorzugte Objekte seiner Studien waren, zum anderen ist es nicht verwunderlich, dass Freud allgemein gültige psychische Gesetzmäßigkeiten auch an sich selbst feststellen kann. Onfrays Argument folgt in etwa der Struktur, dass Newtons Gravitationsgesetz nicht gültig gewesen wäre, hätte Newton es bloß dadurch herausgefunden, dass er es an der Schwere seiner eigenen Person studiert hätte. Wollte Onfray tatsächlich nachweisen, dass hier ein Fehler vorliegt, so müsste er – wie dies andernorts durchaus fruchtbar praktiziert worden ist – zuerst auf empirischem oder logischem Weg nachweisen, dass die von Freud als allgemein gültig angesehen psychischen Gesetzmäßigkeiten diesem Anspruch nicht genügen, um dann Freuds Schluss von sich auf andere als Fehlschluss nachweisen zu können. Selbstverständlich macht sich der Philosoph Onfray die Mühe eines solchen Nachweises nicht, besonders auch weil dessen langwierige Erarbeitung und detaillierte Darstellung am Interesse seiner Zielgruppe gänzlich vorbeigehen würde.
Von der logischen Schwierigkeit, dass Onfrays Argument gegen Freud auf ihn selbst zurückschlägt und so seine Kritik Freuds als nichts anderes erscheinen muss als ein Ausfluss seiner – Onfrays – persönlichen psychischen Disposition, wollen wir hier ganz schweigen; ein beschämendes Bild mangelnder Reflexion für einen, der sich als Philosophen ausgibt. Bleibt nur noch festzuhalten, dass Onfray eine Diskussion des wichtigen Arguments, dass sich die Richtigkeit der psychoanalytischen Theorie letztlich nur an den Erfolgen bzw. Misserfolgen der therapeutischen Praxis entscheiden wird (eine Entscheidung, die noch lange nicht gefallen ist und wahrscheinlich auch erst fallen wird, wenn sie vollständig unerheblich geworden ist), in keiner einzigen Zeile auch nur versucht.
Insgesamt lässt sich das Buch völlig ausreichend beurteilen, wenn man einen Blick auf das Cover der deutschen Ausgabe wirft: Da hat ein frecher, kleiner Junge dem Papa Sigmund Hörner, eine Brille und eine herausgestreckte Zunge angemalt und eine Teufelsgabel in die Hand gedrückt. Man kann das witzig finden, aber es ist weder ein Argument gegen die Psychoanalyse, noch wird Freud auf diese Weise tatsächlich zum Teufel. Das Buch ist ein alberner und etwas kindischer Versuch Onfrays, mit einem seiner geistigen Väter abzurechnen – und es folgt damit so klassisch dem Freudschen Mythos vom Vatermord, dass es schon wieder lächerlich ist.
Michel Onfray: Anti Freud. Die Psychoanalyse wird entzaubert. Aus dem Französischen von Stephanie Singh. München: Knaus, 2011. Pappband, Lesebändchen, 540 Seiten. 24,99 €.
Ágota Kristóf: Irgendwo
Es war kaum noch zu ertragen.
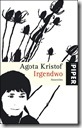 Dünnes Bändchen mit 25 Erzählungen. Es handelt sich um einen der typischen Sammelbände, die die Aufgabe haben, die Arbeiten eines Autors zusammenzufassen und für die Zukunft zu sichern, nicht um einen durchkomponierten Erzählband, die eine eigene Kunstform für sich bilden. Der Band trägt sie etwas seltsame Gattungsbezeichnung Nouvelles, was den nicht frankophonen deutschen Leser wohl dazu verführen soll, etwas Ähnliches wie Novellen zu erwarten, wenn er denn eine erkennen würde, wenn sie ihm begegnete. Tatsächlich wäre die Gattungsbezeichnung wohl eher mit Nachrichten zu übersetzen, was den Normalleser eher ein Sachbuch als eine Sammlung fiktionaler Texte erwarten ließe. Wie dem auch sei …
Dünnes Bändchen mit 25 Erzählungen. Es handelt sich um einen der typischen Sammelbände, die die Aufgabe haben, die Arbeiten eines Autors zusammenzufassen und für die Zukunft zu sichern, nicht um einen durchkomponierten Erzählband, die eine eigene Kunstform für sich bilden. Der Band trägt sie etwas seltsame Gattungsbezeichnung Nouvelles, was den nicht frankophonen deutschen Leser wohl dazu verführen soll, etwas Ähnliches wie Novellen zu erwarten, wenn er denn eine erkennen würde, wenn sie ihm begegnete. Tatsächlich wäre die Gattungsbezeichnung wohl eher mit Nachrichten zu übersetzen, was den Normalleser eher ein Sachbuch als eine Sammlung fiktionaler Texte erwarten ließe. Wie dem auch sei …
Aufgrund des Sammlungscharakters sind die präsentierten Erzählungen von recht unterschiedlicher Qualität. Da aber eine Dokumentation der Erstveröffentlichungen oder Entstehungszeiten ebenso fehlt wie ein Inhaltsverzeichnis, lässt sich das Material nur schwer einordnen und beurteilen. Es ist allerdings kein gutes Zeichen für das Vertrauen der Autorin in ihre Texte, dass die witzigste Geschichte gleich zu Anfang als Captatio benevolentiae zu finden ist. Bei den besten Geschichte handelt es sich um kurze Variationen über das zentrale Thema Kristófs: Der oder die wegen dieser oder jener Gründe von seiner Umwelt isolierte Einzelne. Aber es finden sich auch naive Aufrufe gegen den Krieg oder eine platte feministische Fabel auf den bürgerlichen Ehemann.
Wer die Geduld hat, die wenigen Perlen herauszulesen, wird Freude an dem kurzen Bändchen haben; die anderen sollten sich an die Romane Kristófs halten.
Ágota Kristóf: Irgendwo. Nouvelles. Aus dem Französischen von Carina von Enzenberg. Serie Piper 5196. München: Piper, 2008. Broschiert, 121 Seiten. 7– €.
Ágota Kristóf: Die Analphabetin
Ich lese. Das ist eine Krankheit.
 Kurze autobiographische Erzählung der ungarisch-schweizer Autorin, die am 27. Juli in Neuchâtel verstorben ist. Kristóf gehört zu einer kleinen Gruppe von Autoren des 20. Jahrhunderts, die mit ihrer Literatur ein Pendant zu dem geschaffen haben, was man in der Malerei als Naive Kunst bezeichnet: Sie erzählen in bewusst schlichter Sprache und Grammatik einfache, oft kurze, darum aber nicht minder kunstvolle Geschichten. Im Falle von Ágota Kristóf ist diese Erzählhaltung auch dadurch bedingt, dass sie nicht in ihrer Muttersprache, sondern in der – wie sie selbst es ohne kriegerische Konnotation nennt – »Feindessprache« Französisch schreibt. Ihre Bücher sind ein Musterbeispiel dafür, dass ein anspruchsloser Stil und eine schlichte Sprache eine gute Autorin nicht daran hindern, hervorragende Bücher zu schreiben.
Kurze autobiographische Erzählung der ungarisch-schweizer Autorin, die am 27. Juli in Neuchâtel verstorben ist. Kristóf gehört zu einer kleinen Gruppe von Autoren des 20. Jahrhunderts, die mit ihrer Literatur ein Pendant zu dem geschaffen haben, was man in der Malerei als Naive Kunst bezeichnet: Sie erzählen in bewusst schlichter Sprache und Grammatik einfache, oft kurze, darum aber nicht minder kunstvolle Geschichten. Im Falle von Ágota Kristóf ist diese Erzählhaltung auch dadurch bedingt, dass sie nicht in ihrer Muttersprache, sondern in der – wie sie selbst es ohne kriegerische Konnotation nennt – »Feindessprache« Französisch schreibt. Ihre Bücher sind ein Musterbeispiel dafür, dass ein anspruchsloser Stil und eine schlichte Sprache eine gute Autorin nicht daran hindern, hervorragende Bücher zu schreiben.
Obwohl ich ihren Erstlingsroman »Das große Heft« Anfang der 90er Jahre mit Begeisterung gelesen und auch die beiden Nachfolgebände in guter, wenn auch etwas vager Erinnerung habe, hatte ich danach nichts weiter von ihr zur Kenntnis genommen. Erst im vergangenen Jahr sind mir dann kurz hintereinander drei Bücher von ihr in die Hand gefallen, die ich nun, nach der Nachricht ihres Todes, wieder herausgesucht habe.
»Die Analphabetin« ist allerdings ein wenig enttäuschend. Das Buch macht den Eindruck einer Auftragsarbeit, die von der Autorin eher aus Pflichtgefühl denn mit Elan erledigt worden ist. Neben einer Beschreibung ihrer Kindheit in ärmlichen Verhältnissen und ihrer Zeit im Internat nimmt die Beschreibung der Zeit nach ihrer Flucht aus Ungarn 1956 in die Schweiz den meisten Raum ein. Trotz seiner Kürze ist das Buch nicht ohne Redundanzen. Insgesamt ist es entweder deutlich zu kurz oder deutlich zu lang geraten, der Eindruck eines gerundeten Ganzen stellt sich ebenso wenig ein wie der der sorgfältig ausgewogenen erzählerischen Knappheit, der etwa »Das große Heft« auszeichnet. Da es allerdings derzeit die einzige Quelle zum Leben der Autorin sein dürfte und die Lektüre in einem guten Stündchen zu erledigen ist, sind das lässliche Sünden.
Ágota Kristóf: Die Analphabetin. Autobiographische Erzählung. Aus dem Französischen von Andrea Spingler. Serie Piper 4902. München: Piper, 2007. Broschiert, 75 Seiten. 7,95 €.
Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus
Wirklich, die Gründerjahre waren wiedergekehrt, ihr Geschmack, ihre Komplexe, ihre Tabus.
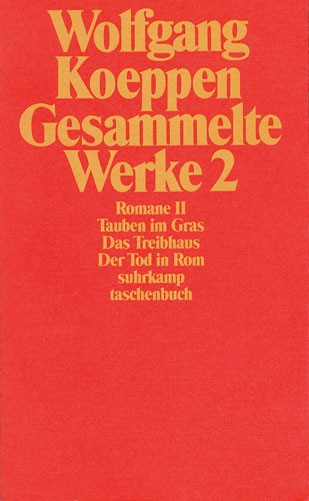
Liest man diesen zwei Jahre nach »Tauben im Gras« erschienenen zweiten Teil der Trilogie des Scheiterns unmittelbar im Anschluss, so fällt zuerst die weit traditionellere Erzählposition des Romans auf. Das liegt wohl vor allem daran, dass Koeppen in diesem Buch von einem einzigen Protagonisten erzählt und alle anderen Figuren deutlich als Randfiguren behandelt werden. Zwar finden sich auch hier immer wieder unvermittelt Übergänge zwischen Beschreibungen der Wirklichkeit und der Gedankenwelt der Figuren, die radikalen Perspektivwechsel aber, die »Tauben im Gras« prägen, treten hier nur vereinzelt auf.
Erzählt werden zwei Tage aus dem Leben des MdB Felix Keetenheuve im Jahr 1953. Keetenheuve gehört der SPD-Fraktion an, gilt seinen Kollegen aber aufgrund seiner Abneigung gegen den Fraktionszwang als unsicherer Kantonist. Dennoch wurde er dafür ausgewählt in einer Bundestagsdebatte zur Außenpolitik die Position der SPD zu vertreten. Keetenheuve, ein literarisch interessierter Intellektueller, flüchtete während der Jahre des Nationalsozialismus ins Ausland, nach Kanada und anschließend nach England, und hat von dort aus über den Rundfunk gegen die Nazis opponiert. Er kehrte nach Kriegsende nach Deutschland zurück und geriet durch sein Engagement gegen Hunger und Elend in die Politik. Er ist radikaler Pazifist und Gegner der Wiederbewaffnung, weshalb er sich in der Debatte gegen die Ratifizierung des EVG-Vertrages aussprechen wird.
Persönlich durchläuft Keetenheuve eine schwere Krise: Seine deutlich jüngere Frau, Tochter eines NS-Gauleiters, ist gerade, wohl an den Folgen ihres Alkoholismus, gestorben und Keetenheuve macht sich schwere Vorwürfe, sie zugunsten seiner politischen Arbeit vernachlässigt zu haben. Folge dieser Schuldgefühle ist eine massive Identitätskrise, die sich im Roman in immer erneuten, schlagwortartigen Rollenzuordnungen niederschlägt. Keetenheuves Zweifel am Sinn seiner politischen Arbeit werden von Stunde zu Stunde radikaler und gipfeln schließlich während seiner Bundestagsrede in der Einsicht, dass all dies nur ein Schauspiel ist, das für eine desinteressierte Öffentlichkeit gespielt wird und in dem keiner der Akteure ihm überhaupt noch zuhört. Alles scheint ihm längst entschieden zu sein, er empfindet sich als isoliert und ohne jeglichen Einfluss. Am Abend des selben Tages beendet Keetenheuve wahrscheinlich sein Leben durch einen Sprung von der Beueler Brücke, die damals noch nicht Kennedybrücke hieß, in den Rhein:
Der Abgeordnete war gänzlich unnütz, er war sich selbst eine Last, und ein Sprung von dieser Brücke machte ihn frei.
Der Roman ist dicht gespickt sowohl mit zeitgeschichtlichen Details als auch mit literarischen Anspielungen. Er dürfte wegen seiner frühen und radikalen Kritik am bundesdeutschen politischen System, ja am Parlamentarismus überhaupt, der bis heute am meisten gelesene Teil der Trilogie sein.
Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus. In: Gesammelte Werke 2. Romane II. st 1774. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1990. Broschur, S. 221–390 von insg. 581 Seiten.
Eine wahre Wilde
In der Tat gingen die Herren von der Politik zur Moral über. Sie hörten zu, wie Duveyrier Einzelheiten über einen Prozeß anführte, in dem sein Verhalten große Beachtung gefunden hatte. Er sollte sogar zum Kammerpräsidenten und zum Offizier der Ehrenlegion ernannt werden. Es handelte sich um einen schon mehr als ein Jahr zurückliegenden Kindesmord. Die entmenschte Mutter, eine wahre Wilde, wie er sagte, sei zufällig eben die Schuhstepperin, seine ehemalige Mieterin, jenes blasse und trostlose große Mädchen, über dessen ungeheuren Bauch sich Herr Gourd einst entrüstete. Und noch dazu blöd! Denn ohne auch nur auf den Gedanken zu kommen, daß dieser Bauch sie verraten würde, habe sie sich daran gemacht, ihr Kind entzweizuschneiden, um es sodann in einer Hutschachtel zu verstauen. Natürlich habe sie den Geschworenen einen ganzen, lächerlichen Roman erzählt, von einem Verführer verlassen, Elend, Hunger, ein toller Anfall von Verzweiflung angesichts des Kleinen, das sie nicht ernähren könne: mit einem Wort das, was sie eben alle sagen. Aber es müsse ein Exempel statuiert werden. Duveyrier schätzte sich glücklich, daß er die Verhandlung mit jener packenden Klarheit zusammengefaßt habe, die zuweilen für den Spruch der Geschworenen bestimmend sei.
»Und Sie haben sie verurteilt?« fragte der Doktor.
»Zu fünf Jahren«, erwiderte der Gerichtsrat mit seiner neuen, gleichsam verschnupften und grabestiefen Stimme. »Es ist an der Zeit, dem Lotterleben, das Paris zu überschwemmen droht, einen Damm entgegenzustellen.«Émile Zola
Ein feines Haus
Zum Tod von Ágota Kristóf
In Berlin haben wir am Abend eine Lesung. Leute werden kommen, um mich zu sehen, um mich zu hören, um mir Fragen zu stellen. Über meine Bücher, über mein Leben, über meinen schriftstellerischen Werdegang. Hier die Antwort auf die Frage: Man wird Schriftsteller, indem man geduldig und hartnäckig schreibt, ohne je den Glauben an das, was man schreibt, zu verlieren.
Ágota Kristóf
Die Analphabetin
Fritz Mauthner: Der letzte Tod des Gautama Buddha
Mit einem besonderen Gruß an den Buchladen Zur Schwarzen Geiß.
Ich möchte schweigen, aber ich soll nicht schweigen und ich kann nicht schweigen.
 Fritz Mauthner (1849–1923) dürfte sich hart an der Grenze des kulturellen Gedächtnisses bewegen. Während meines Studiums waren seine »Beiträge zu einer Kritik der Sprache« noch viel besprochen, wenn auch wenig gelesen. Damals erschien auch noch einmal seine umfangreiche Geschichte des Atheismus im Abendland, und sein als Wörterbuch unbrauchbares, als Lektüre aber anregendes »Wörterbuch der Philosophie«, das er selbst als eine Fortsetzung der »Beiträge« verstand, war bei Diogenes als überdimensioniertes Taschenbuch lieferbar. Vom Dichter Fritz Mauthner wollte man aber schon damals nichts mehr wissen. Um so mehr überraschte es mich, dass mir jetzt eine Neuausgabe seiner Erzählung um den Tod Gautama Buddhas in die Hände fiel.
Fritz Mauthner (1849–1923) dürfte sich hart an der Grenze des kulturellen Gedächtnisses bewegen. Während meines Studiums waren seine »Beiträge zu einer Kritik der Sprache« noch viel besprochen, wenn auch wenig gelesen. Damals erschien auch noch einmal seine umfangreiche Geschichte des Atheismus im Abendland, und sein als Wörterbuch unbrauchbares, als Lektüre aber anregendes »Wörterbuch der Philosophie«, das er selbst als eine Fortsetzung der »Beiträge« verstand, war bei Diogenes als überdimensioniertes Taschenbuch lieferbar. Vom Dichter Fritz Mauthner wollte man aber schon damals nichts mehr wissen. Um so mehr überraschte es mich, dass mir jetzt eine Neuausgabe seiner Erzählung um den Tod Gautama Buddhas in die Hände fiel.
Der 1913 erstmals erschienene Text ist eine direkte Reaktion auf die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einsetzende Popularisierung buddhistischen Gedankengutes in Europa. Erzählt werden die letzten Tage Gautama Buddhas, stofflich weitgehend orientiert an den Legenden. Inhaltlich allerdings nimmt Mauthner, ähnlich wie es später auch Hermann Hesse in seinem »Siddhartha« tun wird, eine deutlich distanzierte Haltung zu der offenbar als zu pessimistisch empfundenen Lehre ein. Mauthner lässt seinen Buddha nicht nur die Abkehr von allem Weltlichen hin zu einer Bewunderung der Schönheit der Welt und des Lebens überwinden, er erfindet auch eine letzte Lehrpredigt Buddhas hinzu, die sogenannte Schmetterlings-Predigt, in der die bunten Flattermänner zum großen Paradigma einer lebensbejahenden Existenz ohne Wollen und Denken geraten.
Etwas spannender als diese religiöse Gymnastik gerät die Beschreibung der Jünger des Erleuchteten. Während sich Buddha um letzte Einsichten und die Überwindung des Sterbens bemüht, finden unter seinen Schülern die ersten Verteilungskämpfe um Macht und Einfluss in der zukünftigen buddhistischen Kirche statt. Hier findet sich Mauthners eigentliche Absage an den Buddhismus: Die Lehre Buddhas ist diskutabel, der kirchlich organisierte Buddhismus ist es nicht.
Ergänzt wird die Erzählung durch einige Seiten mit Anmerkungen, in denen Mauthner auf die Quellenlage und die moderne Rezeption des Buddhismus im Westen eingeht. Sprachlich dürfte die Erzählung, ebenso wie Hesses Pendant, heute als etwas schwülstig empfunden werden, ansonsten ist sie ein nettes, kleines Schmuckstück für alle, die sich ein wenig für Buddhismus oder Fritz Mauthner interessieren. Hervorzuheben wäre auch die typographische Gestaltung des Bandes, die das gängige Niveau deutlich überragt; wenn nur das Büchlein nicht so viele Druckfehler hätte.
Fritz Mauthner: Der letzte Tod des Gautama Buddha. Konstanz: Libelle, 2010. Pappband, 125 Seiten. 18,90 €.
(Geschrieben für die Reihe 100 Seiten beim Umblätterer, wo
eine leicht gekürzte Fassung dieses Textes erschienen ist.)
Émile Zola: Ein feines Haus
»Mein Gott, Mademoiselle, ob die Bruchbude oder eine andere, sie sind sich alle gleich. Wer heutzutage die eine kennengelernt hat, der kennt auch die andere. Alles Schweine und Konsorten.«
 Der zehnte Band der Rougon-Macquart, der im Original den Titel »Pot-Bouille« trägt, was in etwa mit »Gemüseeintopf« zu übersetzen wäre. Allerdings hätte der deutsche Titel bei weitem nicht den Reichtum an Konnotationen wie der Originaltitel, so dass bislang alle Übersetzungen eine Alternative gewählt haben. »Ein feines Haus« ist angesichts des Inhalts des Buches eine gute Wahl, besonders auch wegen seines ironischen Potenzials.
Der zehnte Band der Rougon-Macquart, der im Original den Titel »Pot-Bouille« trägt, was in etwa mit »Gemüseeintopf« zu übersetzen wäre. Allerdings hätte der deutsche Titel bei weitem nicht den Reichtum an Konnotationen wie der Originaltitel, so dass bislang alle Übersetzungen eine Alternative gewählt haben. »Ein feines Haus« ist angesichts des Inhalts des Buches eine gute Wahl, besonders auch wegen seines ironischen Potenzials.
Erzählt werden die Ereignisse der Jahre 1862 und 1863 in einem Pariser Mietshaus in der Rue de Choiseul. Erzählanlass ist das Eintreffen Octave Mourets, des ältesten Sohn des Ehepaars François und Marthe Mouret aus »Die Eroberung von Plassans«, der in Marseille eine Ausbildung zum Kaufmann durchlaufen hat und nun nach Paris kommt, um die Stadt zu erobern, wie er selbst sagt. In die Rue de Choiseul kommt er, da die dort lebende Frau Campardon, die Gattin eines Architekten, eine alte Bekannte aus Plassans ist. Doch Octave, der die Verbindung zur Familiengeschichte der Rougon-Macquart bildet, ist nur eine Figur eines ganzen Ensembels, von denen die meisten im Haus leben oder dort regelmäßig aus und ein gehen. Da sind der Hausbesitzer, der zusammen mit Tochter und Schwiegersohn wohnt, zwei weitere Söhne des Hausbesitzers, von denen einer bereits verheiratet ist, die Familie eines Angestellten, dessen Frau sich dringend darum sorgt, ihre beiden heiratsfähigen Töchter an den Mann zu bringen, was ihr wenigstes mit einer gelingt: Berthe heiratet Auguste, den anderen Sohn des Hausbesitzers und Eigentümer eines Stoffgeschäfts. Zu dieser Familie gehört auch Onkel Bachelard, ein reicher Kaufmann, von dem man sich die Mitgift für die Töchter erhofft. Weiter oben im Haus leben noch eine alleinstehende Frau, der der Mann entlaufen ist, und die ärmliche Familie eines kleinen Beamten. Unter dem Dach finden sich die Dienstboten-Quartiere, die eine wichtige Gegenwelt zu den bürgerlichen Haushalten bilden.
Es ist nicht wirklich wichtig, die Handlung dieses Romans in aller Breite nachzuerzählen: Octave hat mehrere Abenteuer, nicht alle von Erfolg gekrönt, aber er wird schließlich mit der frisch verheirateten Berthe in flagranti überrascht, was einen bedeutenden Anteil der Aufregungen des Buches ausmacht. Wesentlicher als die konkrete Handlung ist der beißende satirische Ton, den Zola bei der Beschreibung des Bürgertums anschlägt. Letzten Endes erweist sich unter diesen Menschen alles als Geschäft; sollte jemand tatsächlich einmal wahre Gefühle hegen, so wird er sehr rasch auf den Boden der ökonomischen Tatsachen zurückgeholt. Ehen sind Geschäftsabschlüsse, in denen es darum geht, dass der Bräutigam eine Mitgift zu erhalten sucht, die die Familie der Braut nach Möglichkeit nicht oder wenigstens nur teilweise auszahlt. Legt Mann sich eine Geliebte zu, so wird er entweder ausgenommen wie eine Weihnachtsgans oder hintergangen oder auch beides. Selbst da, wo sexuelle Verhältnisse nicht pekuniär motiviert sind, sind sie letzten Endes nichts anderes als Ausbeutung. Gefühle sind in dieser bürgerlichen Welt nur eine Schwäche, die einen selbst im besten Falle nur lächerlich erscheinen lassen. Gleichzeitig führen diese einander betrügenden, belügenden und ausnutzenden Bürger ständig die Maximen einer christlichen Moral und hohen Sittlichkeit im Munde.
Als Pendant beschreibt Zola die Sphäre der Dienstboten als eine von Schmutz, Gemeinheit, Promiskuität und Dummheit. Hier ereignen sich wie nebenbei echte Tragödien, so die Geschichte von der Schuhstepperin, die als alleinstehende Frau im Haus lebt und der, da sie schwanger wird, gekündigt wird. Wir erfahren später, dass sie ihr Kind umgebracht hat und dass der Hausbesitzer, der sie in ihrem hochschwangeren Zustand auf die Straße gesetzt hat, nun als Richter ihrem Kindsmords-Prozess vorsitzt. Einen Höhepunkt hat der Roman sicherlich in der Beschreibung der Niederkunft von Adèle, die allein und gänzlich unerfahren unter Qualen eine Tochter gebiert, die sie nach der Geburt aus Desinteresse und Erschöpfung sterben lässt und deren Leiche sie im Morgengrauen beseitigt. Einzig die im zweiten Stockwerk des Hauses lebende Familie eines Schriftstellers bleibt von Zolas Kritik verschont, weil sie mit den übringen Bewohnern des Hauses keinen Umgang hat und daher unbeschrieben bleibt.
»Ein feines Haus« ist ein furioses satirisches Meisterwerk, voll erzählerischer Bosheit und gnadenlos genauer Beobachtungen. Ganz nebenbei werden auch die liberalen bürgerlichen Intellektuellen – in der Person eines Doktors – und die christliche Kirche in die Kritik dieser bürgerlichen Welt mit einbezogen. Der Roman macht den Eindruck, als habe sich Zola mit »Nana« freigeschrieben und schwinge sich hier zu einer neuen Stufe seines literarischen Talents auf. Der Roman stellt auch insoweit eine Zäsur dar, als mit ihm die Mitte des Zyklus der Rougon-Macquart erreicht ist. Es ist nur passend, dass Zola gerade hier seine Überzeugung von einem Bürgetum, das dem Untergang geweiht ist, illustriert. Einer der besten Romane des Zyklus und sicherlich zu Unrecht weniger bekannt als »Nana« oder »Germinal«.
Übersichtsseite zur Rougon-Macquart
Émile Zola: Die Rougon-Macquart. Natur- und Sozialgeschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich. Hg. v. Rita Schober. Berlin: Rütten & Loening, 1952–1976. Digitale Bibliothek Bd. 128. Berlin: Directmedia Publ. GmbH, 2005. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 64 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000, XP oder Vista) oder MAC ab MacOS 10.3; 256 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk.