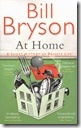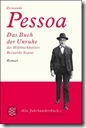»Große Glaubenskriege werden kommen«, sagte Philipp.
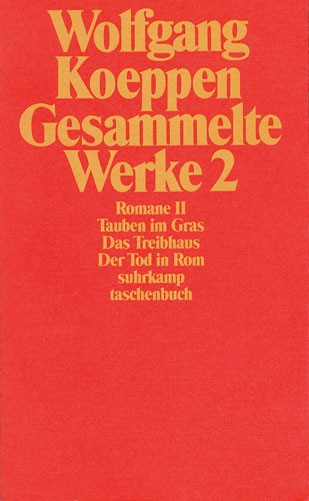
Mit diesem 1951 erschienenen ersten Teil seiner Trilogie des Scheiterns begründete Wolfgang Koeppen seinen anhaltenden Ruhm als einer der wichtigsten Autoren der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Koeppen gelang es mit diesem Roman, sowohl an die erzählerische Tradition der europäischen Moderne anzuknüpfen und deren Techniken souverän einzusetzen, als auch die gesellschaftliche und ökonomische Realität Deutschlands in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg prägnant und detailgenau einzufangen.
Erzählt werden Vorgänge und Ereignisse eines einzigen Tages wahrscheinlich des Jahres 1951 in einer großen süddeutschen Stadt, deren Vorbild offensichtlich München war. Koeppens Erzählung folgt etwa einem Dutzend Haupt- und zahlreichen Nebenfiguren, wobei es sich zumeist um bürgerlich situierte Figuren handelt. Hervorstechend sind zwei Schriftsteller, Philipp (erfolglos und mit Schreibblockade) und Edwin (berühmt, aber voller Zweifel); Emilia, Philipps Freundin aus einer ehemals reichen und einflussreichen, nun aber heruntergekommenen Familie; die Frau eines erfolgreichen Schauspielers mit dem sprechenden Namen Messalina; deren bigottes Kindermädchen Emmi, das in seiner Einfalt versucht, die kleine Tochter Messalinas, Hillegunde, von der Erbsünde zu erretten; zwei schwarze US-amerikanische Soldaten, von denen einer merkwürdiger Weise den deutschen Namen Odysseus trägt und den ganzen Tag über zusammen mit dem Dienstmann Joseph die Stadt durchstreift, der andere eine schwangere weiße Freundin namens Clara hat, die erfolglos versucht, das Kind abtreiben zu lassen; Dr. Behude, ein frei praktizierender Psychologe, bei dem unter anderem auch Philipp in Behandlung ist; und nicht zuletzt eine Gruppe US-amerikanischer Lehrerinnen, die sich auf einer Bildungsreise befinden und für die alte europäische Kultur schwärmen, ohne recht zu begreifen, dass sie gerade in jeglichem Sinne in deren Trümmern stehen.
Zu diesen Figuren gehören jeweils eigene Erzählstränge, die einander im Laufe der Handlung kreuzen, überlappen, miteinander verwoben werden: So ist etwa Philipp an diesem Tag eigentlich unterwegs, um im Auftrag einer Zeitung den Dichter Edwin zu interviewen; er trifft ihn auch, wenn auch eher zufällig, wagt es dann aber nicht, ihn anzusprechen. Doch besucht er dann am Abend Edwins Vortrag, wo er auf zahlreiche der anderen Haupt- und Nebenfiguren trifft. Im Laufe des Tages lernt er Kay, eine der Lehrerinnen kennen, die zuvor in einem Juweliergeschäft bereits Emilia begegnet war, die dort versuchte, alten Familien-Schmuck zu verkaufen. Kay und Emilia wiederum treffen in einer Bar auf Messalina, die mittags Philipp im Hotel Edwins begegnet war, und die zusammen mit ihrem Mann ebenfalls abends den Vortrag von Edwin aufsucht.
Die Erzählung ist aufgeteilt in etwas mehr als hundert große Abschnitte, wobei nicht jeder Abschnitt ausschließlich einem einzigen Handlungsstrang gewidmet ist. Oft finden Wechsel zwischen den Handlungssträngen auch ohne weitere Kennzeichnung von einem Satz zum nächsten statt, wobei Koeppen allerdings die Schnittstellen zumeist deutlich motivisch markiert. Auch werden die meisten Übergänge entweder assoziativ oder durch die Wortwahl vermittelt. Offensichtliche Vorbilder für diese Art des Erzählens sind die Romane Döblins bzw. der »Ulysses« von James Joyce. Dabei überrascht den Leser weniger Koeppens Anknüpfen an diese Tradition, als vielmehr sein anscheinend müheloser Umgang mit deren Techniken. Koeppens zeigt mit diesem Text sein erstaunlich exaktes Gespür dafür, was unbedingt zu erzählen ist bzw. was weggelassen werden kann, wo die Übergänge zwischen den Erzählsträngen zu setzen sind und wie trotz diesem komplexen Erzählmuster Spannungsbögen erzeugt werden können. Es ist nicht so, dass wirklich alle Abschnitte das hohe erzählerische Niveau der ersten 100 oder 150 Seiten halten können, doch insgesamt entsteht aus den Einzelelementen ein gerundetes und überzeugendes Gesamtbild. Es ist angesichts dieses virtuosen Erzähltalents äußerst bedauerlich, dass Koeppen nach den drei Romanen Anfang der 50er Jahre keine weiteren mehr veröffentlicht hat.
Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras. In: Gesammelte Werke 2. Romane II. st 1774. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1990. Broschur, S. 7–219 von insg. 581 Seiten.
P.S.: Bei dieser Gelegenheit sei auf die kleine Erzählung »Nichts als eine schwarze Fahne« von Herbert Rosendorfer hingewiesen, in deren Zentrum Wolfgang Koeppen steht und die unter anderem die ebenso wahre wie wundervolle Anekdote nacherzählt, wie einmal Marcel Reich-Ranicki Koeppen um eine persönliche Widmung in eine Erstausgabe gebeten hat.