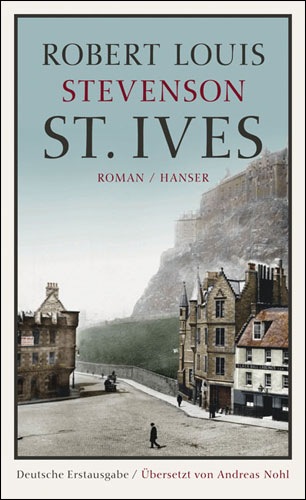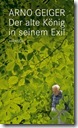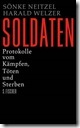 Sönke Neitzel hat im Jahr 2005 unter dem Titel »Abgehört« einen ersten Band mit Abhörprotokollen des britischen Militärgeheimdienstes veröffentlicht, die während des 2. Weltkrieges in der Hauptsache im Gefangenenlager Trent Park in der Nähe Londons erstellt worden waren. In Trent Park war eine handverlesene Gruppe höherer Offiziere interniert, von denen sich der Geheimdienst besonders ergiebige Erkenntnisse erwartete. Bei »Soldaten« handelt es sich um eine Erweiterung dieses ersten Bandes. Diesmal werden auch Abhörprotokolle von Mannschaftsdienstgraden ausgewertet. Im Vergleich zu »Abgehört« wurde die Gewichtung zwischen Dokumentation und Interpretation bei diesem neuen Band deutlich zu Ungunsten der Dokumentation verschoben. Die Zusammenarbeit mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer führt dazu, dass der Textanteil des deutenden Zugriffs in diesem Buch den der eigentlichen Protokolle deutlich überwiegt. Das Buch ist daher offensichtlich eher für den historischen Laien gedacht.
Sönke Neitzel hat im Jahr 2005 unter dem Titel »Abgehört« einen ersten Band mit Abhörprotokollen des britischen Militärgeheimdienstes veröffentlicht, die während des 2. Weltkrieges in der Hauptsache im Gefangenenlager Trent Park in der Nähe Londons erstellt worden waren. In Trent Park war eine handverlesene Gruppe höherer Offiziere interniert, von denen sich der Geheimdienst besonders ergiebige Erkenntnisse erwartete. Bei »Soldaten« handelt es sich um eine Erweiterung dieses ersten Bandes. Diesmal werden auch Abhörprotokolle von Mannschaftsdienstgraden ausgewertet. Im Vergleich zu »Abgehört« wurde die Gewichtung zwischen Dokumentation und Interpretation bei diesem neuen Band deutlich zu Ungunsten der Dokumentation verschoben. Die Zusammenarbeit mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer führt dazu, dass der Textanteil des deutenden Zugriffs in diesem Buch den der eigentlichen Protokolle deutlich überwiegt. Das Buch ist daher offensichtlich eher für den historischen Laien gedacht.
Das leitende Interesse der Autoren ist das Phänomen der Gewalt, wobei sie von der oft diskutierten Frage ausgehen, wieso Wehrmachtsangehörige während des Krieges Gewalt gegen Zivilisten ausgeübt haben und darüber hinaus aus auch an offenbar verbrecherischen Aktionen, selbst wenn sie diese Aktionen aus moralischen oder anderen Gründen innerlich abgelehnt haben. Dabei wird die Erklärung zurückgewiesen, dass durch das Kriegsgeschehen eine Verrohung der Soldaten eintritt, sondern Welzer vertritt die Auffassung, dass der militärische Bezugsrahmen bereits genügt, um ausreichende Bedingungen für Gewaltexzesse zu schaffen. Ausführlich wird dabei untersucht, wie und in welchem Umfang die Ideologie und der Rassebegriff des Nationalsozialismus Einfluss auf Selbstverständnis und Handeln der Soldaten hatten.
Die grundsätzlich vertretene These ist, dass Gewalt nicht als eine Ausnahmeerscheinung der menschlichen Existenz angesehen werden sollte:
Der Krieg und das Handeln der Arbeiter und Handwerker des Krieges sind banal, so banal, wie es das Verhalten von Menschen unter heteronomen Bedingen – also im Beteib, in einer Behörde, in der Schule oder in der Universität – immer ist. Gleichwohl entbindet diese Banalität die extremste Gewalt der Menschheitsgeschichte und hinterlässt mehr als 50 Millionen Tote und einen in vielerlei Hinsicht auf Jahrzehnte verwüsteten Kontinent. (S. 409)
Soldaten lösen ihre Aufgaben im Krieg mit Gewalt; das ist auch schon das Einzige, was ihr Tun systematisch von dem anderer Arbeiter, Angestellten und Beamten unterscheidet. Und sie Produzieren andere Ergebnisse als zivile Arbeitende: Tote und Zerstörung. (S. 439)
Wenn man aufhört, Gewalt als Abweichung zu definieren, lernt man mehr über unsere Gesellschaft und wie sie funktioniert, als wenn man ihre Illusionen über sich selbst weiter teilt. Wenn man also Gewalt in ihren unterschiedlichen Gestalten in das Inventar sozialer Handlungsmöglichkeiten menschlicher Überlebensgemeinschaften zurückordnet, sieht man, dass diese immer auch Vernichtungsgemeinschaften sind. Das Vertrauen der Moderne in ihre Gewaltferne ist illusionär. Menschen töten aus den verschiedensten Gründen. Soldaten töten, weil das ihre Aufgabe ist. (S. 445)
Ich kann mich dieser Sicht nur schwer entziehen, muss aber kritisch feststellen, dass das im Buch vorgeführte Material diese Grundauffassung zwar überzeugend illustriert, aber letztlich nicht beweist. Was das Autorenteam zwar immer mit reflektiert, letztlich aber nicht ernsthaft bei der Bewertung der Protokolle berücksichtigen kann, ist, dass diese Gespräche zwischen Soldaten in Gefangenschaft auch immer gruppendynamischen Zwängen unterliegen:
… gewiss ist er der Kommunikationssituation geschuldet, die eine Infragestellung des militärischen Wertekanons auch und vielleicht gerade in der Gefangenschaft nicht zuließ. (S. 357)
Oder:
… möglicherweise hat er aber auch schlicht gelogen, um seinen Gesprächspartner zu beeindrucken. (S. 362)
Dieser prinzipielle Zweifel ist natürlich nicht auszuräumen, doch wie schon Aristoteles betonte, darf man von jedem Urteil nur den Grad an Genauigkeit erwarten, den der vorliegende Gegenstand erlaubt.
Sönke Neitzel / Harald Welzer: Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Frankfurt: S. Fischer, 2011. Pappband, 520 Seiten. 22,95 €.