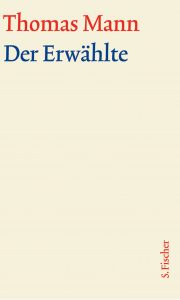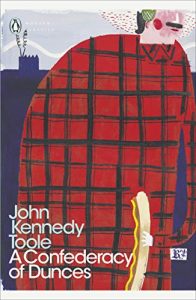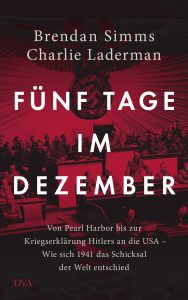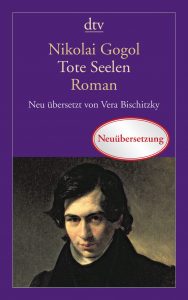Sehr oft ist das Erzählen nur ein Substitut für Genüsse, die wir selbst oder der Himmel uns versagen.
Im Jahr 1951 erschien nach einer für Thomas Mann recht kurzen Entstehungszeit von nur etwas mehr als drei Jahren sein kürzester und zugleich sein letzter abgeschlossener Roman Der Erwählte. Es handelte sich um eine modernisierte, sanft parodistische Nacherzählung des Gregorius des Hartmann von Aue, den Mann schon in seinem Münchner Studium kennengelernt hatte. Der Stoff hatte in der Fassung der Gesta Romanorum im Doktor Faustus eine kleine Rolle gespielt, was dann eine intensive Beschäftigung mit dem kleinen Epos Hartmanns auslöste. Dabei hatte Mann durchaus Schwierigkeiten, sich das mittelhochdeutsche Original anzueignen, konnte auch in den USA eine vage von ihm erinnerte Übersetzung im Reclam Verlag nicht finden, doch erhielt er Hilfe vom Schweizer Mediävisten Samuel Singer, der ihn schon bei der Arbeit am Doktor Faustus unterstützt hatte und der seine Mitarbeiterin Marga Bauer den Text Hartmanns ins Hochdeutsche übertragen ließ. (Dankenswerterweise liefert der Kommentarband dieser Ausgabe die Übersetzung vollständig mit!) Auf dieser Grundlage entstand ab Anfang 1948 der kleine Roman.
Den Inhalt habe ich schon an anderer Stelle kurz skizziert. Der legendenhafte Stoff und die Freiheit, die ein weitgehend unbestimmt und ironisch geschildertes Mittelalter dem Autor ließ, sowie die Engführung der Parodie an der Vorlage haben Thomas Mann eine erzählerische Leichtigkeit erlaubt, wie sie in seinem Werk sonst nur in einigen seiner Erzählungen zu finden ist. Der Roman ist scheinbar mit leichter Hand wie nebenbei erzählt und weist die für Mann typische tonale Einheitlichkeit des Erzählens in einem besonderen Maße auf. Es liegt wahrscheinlich an dem etwas entlegenen Sujet, dass dieses Buch zu den eher unbekannten Thomas Manns gehört.
Die Neuedition innerhalb der Großen Frankfurter Ausgabe bringt im Textteil keine echten Verbesserungen, da die letzten Korrekturfassungen des Romans komplett verloren gegangen sind; es wird deshalb der im März 1951 innerhalb der Stockholmer Werkausgabe erschienene Text nachgedruckt. Dafür glänzt aber auch dieser Teil der aktuellen Werkausgabe mit einem umfangreichen Kommentarband, der neben einem Einzelstellenkommentar nicht nur Entstehungsgeschichte und Rezeption minutiös dokumentiert, sondern, wie oben schon angedeutet, unter anderem auch die beide wichtigen Quellentexte reproduziert, die Mann benutzt hat. Für alle Freunde des Romans eine reiche biographische und stoffliche Fundgrube.
Thomas Mann: Der Erwählte. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe Bd. 11. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2021 (erschienen 2022!). Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 302 (Text) + 559 (Kommentar) Seiten. 139,– €. Beide Bände sind auch einzeln lieferbar.