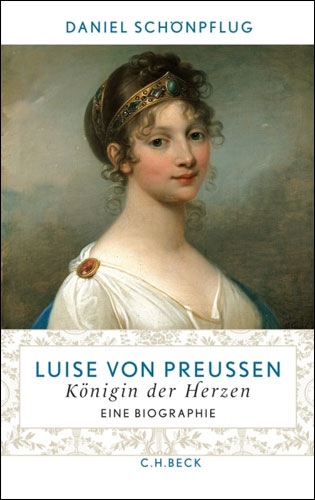Zur Herbstmesse wird als Abschluss der IV. Werkgruppe der Bargfelder Ausgabe der Werke Arno Schmidts die gesetzte Neuausgabe von »Zettel’s Traum« erscheinen. Ich habe mir vorgenommen, das Buch in dieser Neuausgabe zum dritten und wohl letzten Mal zu lesen. Ich werde diese Lektüre mit einem Blog begleiten, das seit vorgestern online ist. Einige einleitende Gedanken und Vorabmeldungen sind dort bereits zu finden. Die Seite wird bis zum Herbst langsam wachsen; es lohnt sich also vielleicht, dort von Zeit zu Zeit vorbeizuschauen.
Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte 6
 Der abschließende Band von Herbert Rosendorfers groß angelegter Deutscher Geschichte. Rosendorfer ist inzwischen 76 Jahre alt, und es ist verständlich, dass er sich weitere Bände nicht mehr zumuten möchte, insbesondere weil die Erzählung, je näher sie an die Gegenwart heranrückt, immer detaillierter und die Recherche dafür immer aufwendiger werden muss. Schon diesem letzten Band merkt man an, dass der Autor sich passagenweise zu sehr auf sein Gedächtnis verlässt, was zu dem einen oder anderen vermeidbaren Fehler führt. Besonders in der einleitenden Übersicht über die Literatur der Jahre zwischen 1750 und 1806 finden sich zahlreiche grobe Patzer: Lenz trug den Vornamen Jakob, nicht Konrad; bei Klingers »Faust« handelt es sich um einen Roman, nicht um ein Theaterstück; Klingers Drama »Sturm und Drang« wurde auf Vorschlag von Christoph Kaufmann so benannt, nicht »von einem Theaterdirektor«; und das Zitat von Lichtenberg lautet richtig:
Der abschließende Band von Herbert Rosendorfers groß angelegter Deutscher Geschichte. Rosendorfer ist inzwischen 76 Jahre alt, und es ist verständlich, dass er sich weitere Bände nicht mehr zumuten möchte, insbesondere weil die Erzählung, je näher sie an die Gegenwart heranrückt, immer detaillierter und die Recherche dafür immer aufwendiger werden muss. Schon diesem letzten Band merkt man an, dass der Autor sich passagenweise zu sehr auf sein Gedächtnis verlässt, was zu dem einen oder anderen vermeidbaren Fehler führt. Besonders in der einleitenden Übersicht über die Literatur der Jahre zwischen 1750 und 1806 finden sich zahlreiche grobe Patzer: Lenz trug den Vornamen Jakob, nicht Konrad; bei Klingers »Faust« handelt es sich um einen Roman, nicht um ein Theaterstück; Klingers Drama »Sturm und Drang« wurde auf Vorschlag von Christoph Kaufmann so benannt, nicht »von einem Theaterdirektor«; und das Zitat von Lichtenberg lautet richtig:
Er las immer Agamemnon statt »angenommen«, so sehr hatte er den Homer gelesen.
Und nicht, wie Rosendorfer schreibt: »Er las versehentlich immer Agamemnon statt Angenommen, so gebildet war er.« All das findet sich auf nur einer Seite, und der Autor hätte es nachschlagen oder dem Lektor auffallen müssen. Ganz zu schweigen von dem Trauerspiel der Darstellung der deutschen Philosophie der Zeit, der fraglos peinlichsten und dümmsten Passage der Deutschen Geschichte, wenn nicht in Rosendorfers Gesamtwerk überhaupt. Der Leser, der sich sein Bild ungeschmälert erhalten will, sollte das erste Kapitel komplett überschlagen, und die Lektüre mit dem zweiten beginnen.
Die eigentlich historische Darstellung ist getragen von einer in den vorangegangenen Bänden seltenen Bewunderung für wenigsten einen der historischen Protagonisten, Friedrich II. Auch Maria Theresia und Katharina die Große bekommen ihr Teil Lob zugeteilt, aber Rosendorfers Held der Zeit ist eindeutig Friedrich. Rosendorfers Haltung zu Napoleon, der naturgemäß im letzten Drittel des Buches eine bedeutende Rolle spielt, kann als durchaus neutral bezeichnet werden, auch wenn die Erzählung mit der Gründung des Rheinbundes und der Aufhebung des Deutschen Reichs endet. Sicherlich wünschte man sich hier eine ausführlichere Weiterführung der Erzählungen bis zu den Folgen des Wiener Kongresses, aber angesichts der Tatsache, dass es sich bei diesem Band ohnehin schon um den umfangreichsten der Reihe handelt, kann man die Beschränkung verstehen.
Es ist zu bedauern, dass die Serie mit diesem Band endet, denn trotz der hier und früher erhobenen Einwände handelt es sich bei Rosendorfers Deutscher Geschichte um ein Projekt, das in Umfang und Stil in der deutschen Literatur seinesgleichen sucht. Selbstverständlich ist diese Deutsche Geschichte in keinem Sinne vollständig und kann nicht für sich stehen, aber sie bietet dem historischen Laien einen wirklich originellen und spannenden Einstieg und Überblick.
Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte. Ein Versuch. Friedrich der Große, Maria Theresia und das Ende des Alten Reichs. München: Nymphenburger, 2010. Pappband, 383 Seiten. 22,95 €.
Aus meinem Poesiealbum (III)
Wenn einer uns damit ennuyieret, er habe das Rad neu erfunden, so kann man mit Fug erwarten, dass das Ding rund sei.
Franz Meermann
Daniel Schönpflug: Luise von Preußen
Populäre, oberflächlich bleibende Biografie Luises von Preußen als »Königin der Herzen«, wie sie der Untertitel bezeichnet. Der Ausdruck wurde übrigens von August Wilhelm Schlegel in einem Gedicht anlässlich der Berliner Huldigungsfeier für Friedrich III. geprägt. Die Biografie dokumentiert umfangreich die Kleidung der Prinzessin und späteren Königin, auch erfährt man viel über die Inneneinrichtung der von ihr bewohnten Schlösser. Darüber hinaus ist zu lesen, dass Ende des 18. Jahrhunderts »außerhalb der Stadt [Berlin] ländliche Gegenden« lagen (S. 95) und »im Inneren der Stadtmauern […] etwa 170 000 Menschen« lebten (S. 96). Ähnlich überraschend dürfte sein, dass Friedrich Wilhelm II. »eine enge Beziehung mit seiner langjährigen Mätresse« (S. 91) hatte. Überhaupt die Sexualität im 18. Jahrhundert:
Was sich hinter den geschlossenen Türen vollzog, darüber schweigen sich die Quellen aus. Angesichts des Fehlens einer sexuellen Erziehung muss man sich, auch wenn die Prinzen eventuell Erfahrungen mit Mätressen haben konnten, wohl eher ungelenke Versuche vorstellen. Doch erst durch den «Vollzug» galt die Eheschließung als unauflöslich. Abgesehen davon musste sich so bald wie möglich Nachwuchs einstellen, denn das war ja der Hauptzweck der Heirat. Lassen wir also Luise und Friedrich Wilhelm in diesem Moment allein. Ob ihre Hochzeitsnacht schüchtern oder stürmisch, innig oder kühl, albern oder ehrfürchtig war, das kann kein Historiker wissen. Denn auch wenn die Urtriebe des Menschen bleiben, die Masken des Begehrens ändern sich mit den Jahrhunderten. Tatsache ist allerdings, dass kaum zehn Monate nach der Hochzeitsnacht das erste Kind des Kronprinzenpaares zur Welt kam. [S. 85]
Oh goldene Zeiten, in denen sich die Quellen noch ausschwiegen! Und noch andere intime Tätigkeiten gab es:
Auch wenn aufwändige Staatsakte unweigerlich zum Königsein gehörten, war das eigentliche Regieren eine zurückgezogene, ja nahezu geheime Tätigkeit. Selbst Luise dürfte ihren Schwiegervater wohl nie dabei beobachtet haben. Der König hatte keinen dauerhaften Arbeitsplatz, sondern er regierte immer in der Residenz, wo er sich gerade aufhielt. [S. 89]
Man denke: Obwohl der Schwiegerkönig immer in all den Residenzen herumregierte, durfte selbst Luise nie dabei zusehen! Potztausend! Möglicherweise hat sie auch sonst nicht bei allem dabei sein dürfen?
Es ist doch bedauerlich, dass ein Verlag wie C. H. Beck anlässlich des 200. Todestages der Luise von Preußen nichts besseres als diesen Schmonzes auf den Markt zu bringen versteht.
Daniel Schönpflug: Luise von Preußen. Königin der Herzen. München: C. H. Beck, 2010. Leinen, 286 Seiten mit gut 30 Abbildungen. 19,95 €.
Philip Roth: The Humbling
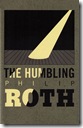 Erzählung vom alternden Schauspieler Simon Axler, der in eine tiefe persönliche Krise gerät, als ihm seine Fähigkeit der intuitiven Darstellung seiner Rollen abhanden kommt. Seine Ehefrau trennt sich von ihm, und Axler lässt sich in eine psychiatrische Klinik einweisen, da er sich für akut suizidgefährdet hält. Allerdings lehnt er alle konkreten Hilfsangebote ab: Weder versucht er, ernstlich von den Therapieangeboten der Klinik zu profitieren, noch geht er auf den Vorschlag seines Agenten ein, mit einem auf solche Krisen spezialisierten Schauspiellehrer zu arbeiten. Statt dessen zieht er sich von seinem Beruf und seinen Mitmenschen komplett zurück.
Erzählung vom alternden Schauspieler Simon Axler, der in eine tiefe persönliche Krise gerät, als ihm seine Fähigkeit der intuitiven Darstellung seiner Rollen abhanden kommt. Seine Ehefrau trennt sich von ihm, und Axler lässt sich in eine psychiatrische Klinik einweisen, da er sich für akut suizidgefährdet hält. Allerdings lehnt er alle konkreten Hilfsangebote ab: Weder versucht er, ernstlich von den Therapieangeboten der Klinik zu profitieren, noch geht er auf den Vorschlag seines Agenten ein, mit einem auf solche Krisen spezialisierten Schauspiellehrer zu arbeiten. Statt dessen zieht er sich von seinem Beruf und seinen Mitmenschen komplett zurück.
Nach mehreren Monaten Einsamkeit bekommt Axler Besuch von der Tochter zweier Schauspielkollegen, Pegeen Stapleford, 25 Jahre jünger als er und eigentlich lesbisch. Sie verführt Axler und beginnt mit ihm eine Affäre, in der es Axler großes Vergnügen bereitet, in Pegeen das zu wecken, was man gemeinhin wohl die feminine Seite nennt: Er kauft ihr Kleider, überredet sie zu einer neuen Frisur usw. Pegeens Eltern reagieren auf die Affäre besorgt: Sie warnen ihre Tochter davor, dass sie sich bald in einer Beziehung zu einem Siebzigjährigen wiederfinden wird, der sie mehr als Pflegerin denn als Partnerin nötig haben wird.
In die Brüche geht die Beziehung zwischen Pegeen und Simon wegen eines sexuellen Experiments unter Beteiligung einer weiteren Frau. Pegeen verlässt Simon nur wenig später Knall auf Fall, so wie sie es auch zuvor schon einmal in einer anderen Beziehung getan hat. In seine alte Krise und Einsamkeit zurückgeworfen, findet Axler aber noch einmal die Kraft, sich selbst mit einer Rolle zu überzeugen, der des Konstantin Gavrilowitsch Treplev aus Tschechows »Die Möwe«.
Die Erzählung ist besonders in der Gestaltung der Hauptfigur überzeugend. Axlers Verweigerung jeglichen Nachdenkens über seine Arbeit und sein Leben, seine Verweigerung gegenüber jeglicher Hilfe, sein ebenso unreflektierter Versuch, seine Krise durch eine Beziehung zu überwinden, die von Anfang an statt einer Entlastung nur noch mehr Schwierigkeiten zu bringen droht, werden konsequent dem einzigen möglichen Ende zugeführt. Die Erzählung kann gut als ein Seitenstück zu Roth’ Roman »Sabbaths Theater« gelesen werden.
Philip Roth: The Humbling. London: Jonathan Cape, 2009. Pappband, 143 Seiten. Ca. 15,– €.
Sibylle Berg: Der Mann schläft
 Mit ihren ersten beiden Büchern, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot (1997) und Sex II (1998, beide Reclam Leipzig), hatte Sibylle Berg bei mir großen Eindruck gemacht. Ich hatte mit ihrer Unverfrorenheit und ihrer klaren, schlanken und harten Prosa viel Spaß. Dann kam – vielleicht zu schnell – Amerika (1999) heraus, das ich fad und voller sprachlicher Klischees fand. Daraufhin habe ich erst einmal aufgehört, Sibylle Berg zu lesen. Nun tauchte sie im letzten Jahr bei Hanser wieder auf, und ich habe es wieder mit ihr versucht und bin nicht enttäuscht worden.
Mit ihren ersten beiden Büchern, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot (1997) und Sex II (1998, beide Reclam Leipzig), hatte Sibylle Berg bei mir großen Eindruck gemacht. Ich hatte mit ihrer Unverfrorenheit und ihrer klaren, schlanken und harten Prosa viel Spaß. Dann kam – vielleicht zu schnell – Amerika (1999) heraus, das ich fad und voller sprachlicher Klischees fand. Daraufhin habe ich erst einmal aufgehört, Sibylle Berg zu lesen. Nun tauchte sie im letzten Jahr bei Hanser wieder auf, und ich habe es wieder mit ihr versucht und bin nicht enttäuscht worden.
Sibylle Berg ist vielleicht die einzige wirklich misanthropische Autorin, die wir haben, sprich: die so erfolgreich ist, dass man von ihr weiß. Es mag andere misanthropische Autorinnen geben, aber wahrscheinlich fehlt ihnen die geschliffene Prosa Bergs und ihre – ja, was ist jetzt das genaue Gegenteil von Weinerlichkeit? Toughness?
Ihr jüngstes Buch erzählt die Geschichte einer Frau in den besten Jahren, die nach einem langen misanthropischen und einsamen Leben endlich ihren Mann findet. Die beiden leben etwa vier Jahre zusammen und unternehmen dann ihre zweite gemeinsame Urlaubsreise auf eine kleine, vor Hongkong liegende Insel. Dort verschwindet der Mann eines Tages. Die Frau bemüht sich 14 Tage lang erfolglos darum, ihn wiederzufinden, und verfällt anschließend in eine langsam sich steigernde Depression. Nach einiger Zeit wird sie von einem chinesischen Mädchen adoptiert und zu sich nach Hause eigeladen. Aber auch der dortige Familienanschluss hilft nicht; die Erzählerin verfällt als letztem Trost dem Alkohol. Am Ende bleibt es unklar, ob sie gerettet wird oder einem Wahnzustand verfällt. Die Fabel wird in alternierenden Kapiteln erzählt, die jeweils »Damals« und »Heute« überschrieben sind und deren Handlungsbögen sich auf den letzten Seiten vereinigen.
Entscheidend ist aber weniger die erzählte Geschichte, sondern die tief misanthropische Grundposition des Buches: Die Erzählerin verachtet die Menschen, ihre Anstrengungen, ihre Routinen, ihre Dummheit, ihre Lügen und – wahrscheinlich am schlimmsten – ihre Wahrheiten.
Dieses Theater, das um Sexualität gemacht wird, zu unerheblich, um sich davon beeinflussen zu lassen. Selbst die seltsamste Fetischanwandlung wollen wir heute begreifen und akzeptieren, wir wollen tolerant sein und offen und ersticken an unserem Hass gegen alles, was uns nicht ähnelt, und brüllen umso lauter das Lied der Gleichberechtigung.
Alles muss definiert sein, geregelt, geordnet; geheiratet muss werden, auch gleichgeschlechtlich, auch Familienmitglieder und Tiere, so entfernt von Anarchie und Ungehorsam wie jetzt schienen die Menschen noch nie, gerade weil sie so frei sind. Wenn sie nicht das Pech hatten, im Mittelalter geboren zu werden, also bei Fundamen-talisten, also im Patriarchat, versagen sie es sich, suchen nach Geländern zum Festhalten, haben Angst, sich zu verlieren, wenn sie die Regeln nicht befolgen, die sie selber aufgestellt haben. Alle müssen über ihre sexuellen Präferenzen reden, sie müssen sich mitteilen, unbedingt, und akzeptiert werden. [S. 167 f.]
Dabei ist die Erzählerin durchaus nicht selbstgerecht:
Meine Wut auf die Rasse, der ich angehörte, verschwand, denn ich hatte es kaum besser gemacht. Anstatt die Welt zu verändern, hatte ich mich auf die Unmöglichkeit dieser Aufgabe berufen und mich in Gemütlichkeit zurückgezogen, mit meinem kleinen Beruf, den kleinen Freunden, den kleinen Möbeln. Da konnte ich fein ruhig sein, und das war ich dann auch. [S. 175]
Wer die Bücher von Sibylle Berg noch nicht kennt, findet hier einen »netten« Einstieg – nur eben Humor sollte man mitbringen, sonst fällt einem das menschenfeindliche Gezeter leicht auf die Nerven.
Sibylle Berg: Der Mann schläft. München: Carl Hanser, 2009. Pappband, 309 Seiten. 19,90 €.
Roberto Bolaño: 2666
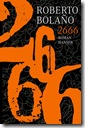 Ich habe aufgegeben. Ich habe tapfer bis etwa zur Mitte des Buches durchgehalten, bis in das vierte Kapitel hinein, das weitgehend mit der Aufzählung diverser Frauenmorde angefüllt ist. Dann habe ich noch kursorisch im letzten Kapitel herumgelesen und es dann aufgegeben. Ich habe nicht verstanden, warum ich das lesen soll; es hat mich aufrichtig nicht interessiert. Mag sein, ich habe da etwas nicht verstanden, mag auch sein, es gibt da nichts zu verstehen, sondern man soll all diesen Text hinnehmen, wie man auch das Leben hinnimmt. Nur dass das ein Irrtum wäre – ein Buch ist nicht das Leben, und es wäre auch überflüssig, wenn es das wäre. Und das Leben ist viel, viel witziger als dieses Buch.
Ich habe aufgegeben. Ich habe tapfer bis etwa zur Mitte des Buches durchgehalten, bis in das vierte Kapitel hinein, das weitgehend mit der Aufzählung diverser Frauenmorde angefüllt ist. Dann habe ich noch kursorisch im letzten Kapitel herumgelesen und es dann aufgegeben. Ich habe nicht verstanden, warum ich das lesen soll; es hat mich aufrichtig nicht interessiert. Mag sein, ich habe da etwas nicht verstanden, mag auch sein, es gibt da nichts zu verstehen, sondern man soll all diesen Text hinnehmen, wie man auch das Leben hinnimmt. Nur dass das ein Irrtum wäre – ein Buch ist nicht das Leben, und es wäre auch überflüssig, wenn es das wäre. Und das Leben ist viel, viel witziger als dieses Buch.
Das Buch zerfällt auf natürlichem Wege in fünf Teile. Teil 1 langweilt uns mit der Erzählung von vier Literaturwissenschaftlern – einer Frau und drei Männern –, dem harten, internationalen Kern der Archimboldi-Forschung. Benno von Archimboldi ist ein fiktiver deutscher Autor, dessen Biografie wir in Teil 5 zu lesen bekommen. Teil 2 erzählt aus dem Leben des Philosophieprofessors Amalfitano, dem drei der vier oben genannten Archimboldi-Forscher in der nordmexikanischen Stadt Santa Teresa begegnet sind. Amalfitano hängt ein Geometriebuch an einer Wäscheleine auf. Teil 3 stellt uns einen US-amerikanischen Journalisten vor, der einen verstorbenen Kollegen vertreten muss und in Santa Teresa von einem Boxkampf berichten soll. Er lernt dort unter anderem Rosa Amalfitano kennen, die Tochter des Professors. Teil 4 ist hauptsächlich angefüllt mit der unverbundenen Aufzählung zahlreicher Morde an Frauen in Santa Teresa, von denen immer wieder vermutet wird, sie würden miteinander zusammenhängen, obwohl dies augenscheinlich nicht der Fall ist – so wie die Teile des Romans. Teil 5 erzählt auf gut 300 Seiten das Leben von Hans Reiter, der sich als Schriftsteller Benno von Archimboldi nennt.
Das ganze ist in einer etwas umständlichen Sprache geschrieben, die hier und da zu Ausreißern neigt:
… als würde ein Schwall stinkender Luft in eine Damen-Bindenwerbung fahren …
Oder:
Der Abendhimmel erinnerte an eine fleischfressende Pflanze.
Glücklich, wer sich dabei etwas Konkretes vorstellen kann.
Das Buch soll in der spanischsprechenden Welt und den USA ein riesiger Erfolg gewesen sein, was ich nicht bezweifle. Was ich bezweifle oder nicht recht verstehe, ist, wer das Buch lesen soll, wem es Spaß macht, dieser mäandernden Erzählung über mehr als 1.000 Seiten zu folgen, ohne dass ein Ziel erkennbar wäre, eine Ordnung des Erzählten oder auch nur der Hauch eines Sinns. Wie schon gesagt: Wahrscheinlich habe ich das Buch nicht verstanden oder irgendwo irgendeine entscheidende Wendung verpasst. Ich jedenfalls habe aufgegeben.
Roberto Bolaño: 2666. Aus dem Spanischen von Christian Hansen. München: Carl Hanser, 2009. Bedruckter Pappband, Farbschnitt an drei Seiten (nur bei der ersten Auflage), Fadenheftung, Lesebändchen, 1096 Seiten. 29,90 €.
Aus meinem Poesiealbum (II)
Das entferntere Übel sieht immer kleiner aus als das gegenwärtige.
Sebastian Haffner
Geschichte eines Deutschen
Robert Menasse: Permanente Revolution der Begriffe
 Ein Bändchen mit acht Sonntagsreden Menasses, eine davon über Sonntagsreden. Diese Lektüre hat meine Auseinandersetzung mit Menasse beendet. An einer Stelle heißt es:
Ein Bändchen mit acht Sonntagsreden Menasses, eine davon über Sonntagsreden. Diese Lektüre hat meine Auseinandersetzung mit Menasse beendet. An einer Stelle heißt es:
Alle wirtschaftlichen Blütezeiten seit den bürgerlichen Revolutionen waren Zeiten, in denen die Politik, nicht zuletzt auch durch gesellschaftlichen Druck, stärker war als »die Wirtschaft«. Alles Elend und alle Menschheitskatastrophen aber geschahen in Zeiten, in denen »die Wirtschaft« der Politik ihre Interessen diktieren konnte.
Si tacuisses, …
Robert Menasse: Permanente Revolution der Begriffe. Edition Suhrkamp 2592. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2009. 124 Seiten. 9,– €.
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand
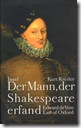 Worauf man sich wahrscheinlich mit den meisten ernsthaften Shakespeare-Lesern würde einigen können, ist, dass uns die Person des Stratforder Kaufmanns, der angeblich der Autor von Shakespeares Werken sein soll, nicht wirklich überzeugt. Andererseits werden die meisten im selben Atemzug einwenden, dass es um die anderen Kandidaten nicht so sehr viel besser bestellt ist.
Worauf man sich wahrscheinlich mit den meisten ernsthaften Shakespeare-Lesern würde einigen können, ist, dass uns die Person des Stratforder Kaufmanns, der angeblich der Autor von Shakespeares Werken sein soll, nicht wirklich überzeugt. Andererseits werden die meisten im selben Atemzug einwenden, dass es um die anderen Kandidaten nicht so sehr viel besser bestellt ist.
Allerdings wird seit etwa 90 Jahren ein möglicher Autor von Shakespeares Werken diskutiert, der alle Eigenschaften in sich vereint, die uns notwendig erscheinen, um das Genie Shakespeares zu erklären: Er ist Adeliger und Höfling, er hat eine breite höhere Bildung genossen, er hat Frankreich und – was wichtiger ist – Italien bereist, in seiner Bibliothek fanden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit all jene Bücher, die Shakespeare gelesen haben sollte etc. pp. Es handelt sich um Edward de Vere, den 17. Earl of Oxford, geboren 1550, gestorben 1604, Lebemann, Frauenheld, stets tief verschuldet, lange Zeit in London und am Hofe Elizabeth I. lebend und nachweislich Autor diverser Gedichte, die er unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte. Auch war er fraglos der Theaterwelt seiner Zeit verbunden – nur, ob er der Autor von Shakespeares Werken war, scheint fraglich.
Kurt Kreiler, der sich seit längerem darum bemüht, den Autor Edward de Vere dem deutschen Publikum nahe zu bringen, hat nun die erste umfangreiche deutschsprachige Biografie über ihn vorgelegt. Das Buch muss in zweierlei Hinsichten betrachtet werden: Zum einen als Biografie eines elisabethanischen Autors, zum anderen als Kampfschrift zur Shakespeare-Frage. Was die biografische Seite angeht, so ist Kreiler zu attestieren, dass er ein beeindruckender Kenner des Lebens und der Lebensumstände de Veres ist. Wie auch im Falle des Stratforder Shakespeares ist die Quellenlage gemessen an heutigen Vorstellungen eher dünn. So greift auch Kreiler zu dem üblichen Trick der Biografen, fehlende persönliche Details durch allgemeine Historie zu ersetzen. Dabei wird unvermeidlich vieles erzählt, was man eventuell bereits anderswo gelesen hat. Andererseits finden sich bei Kreiler auch immer wieder interessante Einzelheiten. Nur als Biografie betrachtet ist das Buch verdienstvoll und lesenswert.
Natürlich würden sich nur sehr wenige Leser für Edward de Vere interessieren, wenn nicht die These im Raum stünde, er habe Shakespeares Werke verfasst. Kreiler vertritt diese These geschickt, indem er deutlich macht, dass der Autor der »italienischen Stücke« seine Kenntnisse nicht aus einer auch noch so breiten Lektüre gewonnen haben kann, sondern höchstwahrscheinlich Italien bereist haben muss. Da sich eine solche Reise nicht in das Leben des Stratforder Kaufmanns hinein konstruieren lässt, erscheint er schlicht als unzureichende Persönlichkeit. De Vere dagegen hat die Vorzüge, die wir Shakespeare zuschreiben möchten: Er hat Italien selbst besucht, kennt die meisten Orte, an denen die Stücke spielen, aus eigener Anschauung, könnte all jene Kenntnisse, die Shakespeare nicht aus den Büchern seiner Zeit hätte extrahieren können, vor Ort in sich aufgenommen haben usw.
Das Bild ist verführerisch, nur ist es eben ein Bild und kein Beweis und sei es nur einer mittels Indizien. Denn leider ist die uns suggerierte Alternative zwischen einem Stratforder Stubenhocker einer- und einem weltmännischen Earl andererseits künstlich. Warum sollte ein Shakespeare allein auf Lektüre angewiesen sein, um die entsprechenden Kenntnisse zu erwerben? Was hinderte ihn daran, sich mit Italienreisenden, wenn nicht sogar mit Italienern selbst zu unterhalten? Das Problem der Shakespeare-Frage besteht nicht darin, den Unbekannten aus Stratford durch einen attraktiveren Autor zu ersetzen, sondern darin, dass wir über die Person Shakespeares und seine Arbeitsweise kaum konkretes, durch Quellen belegtes Wissen haben. Daher kann jeder das Bild malen, das zu seiner eigenen Theorie am besten passt.
So verweist Kreiler etwa auf das Stück The Jew, das bereits 1579 von Stephen Gosson erwähnt wird. Kreiler schreibt:
Gossons Beschreibung läßt aufhorchen: »Es handelt von der Gier derer, die Weltliches wählen, und von der blutdürstigen Gesinnung der Wucherer.« […]
Kein Zweifel: Gosson bezieht sich mit dem Wort »the greedinesse of wordly chusers« auf die Kästchen-Szene und mit »bloody minders of Usurers« auf die blutdürstige Gesinnung Shylocks in The merchant of Venice. [S. 214]
Kein Zweifel? Gleich im nächsten Absatz formuliert Kreiler selbst den ersten Zweifel, in dem er einräumt, es könne zu Shakespeares Der Kaufmann von Venedig ein Vorläufer-Stück gegeben haben, auf das sich Gosson bezieht und von dem das Shakespeare-Stück eine Bearbeitung darstellt. Das wäre zu Shakespeares Zeit kein ungewöhnliches Vorgehen und ist auch schon für andere Stücke unterstellt worden. Und geht es denn bei Shakespeare tatsächlich um das, was Gosson behauptet oder ist dessen Beschreibung nicht eher sehr oberflächlich? Und stammt diese Oberflächlichkeit daher, dass Gosson das Stück nur unvollständig verstanden hat oder gar nur vom Hörensagen her kannte, oder daran, dass es sich eben nicht um Shakespeares Stück handelt, sondern nur um eine uns nicht überlieferte Vorlage? Kein Zweifel? Ich wenigstens habe da noch erhebliche, ganz zu schweigen von Kreilers im Anschluss vorgenommener sogenannter Datierung von Shakespeares Stück, in der er ohne weiteres Portia mit Elizabeth I. gleichsetzt, um anschließend einfach Portias Freier mit denen Elizabeth’ zu identifizieren. Da wird der »neapolitanische Prinz« des Stücks als Don Juan d’Austria identifiziert, da der sich als Admiral in Neapel aufgehalten habe, was an sich schon fabelhaft genug wäre, was aber völlig unsinnig wird (und Kreiler weiß dies auch), wenn man sich Don Juan d’Austria als Bewerber um die Hand der Königin vorstellen soll. Derartige Holzwege der Spekulation sind leider typisch für alle Alternativtheorien und eben auch für Kreilers Buch.
Dass man mich richtig versteht: Edward de Vere ist eindeutig der beste Kandidat, der bislang als Autor für Shakespeares Stücke vorgeschlagen wurde. Er wäre eine sehr elegante und in vielen Einzelheiten passende Lösung der Shakespeare-Frage, so viel eleganter und passender als der Stratforder Kaufmann, dass das allein zu genügen scheint, die These stark zu machen. Nur ist das allein eben noch kein Beweis der Tatsache, sondern höchstens die Grundlage für eine Glaubensgemeinschaft.
Schauen wir uns noch kurz an, was gegen die de-Vere-These spricht und wie Kreiler damit umgeht: Was Kreiler selbstverständlich nicht lösen kann, ist die Frage, warum alle Zeitgenossen de Veres, die wussten, wer sich hinter dem Pseudonym Shakespeare versteckte, geschwiegen haben bzw. sich einzig in Anspielungen ergingen, die nur mit detektivischem Spürsinn zu enträtseln sind. Während man Freunden und Angehörigen de Veres noch als Motiv unterstellen kann, dass sie das für sie Offensichtliche aus Gründen der Standesehre verschwiegen haben, bestand für die Gegner und Feinde de Veres – und solche hatte er hinreichend – keinerlei Grund für eine solche Zurückhaltung. Aber selbst nach de Veres Tod findet sich keine einzige Quelle, die Shakespeare und de Vere eindeutig und klar miteinander identifiziert. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass alle derartigen Quellen verloren gegangen sind – was immer noch wahrscheinlicher ist als die Annahme, sie hätten niemals existiert –, aber glaubhaft ist das nicht. Hier ist der Punkt, wo die de-Vere-These an Verschwörungstheorien grenzt, was eher gegen als für sie spricht. Natürlich kann Kreiler diesen Eindruck nur abzuschwächen versuchen, aufheben kann er ihn nicht.
Das größere Problem stellt aber der Tod de Veres im Jahr 1604 dar. Da die akademische Shakespeare-Forschung ihren Autor noch mindestens acht, wenn nicht gar zehn Jahre nach diesem Datum aktiv sein lässt, muss Kreiler eine weitgehend veränderte Chronologie der Stücke entwickeln. Nach dem Motto »Wo gehobelt wird, fallen Späne« wird dabei einmal mehr Perikles, Fürst von Tyrus für unecht erklärt; Cymbeline und Das Wintermärchen werden aufgrund dünner Indizien deutlich vordatiert. Die eigentliche Crux stellt aber Der Sturm dar: Hier geht die Forschung davon aus, dass das Schiffsunglück zu Anfang des Stücks angeregt wurde von den Berichten über das Scheitern der Sea-Adventurer auf den Bermudas im Jahr 1609. Allgemein wird angenommen, der Autor des Stückes habe neben zwei Buchveröffentlichungen aus dem Jahr 1610 auch einen Brief gekannt, der 1610 geschrieben, aber erst 1625 abgedruckt wurde. Kreiler wendet ein, dass zum einen auch andere Quellen die entsprechende Vorlage geliefert haben könnten und dass zum anderen Der Sturm bereits 1605 in Eastward Ho! parodiert worden sei. Das alles geschieht auf einer halben Seite (vgl. S. 548).
Ein wenig mehr erwarte ich hier schon: Zumindest müsste man mir vorführen, was die früheren Deuter an Übereinstimmungen zwischen dem Stück und den Vorlagen (von denen Kreiler selbst nur eine erwähnt) gefunden haben bzw. nicht gefunden haben. Und auch die angebliche Parodie hätte ich gerne vorgeführt bekommen, anstatt mich mit der blanken Behauptung bescheiden zu müssen. Nicht, dass ich ohne Augenschein anderen Forschern von Haus aus mehr glauben würde als Kreiler; ihm glaube ich aber eben auch nicht.
Alles in allem ein interessantes und über Strecken informatives Buch, das die Vorteile der ohnehin starken Theorie der Autorenschaft de Veres an Shakespeares Werken deutlich herausarbeitet, aber aufgrund des unvermeidlich spekulativ bleibenden Ansatzes auch nicht über den Status einer Glaubensfrage hinausheben kann. Die Auseinandersetzung mit den Einwänden gegen die These bleibt insgesamt dünn, was den Verdacht erregt, Kreiler habe keine schlafenden Hunde wecken wollen. Meine Position zur Shakespeare-Frage wurde durch die Lektüre nicht verändert: Es wäre nett, wenn sich die Autorenschaft de Veres nachweisen ließe, doch bis auf weiteres sollten wir annehmen, dass die Werke Shakespeares weder von ihm noch von dem Stratforder Kaufmann geschrieben wurden, sondern von einem Mann, der ungefähr zur selben Zeit lebte und Shakespeare hieß, über den wir aber sonst gar nichts wissen.
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Edward de Vere, Earl of Oxford. Frankfurt/M.: Insel, 2009. Pappband, 595 Seiten. 29,80 €.