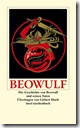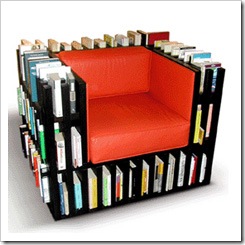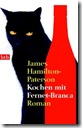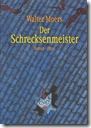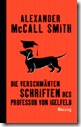Das Bändchen präsentiert so etwas wie eine Autobiographie Wodehouses, angeregt angeblich durch das Schreiben eines Journalisten, der Wodehouse im Jahr 1957 eine Reihe von Frage zugesandt habe, die der Befragte unerwartet ausführlich beantwortet. Eine wirkliche Autobiographie entsteht dabei natürlich nicht, wenn auch Wodehouse recht ausführlich über seine Anfänge als Autor plaudert. Aber Wodehouse ist zu verspielt und nimmt sich selbst nicht ernst genug, um tatsächlich eine Selberlebensbeschreibung zu liefern. Stattdessen wimmelt das Buch von Anekdoten, Witzen, Wortspielen. Selbst wenn konkrete Ereignisse im Leben des Autors geschildert werden, gerät alles rasch zur Posse:
Das Bändchen präsentiert so etwas wie eine Autobiographie Wodehouses, angeregt angeblich durch das Schreiben eines Journalisten, der Wodehouse im Jahr 1957 eine Reihe von Frage zugesandt habe, die der Befragte unerwartet ausführlich beantwortet. Eine wirkliche Autobiographie entsteht dabei natürlich nicht, wenn auch Wodehouse recht ausführlich über seine Anfänge als Autor plaudert. Aber Wodehouse ist zu verspielt und nimmt sich selbst nicht ernst genug, um tatsächlich eine Selberlebensbeschreibung zu liefern. Stattdessen wimmelt das Buch von Anekdoten, Witzen, Wortspielen. Selbst wenn konkrete Ereignisse im Leben des Autors geschildert werden, gerät alles rasch zur Posse:
Seinerzeit wurden Hollywood-Autoren in kleinen Käfigen gehalten. Diese beherbergten, in Reihen angeordnet, je einen Autor mit einem langfristigen Vertrag auf Wochenlohnbasis. Jedermann konnte sehen, wie ihre Gesichtchen bang durch die Gitterstäbe guckten, und hören, wie die Bedauernswerten winselnd darum baten, auf einen Spaziergang mitgenommen zu werden. Der Anblick ließ nur ganz Abgebrühte kalt.
Ich will nicht gerade behaupten, man habe die Autoren mißhandelt. In den besseren Studios war bei Einführung des Tonfilms Freundlichkeit die Regel. Oft blieb einer der Mogulen stehen und steckte einem der Betroffenen ein Salatblatt zu. Und das gleiche galt für die menschlicheren Regisseure, ja, zwischen Regisseur und Autor entwickelte sich oft eine schon fast rührende Freundschaft. Ich erinnere mich an eine Episode, die mir ein Regisseur einst erzählte und welche dies glänzend illustriert:
Eines Morgens war er unterwegs ins Büro – gedankenverloren wie immer, wenn er sich den Tagesablauf durch den Kopf gehen ließ –, als er plötzlich spürte, wie etwas an seinen Frackschößen zerrte. Er sah hinunter und erblickte seinen Lieblingsautor Edgar Montrose (»Autor des Monats«) Delamere. Das Bürschchen hielt ihn mit eisernem Griff fest und schaute mit Augen zu ihm hoch, in denen eine fast menschlich wirkende Warnung lag.
Auch Wodehouses Betrachtungen zum Boxen, Fernsehen, Landleben, seinen Arbeitsstil usw. usf. geraten rasch auf ähnliche Pfade.
Zur Qualität dieser Wodehouse-Ausgabe und der hervorragenden Übersetzungen von Thomas Schlachter ist an anderer Stelle schon das Nötigste gesagt worden. Auch dieses Bändchen ist für Wodehouse-Freunde ein Muss, für alle anderen Leser eine wärmste Empfehlung.
P.G. Wodehouse: Reiner Wein. Aus dem Englischen von Thomas Schlachter. Zürich: Edition Epoca, 2007. Pappband, Fadenheftung, 215 Seiten. 19,95 €.