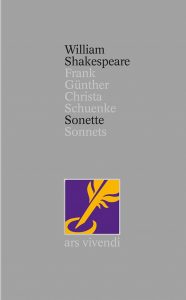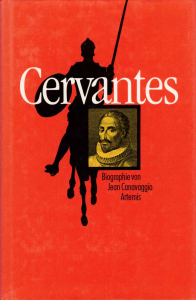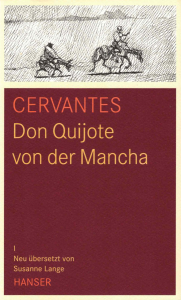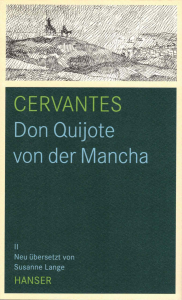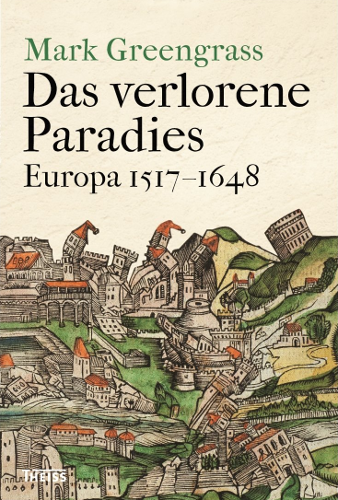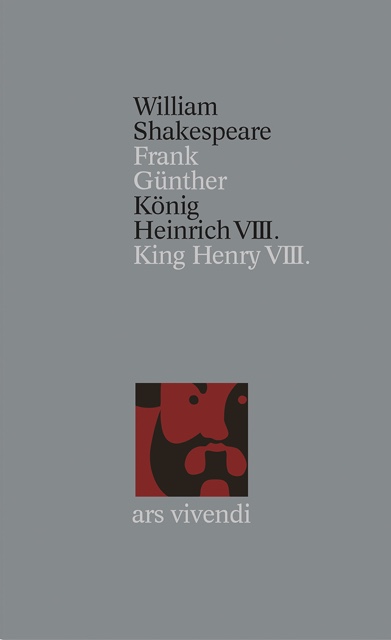Es gibt keinen Weg, der uns aus diesem trostlosen Labyrinth herausführt.
 Hanser legt einen der ersten nordamerikanischen Klassiker in einer neuen Übersetzung vor. Hawthornes romantische Erzählung war nicht nur beim Publikum ein kontrovers diskutierter Erfolg, sondern wurde auch von Schriftsteller-Kollegen gelobt. Für ein romantisches Schaustück war das Buch 1850 etwas spät erschienen; um den Text literarhistorisch richtig einzuordnen, muss man sich klar machen, dass nur sieben Jahre später Flauberts „Madame Bovary�“ erscheint.
Hanser legt einen der ersten nordamerikanischen Klassiker in einer neuen Übersetzung vor. Hawthornes romantische Erzählung war nicht nur beim Publikum ein kontrovers diskutierter Erfolg, sondern wurde auch von Schriftsteller-Kollegen gelobt. Für ein romantisches Schaustück war das Buch 1850 etwas spät erschienen; um den Text literarhistorisch richtig einzuordnen, muss man sich klar machen, dass nur sieben Jahre später Flauberts „Madame Bovary�“ erscheint.
Erzählt wird die Geschichte Hester Prynnes, die ursprünglich mit einem älteren Gelehrten in England verheiratet war und von diesem in die jungen Staaten Nordamerikas vorausgeschickt wurde. Nachdem ihr Ehemann als auf See verschollen gilt, lässt sich Hester auf eine außereheliche Beziehung ein, aus der eine Tochter hervorgeht. Die Erzählung setzt damit ein, dass Hester mit ihrer Neugeborenen an den Bostoner Pranger gestellt wird; sie weigert sich aber auch dort, den Vater ihres Kindes zu benennen. Wie der Zufall und die Forderungen der romantischen Dramatik es wollen, trifft an jenem Tag, als Hester als Sünderin öffentlich zur Schau gestellt wird, auch ihr tot geglaubter Ehemann in Boston ein. Die Eheleute erkennen einander, doch der Ehemann sagt sich von Hester los und verpflichtet sie, sein Inkognito – er nennt sich jetzt Roger Chillingworth – als Geheimnis zu bewahren.
In den kommenden Jahren lebt Hester, die zur Kennzeichnung ihres Status als Sünderin ein rotes A auf ihrem Kleid tragen muss, ein Leben am Rand der Bostoner Gesellschaft und beschäftigt sich in der Hauptsache mit Näharbeiten und dem Aufziehen ihrer Tochter Pearl, die als ein etwas wundersames, wildes und naturnahes Kind dargestellt wird. Roger Chillingworth dagegen praktiziert als Arzt und befreundet sich mit dem kränklichen Priester Arthur Dimmesdale, von dem er auf nicht näher erklärte Weise weiß, dass dieser der Vater Pearls ist. Chillingworth, der in der Zeit, in der er verschollen war, bei den Indianern die Geheimnisse der Naturmedizin erlernt hat, hegt einen verborgenen Hass auf Dimmesdale und verlängert und verschlimmert dessen Krankheit, während er vorgibt, ihn zu behandeln.
Erst nach sieben Jahren entschließt sich Hester, dieser Quälerei ein Ende zu machen, indem sie Dimmesdale die Identität Chillingsworth’ verrät. Dimmesdale und Hester entschließen sich daraufhin, Amerika gemeinsam zu verlassen und in Europa ein neues, gemeinsames Leben zu beginnen. Kurz vor der Abfahrt muss Hester allerdings erfahren, dass auch Chillingworth auf dem selben Schiff eine Passage gebucht hat, das Martyrium der beiden Liebenden sich also fortzusetzen droht. Doch am Tag vor der Abreise, am Tag der Gouverneurswahl, bekennt sich Dimmesdale vor der versammelten Bevölkerung Bostons zu seiner Vaterschaft und Sünde, bevor er in den Armen Hesters stirbt.
Man könnte nun meinen, dass diese Zusammenfassung der Fabel wesentliche Teile auslässt, aber ganz im Gegenteil ist es so, dass bis auf zwei, drei Episoden die Handlung des Buches damit vollständig beschrieben ist. Um aber die immerhin gut 320 Seiten zu füllen, scheint das etwas wenig zu sein, und so ist es auch. Hawthorne setzt zum einen eine mit der Erzählung nur sehr locker verbundene Einleitung von 60 Seiten vor die eigentliche Fabel, die aus der autobiographischen Skizze „Das Zollhaus“ besteht und Hawthornes Tätigkeit im Zollhaus von Salem und seine Entlassung aus diesem Dienst thematisiert. Nebenbei liefert diese Einleitung eine typisch romantische Herausgeberfiktion: Hawthorne behauptet, auf dem Dachboden des Zollhauses auf alte Notizen gestoßen zu sein, die die Geschichte Hesters erzählen und die Grundlage seines Buches liefern. Zum anderen kann man Hawthorne den Vorwurf der Geschwätzigkeit nicht ersparen. Dieser Eindruck verdichtet sich soweit, dass es als unfreiwillige Ironisierung des eigenen Stils erscheint, wenn er an einer Stelle einen seiner Ergüsse mit der Wendung „mit einem Wort“ zusammenzufassen sucht.
Wirklich genießen kann man das Buch wahrscheinlich nur in historischer Perspektive: Der romantische Ton, der das Buch prägt, ist offenbar eine bewusst gewählte Stilposition des Autors, wie besonders die vorgeschaltete Einleitung klar macht, in der die unverstellte Stimme des Autors zu hören ist. Das europäischen Mittelalters der romantische Ritterromane muss auf dem neuen Kontinent durch die frühe Neuzeit ersetzt werden, der aber ausreichend Züge des Dunklen Zeitalters beigegeben werden, um das romantische Bild zu vervollständigen. Ansonsten machen außer der schon erwähnten Geschwätzigkeit Hawthornes weitere manieristische Entscheidungen einen unmittelbares Genuss des Buches schwer: die Reduktion auf praktisch nur vier handelnde Figuren, die zudem kaum zum Handeln kommen, aber in jedem Moment exaltiert und unnatürlich erscheinen. Am schrecklichsten zeigt sich diese kontinuierlich überspannte Grundstimmung in der direkten Rede:
»Na, was ist das, Mutter?« rief sie. »Warum ließen die Leute ihre Arbeit heute liegen? Ist das ein Spieltag für die ganze Welt? Schau, dort ist der Hufschmied! Er hat sein rußiges Gesicht gewaschen und zieht sich Sabbatkleider an und sieht aus, als wäre er gerne fröhlich, wenn einer nur so nett wäre, es ihm beizubringen! Und da ist Herr Brackett, der alte Kerkermeister, der mir zunickt und mich anlächelt. Warum tut er das, Mutter?« (S. 283)
Auch Hawthorne wird bewusst gewesen sein, dass keine Siebenjährige im Lauf der Erdgeschichte jemals so geredet hat oder jemals so reden wird.
Was die neue Übersetzung angeht, so stellt man bereits durch einen ersten Vergleich mit dem Original fest, dass Übersetzer Jürgen Brôcat, der für seine Übersetzung von Walt Whitmans „Grasblätter“ 2009 sehr gelobt wurde, an grammatikalischen Strukturen kaum interessiert zu sein scheint. Er greift durchweg massiv in Wortstellung und Satzstruktur ein, ohne dass dabei ein Prinzip erkennbar wäre. Auch sonst fallen einige merkwürdige übersetzerische Entscheidungen auf: Hawthornes Gattungsbezeichnung für den Roman „A Romance“ (etwa „eine romantische Erzählung“) übersetzt Brôcan mit „Eine Phantasie“ (was vielleicht an E.T.A. Hoffmann erinnern soll, meiner unmaßgeblichen Meinung nach aber wenig passt); die Beschreibung Pearls als „elf-child“ wird bei ihm zu einen „Koboldkind“, was zu der nicht minder seltsamen Entscheidung führt, das später im Text tatsächlich vorkommende englische „imp“ (Kobold) mit „Wicht“ zu übersetzen, was im Deutschen doch sehr etwas anderes ist als der „Wichtel“, was das englische „elf“ durchaus auch bedeuten könnte. Als im Haus des Gouverneurs Pearls christliche Erziehung geprüft und sie dabei nach ihrem Schöpfer gefragt wird, antwortet sie, ihre Mutter habe sie von einem wilden Rosenbusch gepflückt, ein Einfall, den Hawthorne gleich im nächsten Satz mit der sehr merkwürdigen Wendung begründet, „Pearl stood outside of the window“, was im Kontext wohl bedeuten soll, Pearl stehe direkt neben dem Fenster; Brôcat entschließt sich dazu, das mit „da Pearl draußen vor dem Fenster stand“ zu übersetzen, was zwar semantisch richtig, ansonsten aber weitgehend sinnfrei erscheint. Und „a row of venerable figures, sitting in old-fashioned chairs, which were tipped on their hind legs back against the wall“ mit „eine Reihe ehrwürdiger Gestalten auf altmodischen Stühlen, die mit den Hinterbeinen gegen die Wand kippen“ zu übersetzen, kann nur als mittlerer Unfall bezeichnet werden. Dies und viele weitere Kleinigkeiten haben wenigstens mir das Vergnügen an der Übersetzung verdorben; hier wäre ein schlichterer Zugriff auf den ohnehin stilistisch exaltierten Text wahrscheinlich glücklicher gewesen.
Alles in allem eine sehr anspruchsvolle Lektüre, die vom Leser einiges an historischem Einfühlungsvermögen und stilistischer Toleranz verlangt. Davon, dass sich wohl nur den wenigstens deutschen Lesern der tatsächlich geschichtliche Gehalt des Textes, der wesentlich zu seinem Status als Klassiker beiträgt, erschließen wird, muss dabei ganz abgesehen werden.
Nathaniel Hawthorne: Der scharlachrote Buchstabe. Aus dem Englischen von Jürgen Brôcat. München: Hanser, 2014. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, bedrucktes Vorsatzpapier, 480 Seiten. 27,90 €.