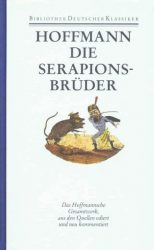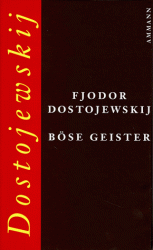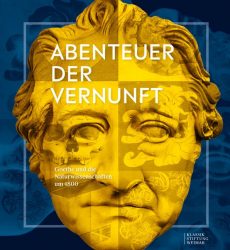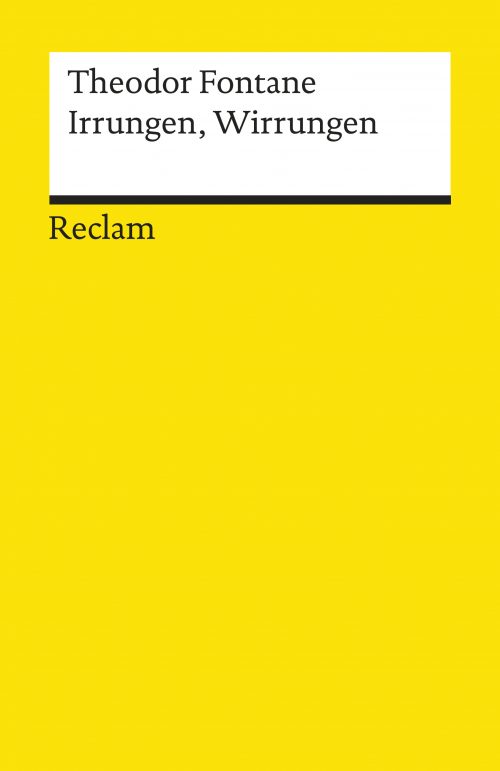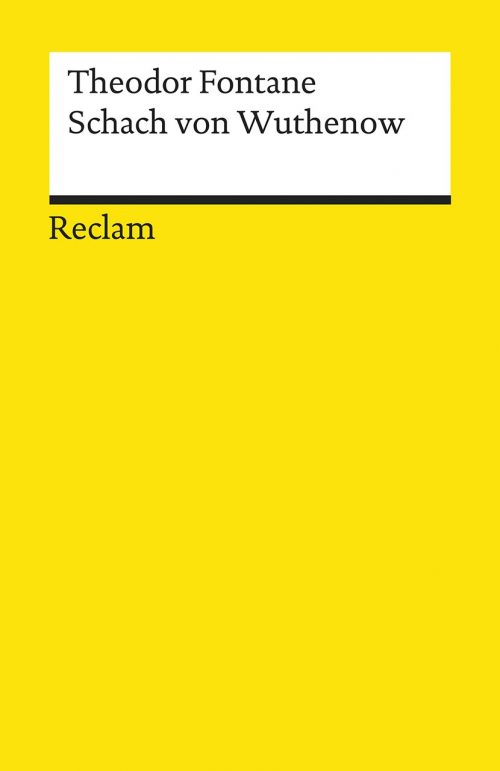Mann! es streitet gegen alle Ehrbahrkeit mit dem Teufel Knicker zu spielen.
Wiederaufnahme der Lektüre, die vor mehr als zwei Jahren unterbrochen wurde. Grundsätzliches zu Die Serapionsbrüder wurde bereits bei der Besprechung des ersten Bandes gesagt und soll hier nicht wiederholt werden.
Auch der zweite Band präsentiert zwei Abendunterhaltungen der literarischen Freunde Theodor, Cyprian, Ottmar und Lothar. Den Auftakt zum ersten Abend des zweiten Bandes (also des dritten Abschnittes des gesamten Werks) macht ein ausführliches Gespräch über den Mesmerismus, einer Modeerscheinung des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts, die – ähnlich wie die Homöopathie heute – auf unzureichender rationaler Grundlage zahlreiche Erfolge durch Placebo-Effekte verbuchen konnte. Das Thema wird von den Freunden kontrovers diskutiert, auch wird ein besonders eindrückliches Beispiel als geschickter Betrug entlarvt, doch kommen die Freunde am Ende zu keinem eindeutigen Urteil in der Sache.
Es folgen vier Erzählungen:
- Der Kampf der Sänger (Cy)*: Eine wirkungsmächtige Bearbeitung der Sage vom Sängerkrieg auf der Wartburg. Hoffmann verweist gleich zu Anfang auf seine hauptsächliche Quelle (Johann Christoph Wagenseils Geschichte der Stadt Nürnberg), behandelt den Stoff anschließend aber durchaus eigenständig und frei. Seine beiden Protagonisten sind Heinrich von Ofterdingen (Novalis’ Fragment war bereits 1802 im Druck erschienen) und Wolfram von Eschenbach (bei Hoffmann in der altertümelnden Schreibung Wolfframb von Eschinbach), die als wettstreitende Freunde nicht nur um den Preis des besten Sängers streiten, sondern auch um die Liebe der jung verwitweten Gräfin Mathilde. Heinrich versucht seine Chancen dadurch zu erhöhen, dass er – durch den Teufel dazu verführt – sein natürliches Talent durch die regelhafte Kunst des Meisters Klingsohr zu verbessern trachtet, was aber nur insofern gelingt, als dass die nun von ihm praktizierte Sangeslust zwar technisch überzeugen kann, die Gefühle des Zuhörer aber wenig bewegt. All das spitzt sich zu einem Wettbewerb zwischen Heinrich und Wolfram zu, der um den Preis des Lebens geführt wird. Ob und wenn, wie alles gut ausgeht, soll hier natürlich nicht verraten werden.
- Ein kurzes Intermezzo bildet dann [Eine Spukgeschichte] (Cy), die die beiden bisherigen Themen des Bandes sozusagen überbrückt: Auch in ihr wirkt die Geisterwelt auf überraschende Weise auf die reale Welt ein.
- Die Automate (Th): Eine weitere Variation des bereits im Sandmann so wirkungsvoll behandelten Themas der zu Hoffmanns Zeit so beliebten und viel diskutierten Vaucansonschen Automaten. Ausgangspunkt ist auch hier ein Fall, der unter dem starken Verdacht stehen muss, einen Betrug darzustellen, doch auch hier ist die Wirkung, die durch einen weissagenden, vorgeblich mechanischen Türken beim Publikum erzielt wird, rational kaum zu erklären. Die Erzählung bringt sich etwas um ihre Wirkung, da die in sie eingeflochtene Liebesgeschichte nicht zu Ende erzählt wird. Theodor versucht zwar, das Fragment als eine eigenständige Kunstform lobzupreisen, doch hilft das der Geschichte selbst nicht wirklich auf.
- Doge und Dogaresse (Ot): Eine in Venedig angesiedelte Erzählung über zwei junge Liebende, die seit der Kindheit getrennt und sehr unterschiedlichen Schicksalen unterworfen, einander am Ende doch finden, nur um dann vom Erzähler auf das Schmählichste enttäuscht zu werden. Die Liebesgeschichte hat zweifellos ihren Reiz, wird aber dadurch ironisiert, dass der Erzähler mit dem unwahrscheinlicher Weise doch zusammengeführten Liebespaar gar nichts anzufangen weiß. Man kann das Ende amüsiert zur Kenntnis nehmen, aber die meisten werden die rüde Art Hoffmanns doch Übel nehmen.
Der vierte Abschnitt beginnt ähnlich dem dritten mit einer theoretischen Diskussion der Freunde, zu denen nun noch Sylvester und Vinzenz als Teilnehmer hinzutreten. So beginnt dieser Abend mit einer theoretischen Abhandlung:
- [Alte und neue Kirchenmusik] (Th): Hoffmanns Überlegungen nehmen ihren Ausgang bei den Neuerungen, die in Beethovens Messe in C-Dur zutage treten. Von dort ausgehend werden in der Hauptsache die Kirchenmusik Palestrinas, Händels und Johann Sebastian Bachs lobend besprochen, während Zweifel daran formuliert werden, ob bei der schwindenden Frömmigkeit von Komponisten und Publikum die damaligen Leistungen aktuell noch wiederholt werden können.
- Meister Martin der Küfner und seine Gesellen (Sy): Die Erzählung nimmt, ebenso wie Doge und Dogaresse, ihren Ausgang bei einem – leider verlorenen – Gemälde Karl Wilhelm Kolbes, eines bekannten und preisgekrönten Malers der Zeit. Kern der Erzählung bildet das Werben dreier Gesellen um die Tochter des stolzen Nürnberger Küfner-Meisters Martin, der seine Rosa nur einem Küfner-Meister zur Frau geben will. Es arbeiten deshalb in seiner Werkstatt gleich drei Gesellen, die das Handwerk nur deshalb ausüben, weil sie sich in Rosa verliebt haben; zwei sind Künstler, einer ein verkappter Adeliger. Natürlich scheitern alle Bewerber an der Spannung zwischen dem niederen Handwerk und ihrer wahren Berufung, doch geht am Ende, wie sich das für eine ordentliche Liebeskomödie der Romantik gehört, alles gut aus.
- Den Beschluss des zweiten Bandes bildet ein Märchen, das ausdrücklich als kindgerechteres Pendant zu Nussknacker und Mausekönig, dem Abschlussstück des ersten Bandes vorgestellt wird: Das fremde Kind (Lo) erzählt ebenfalls die Abenteuer eines Geschwisterpaares, die mit dem Reich des Phantastischen – in diesem Fall mit märchenhaften Naturgeistern – in Berührung kommen. Die Erzählstruktur ist weitaus schlichter als im Nussknacker, die phantastischen Motive schlichter und die Verteilung von Gut und Böse klarer. Zwar wird auch dieses Märchen von den Zuhörern als nicht schlicht genug kritisiert, um ein echtes Kindermärchen zu sein, aber immerhin soll es als „Märchen für kleine und große Kinder“ durchgehen.
E. T. A. Hoffmann: Die Serapionsbrüder. Sämtliche Werke 4. Hg. v. Wulf Segebrecht. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag, 2001. Leinen, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 1679 Seiten. Diese Ausgabe ist derzeit nur als Taschenbuch lieferbar.
* – Titel in eckigen Klammern tauchen nicht im Original auf; die Kürzel in Klammern hinter den Titeln zeigen an, welcher der Serapionsbrüder die Erzählung vorträgt.