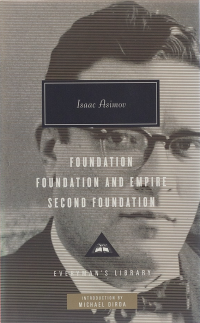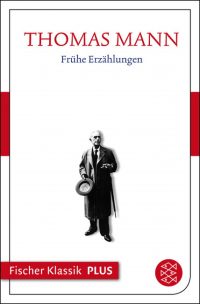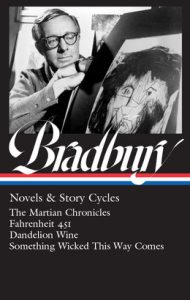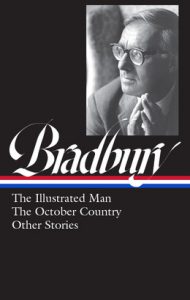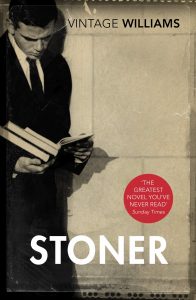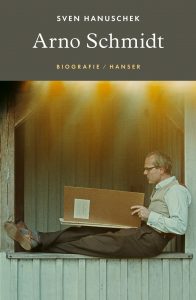„er habe […] aber nicht alles verstanden“1
ich verlange, gesetzgeberisch festzulegen, daß spätestens 50 Jahre nach dem Tode eines Schriftstellers seine Biografie nicht nur erscheinen darf, sondern muß !
BA III/4, S. 80
Solch einen Satz lassen sich Autor und Verlag natürlich nicht entgehen, wenn sie noch vor der geforderten Zeitspanne die erste umfangreiche Lebensbeschreibung gerade dieses Schriftstellers vorlegen können. Dass es dagegen nicht gelungen ist, diesen Satz fehlerfrei aus dem Original auf den Buchumschlag zu bringen,2 ist leider nicht nur eine Kleinigkeit, sondern ein Symptom.
Es dürfte unter jenen, die sich intensiver mit Arno Schmidt und seinem Werk beschäftigen, gleichgültig ob nur als Leserinnen3 oder auch als Forscherinnen, Einigkeit darüber bestanden haben, dass eine umfangreiche und detaillierte Biografie ein dringendes Erfordernis war. Jahrelang hatte man auf die Ankündigung Bernd Rauschenbachs hin auf ein sozusagen offizielles Lebensbild von Seiten der Stiftung gewartet; nachdem Rauschenbach sein Projekt schließlich auch öffentlich aufgegeben hatte, wurde hier und da die dadurch verlorene Zeit bedauert, aber nun liegt endlich ein Buch vor, das auf knapp 880 Seiten den Versuch unternimmt, Leben und Werk Arno Schmidts in einem einzigen großen Durchgang darzustellen.
Eine solche erste große Biografie wendet sich in der Hauptsache an gleich zwei Gruppen von Rezipientinnen, was seine Konzeption nicht eben einfacher macht. Da sind zum einen interessierte Leserinnen, die ihr Wissen um den Autor erweitern und Verständnis der Texte vertiefen möchten; zum anderen handelt es sich um aktuelle und zukünftige Forscherinnen, denen eine solche Biografie zur Grundlage der Forschung wird als eine Zusammenführung früherer Arbeiten und Erkenntnisse, die nun nicht mehr an zum Teil entlegenen Orten gesucht, sondern an einem zentralen Locus gefunden werden können.
Um dem Anspruch der ersten Gruppe zu genügen, ist es wichtig, aus den zum Teil disparaten Elementen der Lebensgeschichte eine wenigstens einigermaßen kohärente Erzählung zu entwickeln. Beim Verbiografieren von Schriftstellerinnen ergibt sich oft als Vorteil, dass diese in ihren Schriften schon eine Selbstdeutung vorgeben und ihr eigenes Leben und Denken mit mehr oder weniger Notwendigkeit ins Werk eingegangen ist und sie so ihren Leserinnen bereits ein Lebensbild mitgegeben haben, auf das die Biografie dann aufbauen kann. Nun ist es eine wichtige Maxime beim Verfassen von Biografien, zu diesen Selbstdeutungen der Autorinnen bewusst einen kritischen Abstand einzunehmen, um aus der Distanz heraus die Selbstdeutungen nicht nur hinterfragen, sondern auch in ein umfassenderes Bild der Zeit und der Zeitgenossen einordnen zu können. Darüber hinaus hat die Verfasserin einer Lebensbeschreibung mit den allgemeinen Zweifeln am Gelingen eines solches Vorhabens aufgrund der systematischen Beschränkungen des Genres zu kämpfen, steht sie doch unter dem Verdacht, sowohl aus psychischen als auch aus erzählerischen Gründen ihren Gegenstand notorisch zu verfälschen und zu beschönigen. Man ahnt die Schwierigkeit.
Doch solche eher allgemeinen Bedenken haben keinen wirklich tiefgreifenden Einfluss auf das Genre der Biografie genommen. Eher im Gegenteil werden ungebrochen Lebensbeschreibungen verfasst, die ein Bewusstsein der genrebedingten Schwierigkeiten zwar vor sich hertragen, sich aber im Vollzug von derartigen Zweifeln beim Vordringen in das Feld der Untersuchung nicht hemmen lassen. So auch wir.
Betrachten wir das Buch zuerst aus der Perspektive der Laienlektüre (der Ausdruck möge mir verziehen werden): Schmidt selbst hat seinen Leserinnen ein sowohl breites als auch vielfältiges Selbstbild in seinen Schriften hinterlassen, das einen nicht unwesentlichen Anteil der Faszination seiner Schriften ausmacht: Der autodidaktische, bibliophile Universalbelehrende, der sicheren Urteils die Bücherwelt durchpflügt, Gutes von Minderwertigem zu scheiden weiß, ein hohes aufklärerisches Pathos verkörpert, sowohl für den Fortschritt in der Literatur als auch für die Wertschätzung der Tradition steht, der letzte Vertreter der Französischen Revolution im Geiste Marats und der Erste an der Spitze der literarischen Avantgarde, der als „Topograph der horizontalen Höllenstürze […] nebenher stürzt, und aus seinen Adern mitstenographiert“ [BA Bfe. II, S. 8] und zugleich „ein Bild der Zeit“ [BA II/2, S. 63] hinterlässt, in dem sich die Zeit mit Scham wiedererkennen muss. All das erwächst aus einer unglücklichen Kindheit, aus dem erzwungenen Schweigen des Schriftstellers unter den Nationalsozialisten, im Widerstand gegen den Geschmack des breiten Publikums der Nachkriegszeit, die boshafte Verfolgung durch politisch Andersdenkende und die beständigen Störungen der Arbeit durch die, die glauben, es gut mit dem Autor zu meinen. Ein Einzelkämpfer gegen eine Welt von Plagen, wie er im Buche steht.
Selbst wenn hiervon der offensichtlichste pathetische Unfug abgezogen wird, bleibt immer noch das Bild einer erstaunlichen Persönlichkeit, die den Beruf des Schriftstellers auf sich genommen hat, weil er die beste Möglichkeit zu bieten schien, sich von der Gesellschaft der Mitmenschen weitgehend zurückzuziehen und in einer symbiotischen Partnerschaft mit einer Frau soweit es geht nur den Gesetzen gehorchen zu müssen, die sie selbst anerkannte oder sogar setzen konnte. Schmidt war ein Misanthrop, und er hat sich insoweit mit dieser Haltung durchgesetzt, als es ihm durch seine Berufswahl gelungen ist, Bedingungen zu schaffen, die eine weitgehende Isolation erlaubten. Dafür haben seine Frau und er für lange Jahre ein ärmliches und erbärmliches Leben auf sich genommen, im Dienst der Kunst, wie er behauptete, wohl eher aber, weil ihm ein Leben unter den „groben Leute[n]“ [BA I/1, S. 434] nicht möglich gewesen wäre.
Wie man hier leicht sieht, kann bei der Lebensbeschreibung Schmidts grundsätzlich eine von zwei Richtungen eingeschlagen werden: Es kann der Heldenerzählung gefolgt werden, die Schmidt als Selbstinszenierung in seinem Werk hinterlegt hat, oder es kann der Versuch unternommen werden, sich tatsächlich einmal den „defekten Rest“ [BA I/1, S. 395] anzuschauen, der übrig bleiben soll, falls der Künstler die Wahl trifft, „als Werk“ [BA I/1, S. 395] zu existieren.
Hanuschek ist im Wesentlichen der ersten Linie gefolgt und hat damit eine Biografie vorgelegt, die dem Bedürfnis der meisten Leserinnen Arno Schmidts entgegenkommen dürfte. Das bedeutet nicht, dass er blind wäre für den „defekten Rest“, nur ist er nirgends bereit, sich auch nur für einen Augenblick der Frage zu stellen, ob das Opfer, das Schmidt nicht nur sich, sondern auch seiner Frau abverlangt hat, tatsächlich eine notwendige Bedingung war für das Werk, das für all das über die Jahre und mit den Jahren immer mehr als Rechtfertigung herhalten muss. Die Heldenerzählung überstrahlt alles.
Dabei ist es Hanuschek als Verdienst anzurechnen, dass seine Darstellung die zentrale Rolle von Alice Schmidt bei der Herstellung dieser Lebensbedingungen herausarbeitet: Immer wieder ist es Alice, die die schwere soziale Behinderung ihres Mannes – seine Wut und Überheblichkeit, seinen Größenwahn – im Zaum und im Haus halten kann, die die zerstörerischen Tendenzen ihres Mannes abfängt, ihm zwar zugleich zustimmt, dass man ihn ungerecht und schlecht behandelt, aber dennoch einen Weg findet, mit Verlagen und Verlegern einen professionellen Umgang zu pflegen und so Schmidt zu ermöglichen, wenigstens zu Zeiten das Schneckenhausleben zu führen, das seinen Neurosen entspricht. Und bei aller Bewunderung für den Autor ist es für ihn nur zu verständlich, dass Alice in späteren Jahren gern so eine Art von Dichtergattin geworden wäre, ein wenig vom sich nun doch einstellenden Erfolg und Ruhm genossen hätte, anstatt auf einem Dorf in der Heide zu sitzen und langsam aber sicher von ihrem monomanischen Gatten als Letzte auch noch aus seinem Leben herausgedrängt zu werden. Den Absprung hat sie verpasst; aber das muss ihre Biografie thematisieren, nicht seine.
Am Ende ist es natürlich eine Frage des Geschmacks, aber ich hätte mir für eine erste Biografie Arno Schmidts ein wenig von dem kritischen Abstand gewünscht, den Hanuschek auf den wenigen Seiten (714–717) aufbringt, in denen er ein kurzes Porträt Hans Wollschlägers liefert. Anlass hätte es genug gegeben, so etwa xeno- und homophobische Äußerungen Schmidts, die zwar dokumentiert, nicht aber kommentiert werden. Es hätte dem Buch und auch den Leserinnen Schmidts gutgetan.
Kommen wir zum Forschungsaspekt des Buchs: Eine Arno-Schmidt-Forscherin stellt, wie schon gesagt, andere Ansprüche an eine Biografie. Für sie müssen neue Fakten und Interpretationen geliefert werden, es müssen offene und kontrovers diskutierte Fragen der Forschung entschieden oder wenigstens einer Klärung nähergebracht werden, es muss Relevantes von Obsoletem und Abstrusem geschieden werden.
Auch hier ist zuerst festzustellen, dass Hanuschek durchaus Neues bringt: Besonders was die Familiengeschichte Schmidts angeht, ist seine Darstellung detailreich und geht – soweit ich sehe – über die bisherige Forschung hinaus. Auch folgt er zwar weitgehend der Selberlebensbeschreibung Schmidts, formuliert aber immer wieder berechtigte Zweifel an den Selbstdeutungen des Autors. Wir bekommen etwa kein wirklich geschlossenes Bild von Schmidts Vater geliefert, aber wir bleiben auch nicht bei der extrem negativen Beurteilung durch den Sohn stehen. Hier liefert Hanuschek einen deutlichen Fortschritt.
Was die Einschätzung des Werks und seine Interpretation angeht, schwächelt das Buch auf weiten Strecken. Hanuschek scheint, bei aller Bewusstheit für die romantischen Wurzeln Schmidts, grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich bei Schmidt um einen realistischen Autor gehandelt habe. Hanuschek begreift darunter das Ziel, die sogenannte Wirklichkeit im Text abzubilden, hat aber an zahlreichen Stellen Schwierigkeiten mit diesem Textzugriff – er greift dann zum Terminus „Wirklichkeitskonstitution“ (S. 152, 402 u. ö.). So wird ihm etwa der Gärtner Auen in Brand’s Haide zu einem Problem:
Natürlich kann man sagen, alle diese ›phantastischen Stellen‹ seien so codiert, dass sie eine naturwissenschaftliche Lesart hergeben: Der gute ›Schmidt‹ [die Erzählerfigur von Brand’s Haide] spinnt, er hat zuviel Fouqué gelesen und sieht überall Elementargeister, die es nicht gibt, wie wir wissen. – Das wäre mir eine zu platte Auflösung; für mich stecken hier zwei Möglichkeiten. Zum einen: Brand’s Haide erzählt eine Schriftstellerwerdung, eine Initiationsgeschichte, die gerade durch die Mythologie- und Elementargeister-Schicht wieder geöffnet wird.
S.350
Das „zum anderen“ wird uns nicht geliefert! Die hier ausinterpretierte Spannung kennt der Text aber gar nicht. Zum einen (!) ist die Geisterexistenz dieser Figur mit voller Absicht im Text so versteckt, dass nur eine sehr exakte Lektüre sie überhaupt als wirklichkeitskonstituierendes Element an den Tag bringt, zum anderen (!) behauptet Schmidt zwar in seiner Poetologie, ein Realist zu sein, die Praxis seiner Texte weiß aber überhaupt nichts von einem solchen Dogma. Wenn sich etwas an Schmidts Texten begreifen lässt, dann dies, dass sie weitgehend autonom konstituiert sind und sich an keinerlei vorgegebene Konzepte, seien sie realistisch oder romantisch, halten. Schmidt ist nur insoweit ein Realist, als ihm Realien wichtig sind (warum das so ist, hätte Hanuschek diskutieren müssen, er nimmt es aber als selbstverständlich hin), aber er ist in keiner Weise durch sie verpflichtet oder beschränkt. Schmidt ist weder ein Epigone der Romantik (wovon das Frühwerk noch geprägt ist) noch ein Autor des Realismus. Künstlerisch souverän ist sein zu Lebzeiten veröffentlichtes Werk mit Sicherheit gerade darin, den scheinbaren Gegensatz von „Wirklichkeitskonstitution“ und Phantastik mit leichter Hand einzuebnen.
Neben diesem grundsätzlichen Missverständnis weist das Buch als Forschungsbeitrag zahlreiche Mängel auf, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden können. Pars pro toto sei die Entstehungszeit von Pharos genannt:
- Eine erste Datierung wird auf Seite 136 vorgenommen: „(ca. 1945)“.
- S. 174 wird es nach dem Achamoth-Fragment terminiert, das von Schmidt selbst in die Zeit nach Weihnachten 1944 gesetzt wurde.
- Die hauptsächliche Behandlung des Pharos findet dann zu Anfang des Abschnitts über den Zeitraum 1946–1948 (S. 215 ff.) statt.
- S. 225 wird der Zeitraum der Entstehung zwischen März 1942 und Januar 1944 verortet,
- was S. 226 noch einmal auf den Zeitraum zwischen November 1943 und Januar 1944 eingegrenzt wird.4
So etwas muss selbstverständlich vermieden werden, und es lässt sich auch durch Autor oder Lektorat problemlos vermeiden, wenn man denn sein eigenes Buch mit jener Gründlichkeit gelesen hätte, mit der man vorgibt, das Werk Arno Schmidts gelesen zu haben.
Es bleibt mir nur noch eine einzige Stelle zu zitieren, die mir die Lektüre dieses Buches letztendlich durch und durch verdorben hat. Auf S. 844 heißt es über Ann’Ev’ – deren Name im Buch übrigens gleich drei Mal falsch geschrieben wird –: „trotz ihrer Herzkrankheit ist sie offensichtlich nicht ganz von dieser Welt“. Wer so etwas schreiben kann, hat bei Schmidt etwas ganz Grundlegendes nicht verstanden. Ann’Ev’ ist nicht „trotz“ ihrer Herzkrankheit nicht ganz von dieser Welt, sondern weil sie immer auch von dieser Welt sein muss, ist sie herzkrank. Und wer dabei nicht an Line Hübner denken muss, der gehört, so leid es mir tut, auch unter die „groben Leute“.
Sven Hanuschek: Arno Schmidt. München: Hanser, 2022. Pappband, Lesebändchen, 990 Seiten. 45,– €.
geschrieben für den Bargfelder Boten
Nr. 479–480, S. 30–34
1 – Sven Hanuschek: Arno Schmidt. S. 124
2 – Die Fassung des Hanser-Verlags liest sich so: „Ich verlange, gesetzgeberisch festzulegen, daß spätestens 50 Jahre nach dem Tod eines Schriftstellers seine Biographie nicht nur erscheinen darf, sondern muß!“
3 – Dieser Text benutzt ausschließlich zum Zwecke der Provokation das sogenannte generische Femininum.
4 – Mit Dank an Günter Jürgensmeier, der auf diese kleine Bonanza auf Twitter hingewiesen hat: https://twitter.com/Arnotationen/status/1522094272350146562.