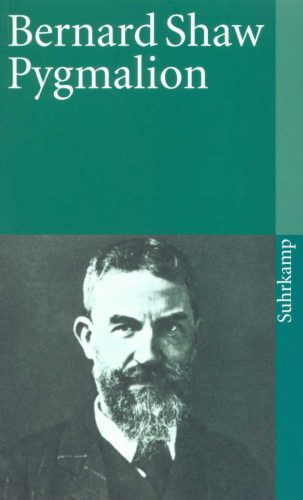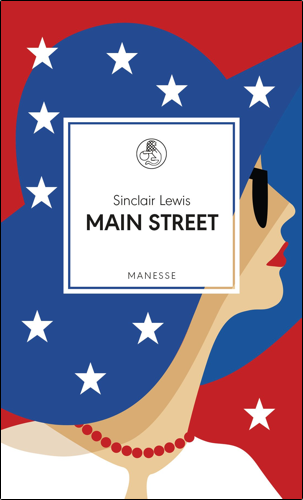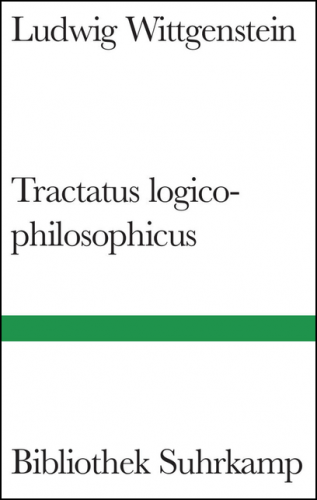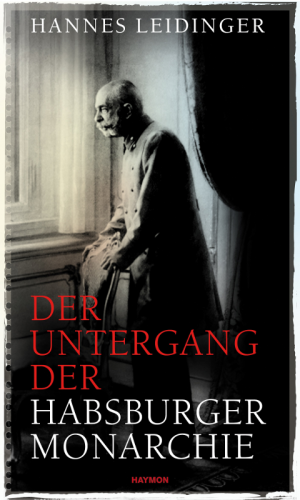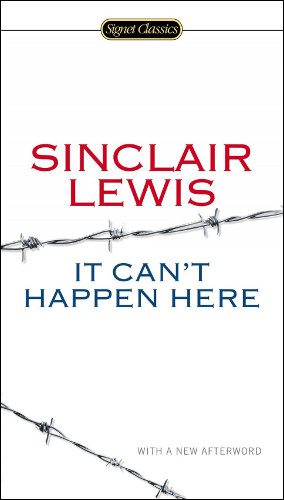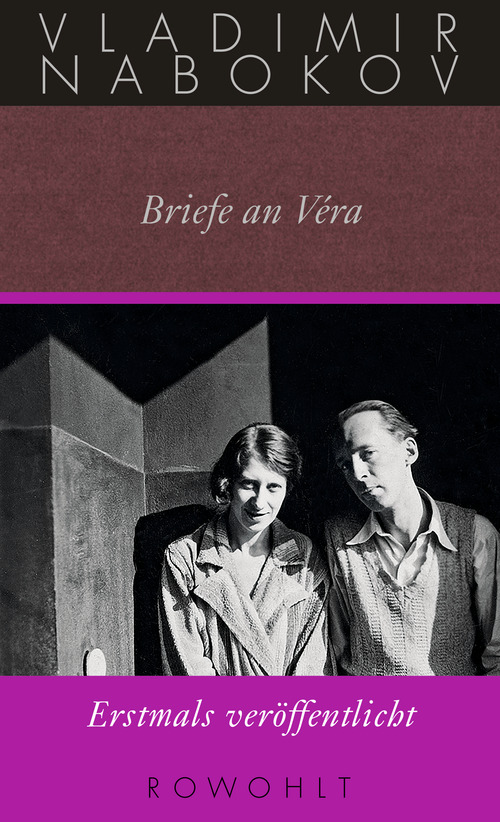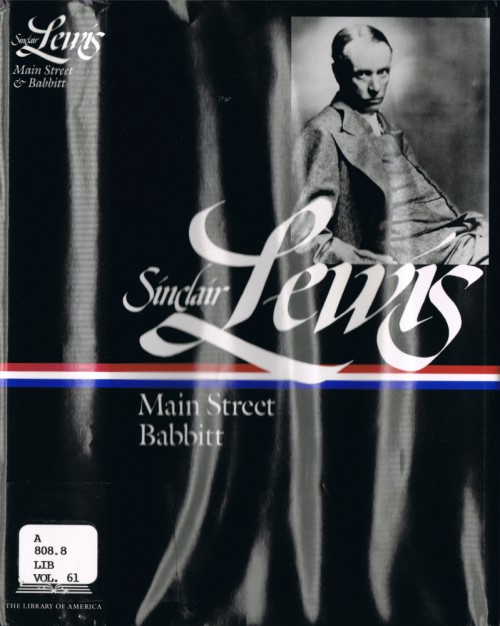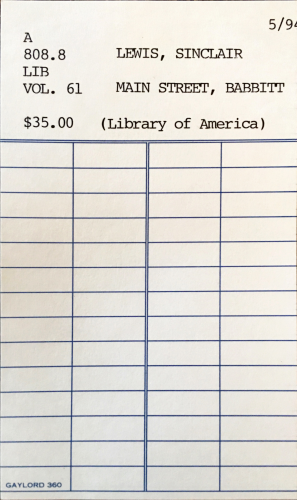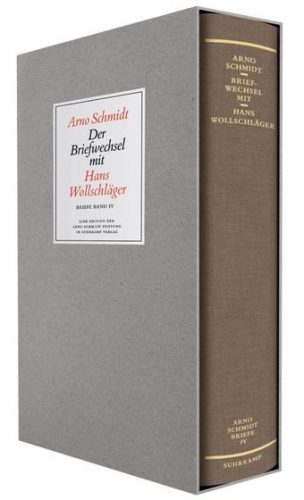 Am 15. Februar 1959 schreibt Arno Schmidt an Hans Wollschläger:
Am 15. Februar 1959 schreibt Arno Schmidt an Hans Wollschläger:
[…] wir ergo wollen uns, im Interesse einer begierig zuhorchenden Nachwelt, einer schlichten Genauigkeit in Namen, Orten und Daten (der Worte & Werke noch ganz zu geschweigen) befleissigen – das wird ohnehin mal ein schwermütiger Spaß werden, wenn unsere Correspondenz (wie es ja gar nicht ausbleiben kann) gedruckt erscheint, und die bewußten ›Edelmenschen‹ dann, bestürzt die Querhand vor der Stirn, ihr Porträt & das ihres Wirkens ratlos aus (dann wahrscheinlich schon ziemlich schadhaft gewordenen) ›Knopflöchern‹ bestarren.
Nun also ist es endlich soweit – die erste Ankündigung des Briefwechsels liegt gut 30 Jahre zurück –, und es gibt tatsächlich eine, wenn auch wahrscheinlich eher kleine Nachwelt, die begierig zuhorcht. Und es ist schwermütig genug geworden. Ob aber auch ein Spaß? Nunja.
Der erste Kontakt der beiden Schriftsteller findet im September 1957 statt, als Wollschläger mit einem Leserbrief auf einen Schmidt-Text über Karl May in der FAZ reagiert und der Redaktion eine Erwiderung zukommen lässt, die diese verständlicherweise nicht abdrucken möchte, sondern an Schmidt weiterleitet. Schmidt vermutet in Wollschläger sogleich einen Mitstreiter in der Sache, Karl Mays literarisches Renommee zu heben, und erkennt sehr rasch, dass Wollschläger nicht nur ein May-Kenner ersten Ranges ist, sondern ihm als Mitarbeiter des Karl-May-Verlages (damals unter Ustad-Verlag firmierend) auch einen erneuten, quasi unterirdischen Zugang zu dessen Archiv eröffnen könnte, nachdem es sich Schmidt durch seine undiplomatische Besserwisserei mit der Verlagsleitung bereits verdorben hatte.
Hans Wollschläger ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt (21 Jahre jünger als Schmidt), seiner Ausbildung und seinen Ambitionen nach Musiker, Fachmann für Gustav Mahler, dessen 10. Symphonie er zu rekonstruieren versucht, und verdient sich sein karges Brot als freier Mitarbeiter des Karl-May-Verlages. Schmidt und Wollschläger sind sich wenigstens darin einig, dass May ein unterschätzter Autor sei, wenn auch Schmidt im Wesentlichen nur vier Bücher des Spätwerks gelten lassen will, wohingegen Wollschläger wenigstens zu Anfang an eine breitere Auswahl schätzenswerter Werke zu denken scheint.
Und so ist denn der Großteil des Briefwechsels leider auch geworden: Das Thema Karl May ist durch das ganze Konvolut hindurch dominant. Es werden die Güte bzw. die Mängel verschiedener Ausgaben diskutiert, man weist einander auf antiquarische Angebote hin, Wollschläger schiebt Schmidt Materialien aus dem Verlagsarchiv zu, ist überhaupt eine Quelle für biographische Details, die er aus seiner Lektüre zahlloser Briefe Mays gewinnen konnte. Wen May interessiert, wird hier eine Bonanza von Material und Feinheiten finden; wer allerdings trotz Arno Schmidt und Hans Wollschläger hartnäckig bei der Auffassung verharrt, dass es sich bei May um einen hochgradigen Schwätzer und ausgemachten Hohlkopf handelt, wird sich über weite Strecken durch diesen Briefwechsel durcharbeiten müssen.
Denn eigentlich erfährt man nichts: Weder Schmidts Behauptung, beim Mayschen Alterswerk handele es sich um eine Auseinandersetzung mit Nietzsches Philosophie, wird in irgendeiner Weise reflektiert oder auch nur erläutert, noch wird der Schwenk Schmidts zu einer psychoanalytischen Lesart Mays methodisch oder inhaltlich diskutiert. Als Schmidt das erste Mal gegenüber Wollschläger andeutet, May könne homosexuell gewesen sein, lehnt dieser die Vermutung aus seiner biographischen Kenntnis heraus rundweg ab. Erst als Schmidt die Wendung findet, dass May seine homosexuellen Neigungen unbewusst verarbeitet habe, stimmt Wollschläger sofort und gänzlich unkritisch zu. Danach tritt er Schmidt hier wie auch überall sonst die Brücke.
Für Freunde oder Bewunderer Wollschlägers – inzwischen ist auch bei ihm von einer Gemeinde seiner Leser die Rede, wie es früh schon für die Leser Schmidts üblich geworden war – ist der Briefwechsel insoweit ergiebig, als er Schmidts Bemühungen um den jungen Autor gut dokumentiert: Schmidt ermutigt Wollschläger immer wieder zur Fertigstellung seines Romans Herzgewächse, empfiehlt das Manuskript bei den Verlagen, zu denen er Kontakt hat, verschafft Wollschläger seine ersten Aufträge als Übersetzer und holt ihn zu dem großen Projekt der Poe-Übersetzung mit ins Boot. Als Schmidt dann in die Niederschrift von Zettel’s Traum abtaucht und der Briefwechsel immer loser wird, ist Wollschläger so weit etabliert, dass er von Suhrkamp – trotz seiner Verbindung zu Arno Schmidt, von dem Verlagschef Unseld nicht viel zu halten scheint – den Auftrag erhält, den Ulysses neu zu übersetzen. Damit schreibt er sich dann endgültig in die deutsche Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts ein.
Und trotz der Koketterie des einleitenden Zitats ist es natürlich klug, sich beim Lesen von Briefen fremder Menschen klar zu machen, dass man damit unvermeidlich in einen privaten Bereich vordringt, den zu betreten man ganz eigentlich kein Recht hat. Mich hat die Lektüre dieses Briefwechsels von beiden Autoren weiter entfernt; ein wenig mehr von Schmidt, ein deutliches Stück mehr von Wollschläger, obwohl hier die Distanz ohnehin schon erheblich war. Aber das liegt nun ausschließlich an mir und tut für das Buch weiter nichts zur Sache. Nur einmal mehr hat sich das Wort Schmidts bestätigt, dass sich ein Schriftsteller langsam in seine Werke auflöse; „den zurückbleibenden schäbigen Rest besieht man sich besser nicht“.
Arno Schmidt: Der Briefwechsel mit Hans Wollschläger. Briefe IV. Hg. v. Giesbert Damaschke. Berlin: Suhrkamp, 2018. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 1034 Seiten. 68,– €.