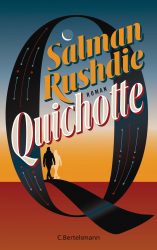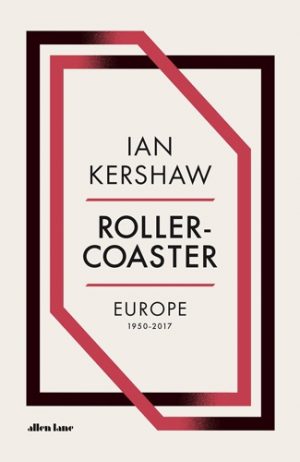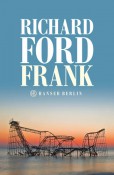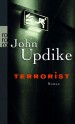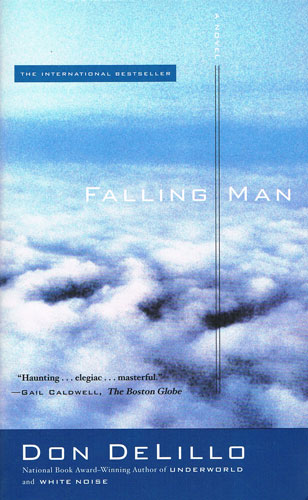Solche Geschichten gehen alles in allem nicht gut aus.
Georg Christoph Lichtenberg hat einmal gemeint:
Ob ich gleich weiß, daß sehr viele Rezensenten die Bücher nicht lesen die sie so musterhaft rezensieren, so sehe ich doch nicht ein was es schaden kann, wenn man das Buch lieset, das man rezensieren soll.
Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe I. München: Hanser, 1968. S. 659. [J 46]
Woran allein man gut erkennen kann, dass Lichtenberg mit der Literatur unserer Zeit nicht hinreichend bekannt war. Denn die meisten Rezensionen zu Salman Rushdies neuem Roman, in die ich hineingeschaut habe, werden mit dem Buch spielend fertig, weil ihre Verfasser das Buch offenbar nicht oder wenigstens nur flüchtig gelesen haben. Hat man dagegen den Roman und halbwegs gründlich gelesen, sieht man sich vor die herkulische Aufgabe gestellt, das Buch in aller Kürze vorzustellen zu sollen, ohne es entweder in einem vollständig falschen Licht erscheinen zu lassen oder sich komplett in kryptisches Raunen zu verlieren. Versuchen wir es dennoch:
Erzählt wird diese Geschichte auf mindestens zwei fiktionalen Ebenen – Arno Schmidt hätte von einem Längeren Gedankenspiel gesprochen –, erstens der des fiktiven Schriftstellers Sam DuChamp (das ist nur sein Pseudonym, seinen wahren Namen erfahren wir nicht), eines mäßig erfolgreichen Verfassers von Agenten-Thrillern, der gerade dabei ist, die Geschichte eines Quichottes des 21. Jahrhunderts zu schreiben, die die besagte zweite Ebene bildet. Dieser Schriftsteller, der wie die meisten Figuren dieser Ebene nur nach seiner verwandtschaftlichen Beziehung benannt wird, Bruder also, lebt in New York und ist seit vielen Jahren mit seiner Schwester, Schwester genannt, zerstritten, nachdem er ihr vorgeworfen hatte, sich am väterlichen Erbe betrügerisch bereichert zu haben. Schwester ist Rechtsanwältin und lebt, verheiratet mit einem Richter, mit dem sie die Tochter Tochter hat, in London. Sie steht kurz vor dem Gipfel der gesellschaftlichen Anerkennung, da sie Sprecherin des englischen Oberhauses werden soll. Aber auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt.
Weder Bruder noch Schwester sind ihre Karrieren an der Wiege gesungen worden: Beide stammen – wie der sie erfindende Autor Salman Rushdie – aus Bombay. Auch der von Bruder erfundene Quichotte stammt aus dieser Stadt, lebt aber ebenfalls schon lange in den USA; er ist etwa 70 Jahre alt, wird zu Anfang des Buches von seinem Cousin zwangspensioniert – er hat zuletzt als Pharmavertreter gearbeitet. An seine Vergangenheit kann er sich nur lückenhaft erinnern, da er früher einmal einen Schlaganfall erlitten hat; seitdem ist er etwas wunderlich geworden, verbringt seine Freizeit hauptsächlich vor dem Fernseher (das sind seine Ritterromane!) und ist verliebt in die ebenfalls aus Indien stammende Talkshow-Moderatorin Salma R. (!) In die Freiheit des Ruhestandes entlassen, begibt er sich auf eine Quest, Salmas Liebe zu erlangen. Um den langen Weg nach New York nicht alleine zurücklegen zu müssen, erfindet er sich einen Sohn, Sancho, der auf gewisse Weise eine dritte fiktionale Ebene in das Buch einzieht. Dieser erfundene Sohn, obwohl zuerst eindeutig ein Gedankenprodukt Quichottes, gewinnt rasch an Selbstständigkeit und wird zur dritten Hauptfigur des Romans. Er erweist sich dabei weniger als ein Abbild des Sancho Pansa des Cervantes, sondern ist offenbar an Collodis Pinocchio entlang erfunden.
Das Buch erzählt in alternierenden Abschnitten die Geschichten Quichottes, Bruders und schließlich auch Sanchos. Dabei nutzt Rushdie alle Freiheiten des traditionellen pikarischen Romans: Immer wieder finden sich Nebengeschichten und unvorbereitete Abschweifungen, Pfade der Erzählung, die letztlich nirgends hin führen, fantastische Einschübe, albtraumhafte Sequenzen und was der Tricks mehr sind. Die Flut der Anspielungen auf Literatur, aber besonders auch auf Film und Fernsehen ist überwältigend – allein mit der Aufzählung der Offensichtlichsten ließen sich Seiten füllen –; ganz nebenbei wird ein Agententhriller eigebaut, in den Bruders Sohn Sohn verwickelt ist; es wird die Opioid-Sucht in der amerikanischen Gesellschaft thematisiert; der alltägliche Rassismus in den USA kommt ebenso vor wie das Problem des Kindesmissbrauchs in Familien; und nicht zuletzt sind auch Verschwörungstheoretiker prominent vertreten und ein wirtschaftlich erfolgreiches Genie, das den Weltuntergang prophezeit und die Menschheit auf die Erde eines Paralleluniversums hinüber retten will. Und bei all diesen Wendungen und Themen findet Rushdie immer erneut einen Weg, sie auf den Ritter von der traurigen Gestalt und seinen verzweifelten Kampf gegen die Realität zurückzubeziehen.
Ich weiß wohl, dass Rushdies Bücher immer so sind, wenn ich auch von seinen Romanen zu wenige gelesen habe, um dieses Vorurteil tatsächlich inhaltlich füllen zu können, aber es hat mich überwältigt. Dieses Buch ist von einem Reichtum an Erfindung, einer Freiheit der Phantasie, einer Stringenz des Gedankens und nicht zuletzt einem so souveränen Humor, dass ihm eine Besprechung wohl nicht gerecht werden kann. Um auch mit Lichtenberg zu schließen, sei einmal mehr gesagt:
Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.
Ebd. S. 359. [E 79]
Salman Rushdie: Quichotte. Aus dem Englischen von Sabine Herting. München: C. Bertelsmann, 2019. Pappband, 461 Seiten. 25,– €.