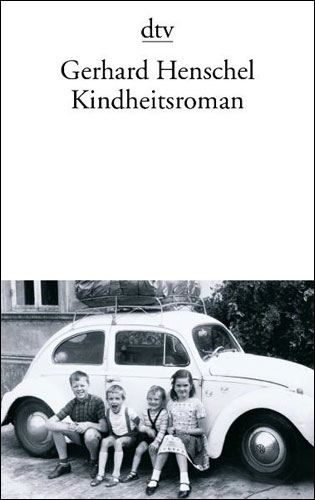Um ausnahmsweise auch einmal der Faszination des Datum zu huldigen und weil ich gerade durch Zufall nach langer Zeit wieder einmal an Hugo von Hofmannsthal vorbeigekommen bin, sei hier die Anekdote erzählt, wie ich zum Leser Arno Schmidts geworden bin. Später erzähle ich vielleicht auch einmal, wie ich darüber hinweg gekommen bin, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein ander Mal … Sorry.
Aufgrund einer langen und bis heute anhaltenden Krankengeschichte habe ich eine sehr krumme Schulkarriere hinter mich gebracht. Nach den Sommerferien 1979 kehrte ich ans Gymnasium zurück und besuchte in Solingen die Oberstufe, nachdem ich zuvor einen sogenannten qualifizierten Abschluss der Realschule erworben hatte. Damals kamen die „Absolventen“, also jene, die wie ich zum Upgrade des Schulabschlusses berechtigt waren, in den Genuss von Ergänzungsunterricht in den Hauptfächern, der dem zuvor angesammelten Wissensmangel der Realschulen aufhelfen sollte. In Deutsch gab diesen Unterricht ein etwas eingetrocknetes, katholisches Fräulein (ob sie tatsächlich eines war, ist mir immer unbekannt geblieben), die unter anderem versuchte, das Interesse (= Dazwischensein) der Schülerinnen und Schüler durch einen Ausflug in die Liebeslyrik zu erregen. Darunter fand sich an prominenter Stelle auch das folgenden Gedicht Hugo von Hofmannsthals:
Die Beiden
Sie trug den Becher in der Hand
– Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand –
So leicht und sicher war ihr Gang,
Kein Tropfen aus dem Becher sprang.So leicht und fest war seine Hand:
Er ritt auf einem jungen Pferde
Und mit nachlässiger Gebärde
Erzwang er, daß es zitternd stand.Jedoch, wenn er aus ihrer Hand
Hugo von Hofmannsthal: Gedichte. Hg. v. Lorenz Jäger. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999. S. 29.
Den leichten Becher nehmen sollte,
So war es Beiden allzuschwer:
Denn Beide bebten sie so sehr,
Daß keine Hand die and’re fand
Und dunkler Wein am Boden rollte.
Da mir schon damals oft fad war, wenn ich hätte etwas lernen sollen, und mir zum Ausgleich der Schalk im Nacken saß, antwortete ich auf die berüchtigte Frage, was denn der Dichter damit sagen wolle, mit der spontan entwickelten These, es handele sich um die allegorische Beschreibung des ersten Geschlechtsverkehrs zweier Liebender. Das Vagina-Symbol des Bechers in der ersten und die Virilität der zweiten Strophe bereiteten den eigentlich Akt in der dritten Strophe vor, in der zwar nicht die Hände, aber sonstwas zueinander findet und die mit dem berüchtigten Blutopfer des Jungfernmythos endet.
Das dieser Deutung folgende interpretatorische Gestrampel war bei weitem nicht so heftig, wie ich erhofft hatte, aber immerhin schien mir mein Einfall witzig genug, um die Anekdote meinem Philosophielehrer zu erzählen. Der sah mich durchdringend an und fragte: „Kennst Du Arno Schmidt?“, worauf ich wahrheitsgemäß antwortete: „Arno Schmidt? Nie gehört.“ Einige Tage später drückte er mir Sitara und der Weg dorthin in die Hand, das sich als das lustigste Buch herausstellen sollte, das ich bis dahin gelesen hatte.
Auch im Weiteren drückte Schmidt die meisten jener Knöpfe, die bei einem intelligenten, arroganten und autodidaktischen, jedoch mangelhaft belesenen jungen Mann zur Verfügung standen, und als ich mit dem Studium anfing, hatte ich nicht nur den Großteil des Werkes gelesen (im Wesentlichen fehlte damals nur Zettel’s Traum, wenn ich auch sicherlich mit den anderen Teilen des Spätwerks noch an keinem möglichen Rand angekommen war), sondern auch gelernt, was Sekundärliteratur ist und wie sie funktioniert. Ich verdanke diesen drei Jahren viel und habe durch diesen Autor eine merkwürdige Art der literarischen Erziehung genossen. Sicherlich ist da nicht alles glücklich abgelaufen, aber man soll dankbar sein für das, was einem gegeben worden ist. Nur in der Philosophie bin ich ihm schon damals davongelaufen, aber dazu brauchte es auch nicht viel.
Viele Jahre später fand ich dann bei Schmidt die Bestätigung:
Und triefend stand; (‹bezwang ihn, daß er triefend stand› – oder ‹zitternd stand›? Ich wußte’s im Augenblick tatsächlich nich).
Arno Schmidt: Die Wasserstraße. In: Arno Schmidt: Bargfelder Ausgabe, Werkgr. I, Bd. 3. Zürich: Haffmans, 1987. S. 433.
Da hatte es sich gerundet. So etwas wird man später niemals wirklich wieder los.