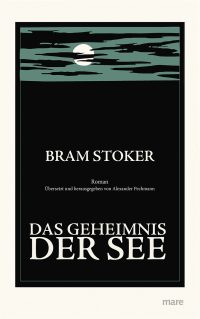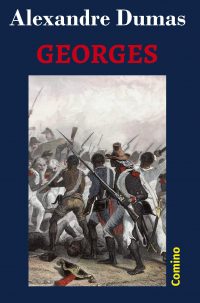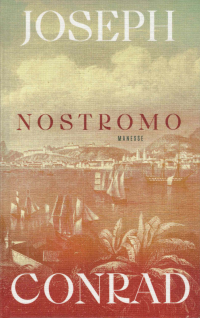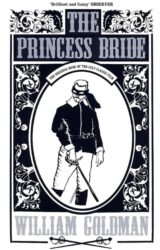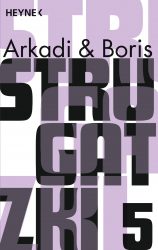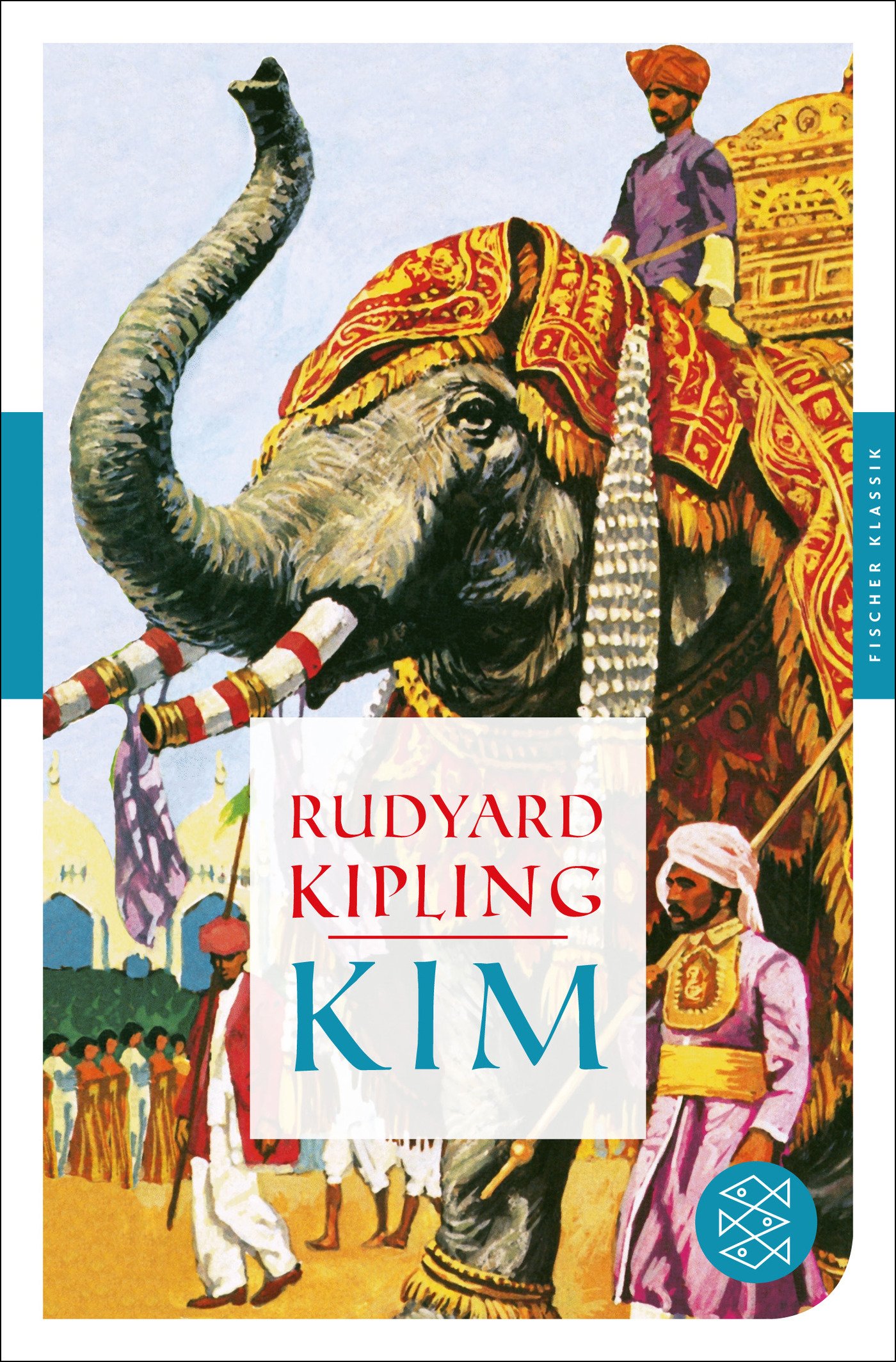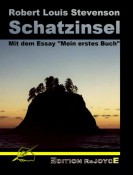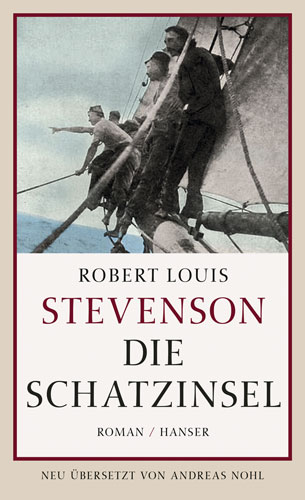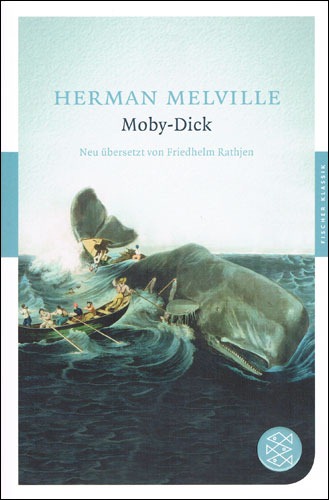Augen, die in der Lage sind, die Oberfläche der Dinge zu durchdringen, können vielleicht auch sehen, was dahinter vorgeht.
Bram Stoker ist als Schriftsteller das, was in der Musikbrache ein „One Hit Wonder“ genannt wird. Wie es um seinen Rang als Schriftsteller bestellt ist, zeigt, dass mehr als eine Biographie über ihn gleich in der Titelei auf seinen Roman „Dracula“ hinweist, damit der Käufer den Namen auch sicher einordnen kann. Und es kann ganz eindeutig festgestellt werden, dass Stoker heute, wie so viele Unterhaltungsschriftsteller seiner Generation, komplett vergessen wäre, wenn er nicht in diesem einen Buch zufällig auf einen Archetyp des kindlichen Gruselns gestoßen wäre.
Nun hat sich der mare Verlag, der auf Bücher über das Meer ein wenig spezialisiert ist, entschlossen, Stokers „Das Geheimnis der See“ von 1902 herauszugeben; ich vermute fast, dass es sich um die Erstübersetzung des Romans handelt – und so ist er denn auch. Das Buch stellt nach dem Motto des Goetheschen Theaterdirektors „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“ eine Melange aus allen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert populären Formen der Unterhaltungsliteratur dar: ein wenig Schauerroman mit Geistern und 2. Gesicht, ein wenig Liebesroman mit einer reichen amerikanischen Erbin, ein wenig historischer Roman um die Spanische Armada (die reiche Erbin heißt auch noch absichtlich Drake mit Nachnamen), ein wenig politischer Roman um den Spanisch-Amerikanischen Krieg, ein wenig Verschwörungsroman, in dem die Spanier versuchen, Miss Drake umzubringen, die sich mit ihrem Geld in den Krieg eingemischt hat, ein wenig Schatzsuche nach einem verlorenen spanisch-katholischen Schatz, der von einem Spanier in Schottland versteckt worden ist, ein wenig Detektiv-Roman, in dem ein äußerst schwieriger Code geknackt werden muss, um den Ort des Schatzes herausfinden zu können (zum Glück oder Unglück geht das offenbar nicht mit dem schon erwähnten 2. Gesicht!), ein wenig Abenteuer-Roman, denn der Schatz kann natürlich nur unter den größten Gefahren für die beiden Liebenden gehoben werden.
Nun könnte sowas eventuell gelingen, wenn es ein souveräner Schriftsteller mit der nötigen Ironie versuchen würde, aber leider ist Bram Stoker genau das nicht. Alle Details des Romans tauchen genau an der Stelle auf, an der sie gebraucht werden; nicht einmal seine aus äußerster Not zu rettende Herzensdame darf der Ich-Erzähler wenigstens 20 Seiten vor der Rettung etwa aus einer Kutsche steigen sehen. Und dass sich der Erzähler als Kind mit Kryptographie die Zeit vertrieben hat, erfahren wir keine einzige Zeile früher, als er mit seiner Meisterleistung des Codeknackens beginnt, die selbst dann völlig im Allgemeinen bleibt – so kann jeder Protagonist ein Sherlock Holmes sein. Auch die Dialoge werden über Seiten hin ohne jegliche Voraussicht vor sich hin erfunden und sind entsprechend belanglos. Da wundert es dann auch nicht (wenigstens mich nicht), dass Stoker zu faul war, in den Kalender von 1897 zu schauen und deshalb in der Nacht zum 1. August einen Vollmond scheinen lässt. Kurz: Das Ding ist eine flüchtig hingesudelte Scharteke, wie es sie zu jeder Zeit gegeben hat, und wäre besser vergessen geblieben.
Einzig zu loben ist die Ausstattung des Bandes: Der bedruckte Leinenband mit Fadenheftung nimmt die Gestaltung der englischen Erstausgabe auf und liegt gut in der Hand. Wenn nur der Rest danach wäre!
Bram Stoker: Das Geheimnis der See. Aus dem Englischen von Alexander Pechmann. Hamburg: Mare, 2024. Bedruckter Leinenband im Schuber, Fadenheftung, Lesebändchen, 539 Seiten. 48,– €.