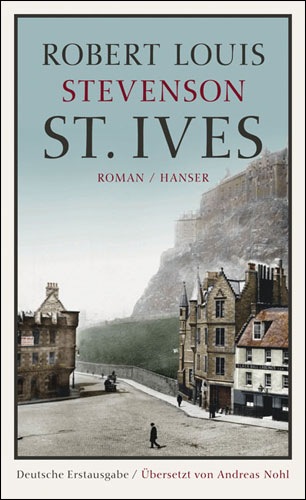Von Zeit zu Zeit, so scheint es, entlässt die historische Evolution Hechte in die stillen Wasser der Gesellschaft, damit die fetten Karauschen, die sich am Grund von Plankton nähren, aufgestört werden.
 Der vierte Band der Gesammelten Werke schließt thematisch an den ersten Band an und bringt fünf Texte, die fast alle um Probleme der menschlichen, zivilisatorischen Entwicklungshilfe auf anderen Planeten kreisen. Wie zuvor schon erwähnt, entspricht die Kindle-Edition dieses Buches nicht dem Standard, da sie über kein Inhaltsverzeichnis verfügt.
Der vierte Band der Gesammelten Werke schließt thematisch an den ersten Band an und bringt fünf Texte, die fast alle um Probleme der menschlichen, zivilisatorischen Entwicklungshilfe auf anderen Planeten kreisen. Wie zuvor schon erwähnt, entspricht die Kindle-Edition dieses Buches nicht dem Standard, da sie über kein Inhaltsverzeichnis verfügt.
»Fluchtversuch« (1962) stellt die Erfindung des Themas dar: Die Freunde Wadim und Anton planen im Jahr 2250 einen Jagdausflug zum Planeten Pandora, als kurz vor dem Abflug der ihnen unbekannte, vorgebliche Historiker Saul zu ihnen stößt und sie kurzerhand überredet, ihn auf irgend einen unbesiedelten, erdähnlichen Planeten zu bringen. Der von Wadim anscheinend zufällig ausgewählte Planet erweist sich dann aber als durchaus besiedelt, und die drei Kosmonauten finden dort eine sehr merkwürdige Lage vor: Der Planet wird offenbar von einer hochstehenden, nichtmenschlichen Zivilisation als eine Art Umschlagbahnhof für ihre Technologie benutzt. Dies hat die einheimische humanoide Zivilisation, die sich auf dem Niveau eines kriegerisch geprägten Mittelalters befindet, in eine tiefe Krise gestoßen. Einer der lokalen Herrscher versucht, sich die fremde Technologie zunutze zu machen. Obwohl die drei Erdenmenschen selbst mehr oder weniger Zweifel an der Richtigkeit ihres Handelns haben, versuchen sie sich in die Geschehnisse auf dem Planeten einzumischen, müssen am Ende aber die Zwecklosigkeit all ihrer Versuche einsehen und kehren unverrichteter Dinge zur Erde zurück.
»Es ist schwer, ein Gott zu sein« (1964) ist einer der bekanntesten Romane der Brüder Strugatzki und 1989 auch mit einigem Aufwand und Erfolg verfilmt worden. Im Mittelpunkt steht der Adelige Rumata, der in Wirklichkeit der irdische Agent Anton ist, der auf einem Planeten in einer humanoiden, spätmittelalterlichen Zivilisation als historischer Beobachter eingesetzt ist. Rumata befürchtet das Entstehen einer faschistischen Diktatur und versucht seine Kollegen dazu zu überreden, dagegen aktiv Widerstand zu leisten. Doch sind seine Mithistoriker weder von der drohenden Gefahr überzeugt, noch davon, dass sie berechtigt sind, in den Lauf der lokalen Geschichtsentwicklung einzugreifen. Aus diesem Konflikt heraus entwickelt sich eine ordentliche Mantel- und Degen-Klamotte mit Faust- und Florettkämpfen, Liebesgeschichte, Kerkerbefreiung und allem, was sonst noch dazu gehört. Man muss zugeben, dass dieser Teil des Textes von den beiden Autoren mit großer Lust am Genre geschrieben wurde und offenbar für seine Popularität verantwortlich ist. Es gibt sonst nicht viele Passagen bei den Brüdern Strugatzki, die vergleichbar unbeschwert daherkommen.
»Unruhe« (entstanden Mitte der 60er Jahre, veröffentlicht erst 1990) ist eine frühe, laut dem Herausgeber stark abweichende Fassung von »Die Schnecke am Hang«. Da ich aber wenig Lust hatte, weite Teile dieses Textes noch einmal zu lesen, habe ich vorerst auf eine Lektüre verzichtet.
»Die dritte Zivilisation« (1971) erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe von Kosmonauten, die einen scheinbar weitgehend leblosen Planeten für die Übersiedlung einer von einer Katastrophe bedrohten Spezies vorzubereiten versucht. Ich-Erzähler ist der Kybertechniker Stas Popow, dessen erster Einsatz im All es ist und der in der Hauptsache für die Wartung und den Betrieb der mitgeführten Roboter zuständig ist. Die erste Überraschung für die Gruppe ist der Fund eines abgestürzten irdischen Raumschiffs, dessen beide Kosmonauten beim Absturz ums Leben gekommen sind. Kurz darauf erweist es sich aber, dass offenbar noch ein dritter Mensch an Bord war, ein kleines Kind, das entgegen aller Wahrscheinlichkeit auf dem Planeten nicht nur überlebt hat, sondern sowohl anatomisch als auch psychisch an den unwirtlichen Gastplaneten angepasst wurde. Die Kosmonauten entwickeln die Theorie, dass der Planet von einer introvertierten Spezies bewohnt wird, die in Höhlen unter der Planetenoberfläche existiert und das kleine Kind, so gut sie konnte, gerettet hat, das auf diese Weise zum einzigen Vertreter einer dritten Zivilisation auf dem Planeten geworden ist. Am Ende bleibt auch hier den Menschen nichts, als sich tatenlos zurückzuziehen und auf eine spätere Gelegenheit zum Kontakt zu hoffen.
»Der Junge aus der Hölle« (1974) schildert den Prozess und die Folgen der zivilisatorischen Entwicklungshilfe aus der Perspektive eines der Wilden. Der junge Gagh stammt aus einer militaristischen Zivilisation und ist im soldatischen Sinne erzogen worden. Er wird aber von Menschen vor dem Tod gerettet und zur Heilung auf die Erde gebracht. Dort wird er zwar freundlich behandelt, aber weitgehend sich selbst überlassen, so dass er sich gegenüber der ihm fremden irdischen Kultur abkapselt und versucht, auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren, was er schließlich auch mit einer selbstgebauten Waffe erzwingt. Die Geschichte wird kapitelweise abwechselnd in personaler und Ich-Perspektive erzählt, was sie aber nur mäßig interessanter macht. Sie leidet wohl am deutlichsten darunter, dass hier die Wahrscheinlichkeit der Fabel der Absicht der Autoren geopfert werden muss, darzustellen, dass es nicht genügt, Angehörige einer fremden Kultur mit den Segnungen der eigenen, fortgeschrittenen Zivilisation zu überschütten, sondern dass eine prinzipielle Umerziehung stattfinden muss, wenn ein kultureller Fortschritt erreicht werden soll. – »So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.«
Arkadi und Boris Strugatzki: Gesammelte Werke 4. Deutsch von Dieter Pommerenke (Fluchtversuch), Arno Specht (Es ist schwer, ein Gott zu sein), David Drevs (Unruhe), Aljonna Möckel (Die dritte Zivilisation) und Erika Pietraß (Der Junge aus der Hölle). Die beiden ersten Texte nach den ungekürzten und unzensierten Originalversionen ergänzt von Erik Simon. München: Heyne, Kindle-Edition, 2012. 880 Seiten (Buchausgabe). 9,99 €.