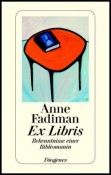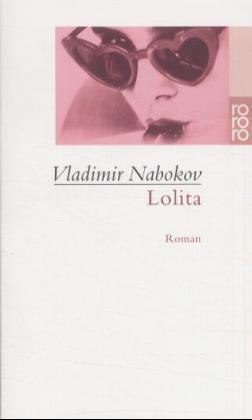Das schmale Bändchen enthält 19 fiktive Briefe eines Briefwechsels zwischen dem amerikanischen Kunsthändler Max Eisenstein und seinem nach Deutschland zurückgekehrten Freund und ehemaligen Geschäftspartner Martin Schulse. Der Briefwechsel beginnt mit einem Schreiben vom 12. November 1932 und endet mit dem amtlichen Stempel »Adressat unbekannt« vom 18. März 1934. Die Erzählung ist 1938 zum ersten Mal erschienen und war sofort ein Verkaufserfolg, der sich bei der Wiederveröffentlichung im Jahr 1995 wiederholt hat. Auch die deutsche Ausgabe aus dem Jahr 2000 wurde ein Bestseller.
Das schmale Bändchen enthält 19 fiktive Briefe eines Briefwechsels zwischen dem amerikanischen Kunsthändler Max Eisenstein und seinem nach Deutschland zurückgekehrten Freund und ehemaligen Geschäftspartner Martin Schulse. Der Briefwechsel beginnt mit einem Schreiben vom 12. November 1932 und endet mit dem amtlichen Stempel »Adressat unbekannt« vom 18. März 1934. Die Erzählung ist 1938 zum ersten Mal erschienen und war sofort ein Verkaufserfolg, der sich bei der Wiederveröffentlichung im Jahr 1995 wiederholt hat. Auch die deutsche Ausgabe aus dem Jahr 2000 wurde ein Bestseller.
Erzählt wird die Geschichte zweier Freunde, die in San Francisco gemeinsam eine Kunsthandlung betrieben haben. Martin Schulse entschließt sich 1932 nach Deutschland zurückzukehren, besonders um seine Kinder wieder auf eine deutsche Schule schicken zu können. Er wird innerhalb kurzer Zeit von einem Mitläufer der politisch erfolgreichen Nationalsozialisten zu einem bekennenden Anhänger der »Bewegung« und macht Karriere als Bankbeamter. Ganz konsequent bricht er den Kontakt zu seinem jüdischen Freund und Geschäftspartner in Amerika ab und kündigt ihm die Freundschaft auf.
Verwickelt wird die Geschichte dadurch, dass Max Eisensteins Schwester Giselle als Schauspielerin von Österreich nach Deutschland kommt und in Berlin rassistischen Repressionen ausgesetzt wird. Sie flieht aus Berlin nach München, wird offenbar auch dort erkannt und flüchtet sich vor einem Trupp SA-Männer zur Villa ihres ehemaligen Geliebten Martin Schulse. Der lässt sie aus Sorge um seine Reputation und Stellung nicht ins Haus, sondern rät ihr, durch den Garten zu fliehen, wo sie dann von der SA gestellt und ermordet wird. Der Brief, in dem er diese Tatsache seinem ehemaligen Freund mitteilt, beginnt mit den Worten:
Heil Hitler! Ich bedaure sehr, Dir schlechte Nachrichten übermitteln zu müssen. Deine Schwester ist tot.
Nach diesem Brief beginnt Max Eisenstein mit einem Telegramm und Briefen, die er an Martin Schulses Privatadresse richtet und von denen er weiß, dass sie von der nationalsozialistischen Zensur gelesen werden, den deutschen Behörden eine Verwicklung Martin Schulses in eine illegale, gegen den Staat gerichtet Verschwörung zu suggerieren. Er erfindet eine »Gesellschaft Junger Deutscher Maler«, mit der Schulse vorgeblich in Zusammenhang steht und die offensichtlich Waffenlieferungen aus den USA erhält. Außerdem suggeriert er eine in Amerika lebende jüdische Verwandschaft Schulses. Schulse wird – wie wir aus einem letzten, verzweifelten Schreiben an Max Eisenstein erfahren – daraufhin von den Behörden vorgeladen und aufgefordert, den Code für die Briefe zu liefern, was er natürlich nicht kann, da er nie zuvor von einer »Gesellschaft Junger Deutscher Maler« gehört hat und auch sonst nichts zu den erfundenen Vorgängen sagen kann. Max Eisenstein Racheplan funktioniert: Seinen letzten Brief an Martin Schulse vom 3. März 1934 erhält er mit dem amtlichen Stempel »Adressat unbekannt« vom 18. März 1934 zurück. Wie bereits zuvor im Fall von Max’ Schwester Giselle soll dieser Stempel besagen, dass Martin Schulse von den Nationalsozialisten ermordet wurde oder zumindest in einem KZ gelandet ist.
Die Erzählung ist fraglos »gut gemacht«. Sie ist dicht gearbeitet und die dramatische Entwicklung konsequent und ökonomisch vorangetrieben. Große Schwierigkeiten habe ich allerdings mit ihrer Moral: Sicherlich ist es einerseits so, dass die Perversität und Menschenverachtung des nationalsozialistischen Machtstaates sich gerade darin zeigt, dass es einem Außenstehenden mit wenigen Briefen gelingt, einen treuen und begeisterten Nationalsozialisten zu verleumden und der Vernichtungsmachinerie des von ihm verherrlichten Systems auszuliefern. Andererseits handelt es sich bei den Briefen Max Eisensteins um eine Intrige zum Zweck einer privaten Rache, die ihn moralisch beinahe ununterscheidbar werden lässt von dem, den er dem Untergang ausliefert.
Immanuel Kant gibt uns in seiner »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« unter anderen folgende einprägsame Formulierung des kategorischen Imperativs:
Der praktische Imperativ wird also folgender sein: Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. [BA 66 f.]
Gemessen an diesem Leitsatz handelt Max Eisenstein ebenso verwerflich wie zuvor sein Pendant Martin Schulse, und ich bin durchaus nicht sicher, ob dies von der Autorin auch so intendiert wurde. Auch spielt – soweit ich sehe – dieser Aspekt in den deutschen Besprechungen des Buches keine Rolle.
Immerhin lässt Kant der zitierten Passage den bedenkenswerten Satz folgen: »Wir wollen sehen, ob sich dieses bewerkstelligen lasse.« Im vorliegenden Fall war dem wohl nicht so. – Ein Buch, dessen verstörende Ambivalenz wahrscheinlich nicht von allzu vielen Lesern wahrgenommen wird.
Kressmann Taylor: Adressat unbekannt. Aus dem Amerikanischen von Dorothee Böhm. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2000. Pappband, 69 Seiten. 10,– €.