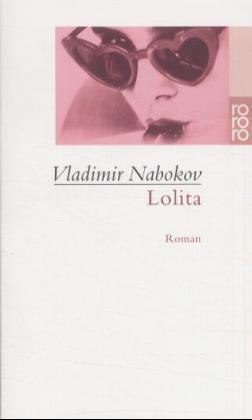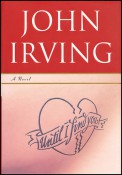Als Vladimir Nabokov im Sommer 1953 begann, seinen Roman »Lolita« zu schreiben, war er ein unbekannter russischer Emigrant, der an der Cornell University in New York Literatur unterrichtete und Romane in englischer Sprache schrieb, die zwar Kollegen und Kritiker schätzten, die aber sonst kaum gelesen wurden. Als im November 1959 der englische Generalstaatsanwalt bekannt gab, dass er gegen die Publikation und den Vertrieb des Romans »Lolita« in England nicht vorgehen würde, war der Weltruhm Nabokovs endgültig gesichert: Es war von staatlicher Seite anerkannt worden, dass es sich bei »Lolita« um Kunst, nicht um Pornographie handelt.
Vladimir Nabokov ist in den Augen einer breiten Öffentlichkeit der Autor eines einzigen Buches: »Lolita«. Mit dem Skandal um dieses Werk ist Nabokov in die Weltliteratur eingegangen, und das, obwohl es sich für die meisten bei »Lolita« wohl eher um ein Gerücht als um ein Buch handeln dürfte. Viele haben sicherlich inzwischen eine der beiden Verfilmungen gesehen: Die frühe von 1962, die den Regisseur Stanley Kubrick zu einer Marke machte, und die spätere von 1997, die – wenn auch nur unwesentlich freizügiger als die 35 Jahre ältere – auch heute noch in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern keine Jugendfreigabe besitzt.
Lolita erzählt die Geschichte einer Obsession. Erzählt wird sie vom Protagonisten des Romans – einem Professor für romanische Literatur – aus der Ich-Perspektive als Erinnerung und Rechtfertigung für die Tat, wegen der er im Gefängnis sitzt und auf seinen Prozess wartet: Er hat einen Mann erschossen und versucht nun sich selbst, der Jury und der Welt begreiflich zu machen, was zu diesem Mord geführt hat. Als das Buch erscheint, ist sein Held bereits tot: Gestorben in der Untersuchungshaft an einem gebrochenen Herzen – »Koronarthrombose« nennt es der Totenschein –, nur einen guten Monat bevor das Objekt seiner Begierden und Sehnsüchte, seine geliebte Lolita stirbt.
Humbert Humberts – so der obskure Name des Erzählers, der aber nur ein Pseudonym sein soll – Geschichte beginnt aber nicht damit, dass er Lolita kennenlernt, sondern mit der Erzählung von einer Jugendliebe: Als er 13 Jahre alt ist verliebt er sich im Hotel seines Vaters an der Riviera in die Tochter eines Gastes, eine kurze, leidenschaftliche Sommerliebe zweier Kinder, die damit endet, dass Annabel vier Monate später auf Korfu an Typhus stirbt. Humbert hat diesen Verlust nie verwunden.
Und so ist er sich selbst weitgehend wehrlos ausgeliefert, als er sich viele Jahre später – inzwischen amerikanischer Staatsbürger – für den Sommer in das kleine Städtchen Ramsdale begibt, um dort an einem Buch zu arbeiten, und dabei auf Lolita, die Tochter seiner alleinstehenden Wirtin trifft.
Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden. Meine Sünde, meine Seele. Lo-li-ta: die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei Drei gegen die Zähne. Lo. Li. Ta.
Sie war Lo, einfach Lo am Morgen, wenn sie vier Fuß zehn groß in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita.
Humbert verliebt sich rettungslos in das kokette Mädchen, dem es Spaß macht, mit dem etwas weltfremden Kauz zu flirten und ihre Macht über ihn auszuspielen. Humbert geht soweit, ihre Mutter zu heiraten, bloß um in Lolitas Nähe bleiben zu können. Als ein »glücklicher Zufall« zum Tod der Mutter führt, beginnt Humbert eine ziellose Fahrt mit Lolita durch Amerika, von Motel zu Motel, immer in der Furcht entdeckt, verfolgt, verhaftet zu werden.
Die Geschichte endet wie sie enden muss: Humberts Eifersucht – die nicht unbegründet ist, wie sich herausstellt – führt zu Streit und Entzweiung, und schließlich verschwindet Lolita eines Tages mit dem Mann, den Humbert Jahre später erschießen wird, weil er ihm Lolita geraubt hat.
»Lolita« ist wesentlich ein trauriges Buch, das Buch eines Sentimentalen, der auf sein gescheitertes Leben zurück- und einem Todesurteil entgegenblickt. »Lolita« ist alles andere als ein erotisches Buch – auch wenn sein Thema die sexuelle Beziehung eines alten Mannes zu einem minderjährigen Mädchen ist – und nichts in dem Buch rechtfertigt auch nur den den Verdacht, es können sich um ein pornographisches Werk handeln. »Lolita« ist allerdings ein herausragendes Buch, geschrieben von einem der lesenswerten Autoren des 20. Jahrhunderts, der ohne den Skandal um das Buch sicherlich auch weiterhin eine Randexistenz im Literaturbetrieb seiner Zeit hätte führen müssen.
Ich rate all denen, die das Buch noch nicht kennen, »Lolita« auf die Leseliste zu setzen und dadurch vielleicht einen Autor kennen zu lernen, der über dieses eine Buch hinaus ein Gesamtwerk geschaffen hat, das zu den intelligentesten und literarischsten des 20. Jahrhunderts gehört!
Vladimir Nabokov: Lolita. Aus dem Englischen von Helen Hessel, Maria Carlsson, Kurt Kusenberg, Heinrich M. Ledig-Rowohlt und Gregor Rezzori bearb. von Dieter E. Zimmer. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999. 8,90 €.