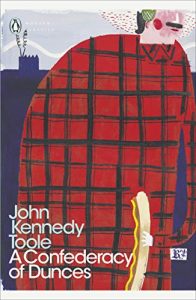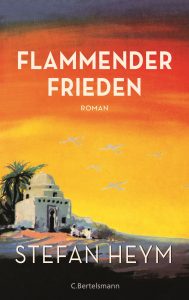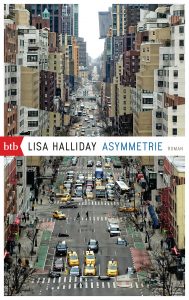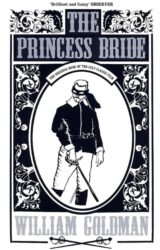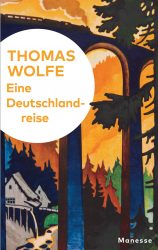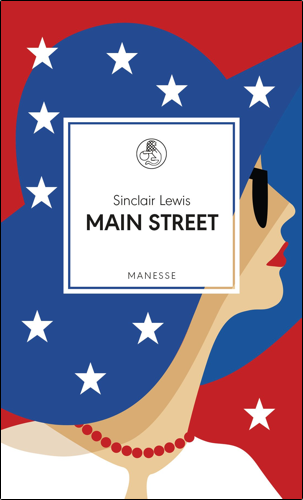You could tell by the way that he talked, though, that he had gone to school a long time. That was probably what was wrong with him.
Ich muss gestehen, dass mich dieses Buch sehr spät erreicht hat. Geschrieben in den 1960er-Jahren, erschienen nach langem Widerstand diverser Verlage erst 1980, erhielt es 1981 den Pulitzer-Preis für Fiction und wurde schon 1982 zum ersten Mal und dann 2011 ein weiteres Mal ins Deutsch übersetzt. Dennoch ist mir das Buch bewusst erst letztes Jahr über den Weg gelaufen. In den USA wird es als wegweisendes Buch der sogenannten Southern literature gelesen und steht auf zahlreichen Must-read-Listen. In Deutschland scheint es mir immer noch ein Geheimtipp zu sein; aber da kann ich mich irren.
Erzählt werden einige Wochen aus dem Leben des Ignatius J. Reilly, eines übergewichtigen 30-Jährigen, der in New Orleans im Haus seiner Mutter Irene wohnt, den Kontakt zur Außenwelt so gut wie möglich meidet und sich in exzessiver Kritik des Kinos und Fernsehprogramms übt. Ignatius hat Mediävistik studiert und auch einige Zeit an der Universität unterrichtet, konnte sich aber nicht ins Hochschulsystem einpassen und wurde entlassen. Seitdem liegt er seiner Mutter auf der Tasche.
Erzählanlass ist ein Autounfall, bei dem Ignatius’ entnervte Mutter versehentlich beim Ausparken in ein Gebäude fährt und einen Balkon beschädigt. Der Hauseigentümer verlangt, dass die Reillys ihm den Schaden, gut 1.000 $, ersetzen, und um eine juristische Auseinandersetzung zu vermeiden, stimmt Irene dieser Forderung auch zu. Da aber völlig unklar ist, wie die beiden das Geld auftreiben sollen, bleibt als einziger Ausweg, dass Ignatius in die von ihm gehasste Welt zieht und sich Arbeit sucht. Er nimmt zuerst eine Stellung im Büro einer Hosen-Fabrik an, wobei er seinen Vorgesetzten über seine wahre Archivierungs-Methode hinwegtäuscht, die schlicht im Wegwerfen der ihm zur Ablage übergebenen Akten besteht, um schließlich unter den Arbeitern der Fabrik eine Art von Aufstand in Szene zu setzen. Nach seiner Entlassung beginnt er als Hotdog-Verkäufer zu arbeiten, dies aber auch nur, weil er dabei als sein bester Kunde nahezu unbegrenzten Zugriff auf die Würsten hat.
Neben dieser scheinbaren Haupthandlung entwickeln sich zahlreiche Nebenhandlungen, die nicht im Einzelnen erzählt zu werden brauchen. Es ist genug zu sagen, dass sich die Konsequenzen der einzelnen Handlungsstränge zu einem immer bedrohlicheren Szenarium für den Protagonisten aufzubauen scheinen, wobei die drohenden Schicksalsschläge Ignatius immer wieder auf wundersame Weise verfehlen.
Ein etwas überdrehter, aber intelligenter und witziger Roman von einer überraschenden Welthaltigkeit. Er steht klar in der Tradition des modernen Schelmenromans und erweist sich trotz seiner anekdotischen Struktur als gut konstruiert. Ein Tipp für ein verregnetes Wochenende.
John Kennedy Toole: A Confederacy of Dunces. Kindle-Edition. Penguin / Random House, 2016. 338 Seiten (Druck-Ausgabe). 8,99 €.